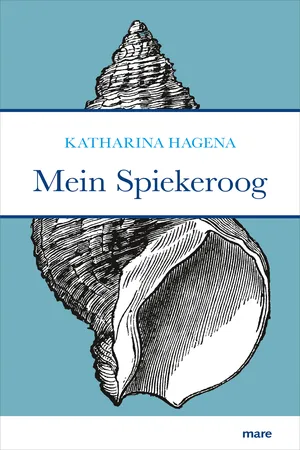
- 160 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Mein Spiekeroog
Über dieses Buch
Seit ihre Mutter ihr das Schwimmen beigebracht hat, fährt Katharina Hagena fast jeden Sommer mit ihrer Familie nach Spiekeroog. Mit geschlossenen Augen kann sie noch immer die verschiedenen Wege zum Strand am Duft erkennen. Hagena erzählt vom Baden bei Meeresleuchten, vom Zeltplatzkiosk als Ort der Verheißung und von einem Sand, der beim Darübergehen aufschreit. Sie berichtet von vergeblichen Bernsteinsuchen, der Heilkraft von Strandkörben bei gebrochenem Herzen, von Schiffsunglücken, Seenebel und dem Verschwinden der Wellhornschnecke. Hagenas Erinnerungen und Gedanken schärfen die Sinne für die Zerbrechlichkeit der einzigartigen Insel und sind zugleich ein Nachdenken über Sprache, über das In-Worte-Fassen dessen, was nicht bleibt, seien es eine Sandbank, der Geruch von Strandwermut oder das möwenfarbene Haar ihrer Mutter.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Mein Spiekeroog von Katharina Hagena im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Personal Development & Travel. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
Personal DevelopmentThema
TravelSchwimmen 4
Sobald das Wasser steigt, läutet die Glocke am DLRG-Häuschen, und damit beginnt die Badezeit. Der Tidenkalender hängt auch an diesem Häuschen, denn die Badezeit bewegt sich jeden Tag eine Dreiviertelstunde nach hinten. Läuft das Wasser nach sieben Uhr abends auf, ist am nächsten Tag wieder ganz früh morgens Badezeit. Kurz vor dem höchsten Punkt der Flut bimmelt es noch mal, das Wasser zieht sich zurück, und die Badezeit ist zu Ende. Bei ablaufendem Wasser ist die Nordsee um Spiekeroog tückisch. Links und rechts des abgegrenzten Badebereichs gibt es starke Strömungen. Jedes Jahr ertrinken dort Leute, und nicht nur alte und schwache, sondern oft gerade solche, die ins Wasser gelaufen sind, um Alte und Schwache zu retten. Ist man zu weit rausgeschwommen und schafft es nicht mehr zurück, lässt man sich am besten treiben und nutzt seine Kräfte, um über Wasser zu bleiben, zu winken und zu schreien. Gegen Gezeiten und Strömung anzukämpfen, ist sinnlos.
Manchmal klappt es, mit der Strömung parallel zum Ufer und in einem sehr weiten Bogen an Land zu schwimmen. Das kostet weniger Kraft, als den geraden Weg zu nehmen. Treibt man dennoch weiter ab, so kann man sich damit trösten, dass es auf der Nordsee viel Verkehr gibt. Die Chancen, gesehen und gerettet zu werden, sind nicht schlecht.
Am Strand knattern die DLRG-Flaggen, die einem bedeuten, dass man bei allzu starkem Wind nicht ins Wasser gehen soll. Tut man es trotzdem, ist man schon nass, bevor man nur bis zu den Waden drinsteht. Bei Sturm brodelt das Meer, es kocht und zischt, und das Wasser erscheint einem wärmer als die Luft, aber nur, weil die Körperteile, die nicht ganz von Wasser bedeckt sind, vom Wind so heruntergekühlt werden, dass sich alles unter der Wasseroberfläche warm anfühlt.
Wenn sich die Wellen hoch auftürmen, dann brüllen sie, beim Brechen donnern sie. Im Wasser kann man kaum laufen, weil die Strömung an den Beinen zerrt. Versucht man, auf einer Stelle zu stehen, spürt man, wie die Strömung einem den Sand unter den Fußsohlen wegfräst. Wenn man in der Brandung das Gleichgewicht verliert, wirbelt man erst eine ganze Zeit lang unter Wasser herum, schürft sich die Haut am Sand auf, taucht verwirrt und atemlos an einer ganz anderen Stelle wieder auf, blind, mit Salzwasser in den Stirnhöhlen. Nur durch Handzeichen kann man sich unterhalten, der Wind reißt einem die Worte vom Mund.
Das Gefährlichste auf Spiekeroog ist das Meer.
Meeressprache
Meer und Sprache sind untrennbar miteinander verbunden, das erkannte auch Thomas Mann in seinem Strandkorb, wo er die »seelische Einheit« von Epik und Meer betont, von denen eins das Gleichnis des jeweils anderen ist. Allein der Verlag, der dieses Buch herausbringt und sich ausschließlich den, wie Heine es nennt, »meerdurchrauschten Seiten« der Literatur widmet, zeigt diese Einheit Jahr für Jahr aufs Neue. Und dennoch verspüre ich einen gewissen Unwillen, zu beschreiben, was es in mir auslöst, am Strand von Spiekeroog zu stehen und aufs Meer zu schauen, möglichst noch bei Sturm und zu einer Zeit, wenn niemand sonst da ist. Es erscheint mir gleichzeitig zu intim und zu abgedroschen. (Ich möchte auch nicht immer die Meeresbeschreibungen von anderen lesen. Die meisten von ihnen bereiten mir Unbehagen – ähnlich wie Gemälde, auf denen Gott zu sehen ist: Fast alle Abbildungen bärtiger Greise auf Wolken gehen mir auf die Nerven.)
Das Meer ist sowohl das, was mich an den Schreibtisch drängt, als auch das, was ich nicht in Worte fassen kann. Und dies sage ich, gerade weil ich schon so viel über das sich gegenseitige Bedingen und Hervorbringen von Meer und Sprache geschrieben habe und gerade weil ich als Teenager vor allem deshalb angefangen habe, Gedichte zu schreiben, weil ich das Meer sprachlich zu fassen bekommen wollte. Eines davon heißt »Einwunschfrei«, ist tief empfunden und stammt aus einer Phase, in der ich seitenweise Gedichte von Peter Huchel auswendig lernte. Es beginnt mit den Zeilen »Insel sein / nur den Wind zu Gast« und endet mit der Beobachtung »Möwenschreie / ritzen sich ins / Trommelfell ein«.
Mit meinen Gedichten, die ich zu Hause niemandem zeigte, ging ich zum einzigen Dichter, den ich bis dahin je gesehen hatte. Er hieß Ulli Harth, hielt ab und zu Lesungen in den Dünen ab, und noch immer kommt er jedes Jahr nach Spiekeroog. Ich brauchte ein paar Jahre, bis ich endlich den Mut aufbrachte, diesen Schriftsteller zu fragen, wie man das wird, was er war. Er war sehr freundlich und bot mir an, meine Texte einmal anzuschauen, wenn ich das wollte. Natürlich gab ich sie ihm gleich, und er nahm sich Zeit, die kurzen Gedichte zu lesen. Vorsichtig lobte er ein paar Stellen, ohne gönnerhafte Überschwänglichkeit. Noch heute bin ich ihm dankbar für diese großzügige Ermutigung.
Trotz, oder wahrscheinlich eher wegen, meiner eigenen Meereslyrik glaube ich, dass dem Meer sprachlich gar nicht beizukommen ist, was aber nicht bedeutet, dass man es nicht weiter versuchen sollte.
Auch Heinrich Heine hatte ein gespaltenes Verhältnis zur Meereslyrik, denn die Gedichte seines »Nordseezyklus« fangen oft gefühlvoll an, und genau in dem Moment, da uns schon die Tränen der Rührung in den Augen brennen, bricht das lyrische Ich in kaltes Hohngelächter aus und zeigt mit dem Finger auf uns – und damit natürlich auf sich selbst.
Das schon öfter zitierte Nordseegedicht von Rainer Maria Rilke, das mir auf Spiekeroog ständig durch den Kopf schwirrt, handelt daher auch weniger vom Meer als von einer Insel.
Als James Joyce nach Beendigung seines Romans Finnegans Wake gefragt wurde, was er als Nächstes vorhabe, verkündete er vollmundig, ein Buch »in der Sprache des Meeres« schreiben zu wollen. Er starb, bevor er noch ein einziges Meereswort zu Papier bringen konnte. Allerdings kann man mit Fug und Recht behaupten, dass das Anna-Livia-Plurabelle-Kapitel in Finnegans Wake ohnehin schon in Meeressprache verfasst worden ist. Wahrscheinlich jedoch wollte Joyce nur der infamen Frage »Was schreiben Sie als Nächstes?« etwas entgegensetzen. (Meistens hört man diese Frage, wenn man ein Buch beendet hat, über das man nach mühsamer Arbeit und langem, sich selbst aufgenötigtem Schweigen endlich reden möchte. Doch schon zum Zeitpunkt des Erscheinens scheint seine Zeit schon abgelaufen zu sein.) Joyce hätte genauso gut sagen können, er wolle als Nächstes die Biografie Gottes verfassen – und zwar in jener göttlichen Sprache, derer man sich vor dem Einsturz des babylonischen Turms und der daraus folgenden Sprachverwirrung bediente. Und illustriert mit den Bildern vieler bärtiger Wolkengreise.
Es gibt eine ganze Reihe von Lyrik-Anthologien über das Meer, aber oft lese ich ein Gedicht und denke: Wirklich? Das soll das Meer sein? Das ist es, was die Wellen sagen, die Muschel erzählt, der Meerwind herübergetragen haben soll? Ein Konglomerat hübsch klingender Phrasen von jemandem, der sich selbst sehr wichtig zu nehmen scheint? Natürlich ist das unfair, etwas Ähnliches kann man wahrscheinlich über jedes Gedicht sagen. Und nur, weil ich mich selbst in meinen eigenen juvenilen Gedichten sehr wichtig genommen habe, müssen die anderen Dichter es ja nicht auch so gehalten haben.
Sicherlich ist mein Empfinden von Neid geprägt, denn es erscheint mir ungerecht, dass sich das Meer in seiner Pracht nun ausgerechnet diesen Menschen auserwählt hat, um sein Geheimnis preiszugeben und in langen Strophen zu ihm zu sprechen. Warum nicht mich?! Ich halte es mit Friedrich Nietzsche, der in seinem Aphorismus »Im großen Schweigen« höhnisch beklagt, dass das Meer nicht sprechen kann, und, »Ach!«, »welch Malheur«, sein eigenes, ob dieser traurigen Erkenntnis schwellendes Herz »kann leider auch nicht reden!«. Denn natürlich sind wir es, die pausenlos auf das Meer einschwatzen und ihm unsere Gedanken und Gefühle aufdrängen, möglichst in direkter Ansprache wie bei einem Gebet: »Meer, du berührst meine Seele« (so ein Buchtitel aus dem Jahr 2010). Haben solche Autoren einen privaten Zugang zum Strand? Sind Meeresdichter dichter am Meer? Ich kann und will es nicht glauben. Gibt es denn wirklich Menschen, die sagen würden, »das Meer berührt mich nicht, ich bin ausschließlich wegen der Fischbrötchen auf Spiekeroog«? Sicher kommt es auch auf das Fischbrötchen an.
Zum Glück interessiert sich das Meer für niemanden von uns und vor allem nicht für das, was wir zu ihm sagen oder ihm abzulauschen glauben. Das Meer spricht nicht zu uns, und es schreibt auch nicht. Es bleibt diese riesige graugrünbraune, trübe, klare, ruhige, lebendige, brüllende, rauschende, plätschernde, salzige, lebensspendende, lebensbedrohliche, immer gleiche, immer neue Projektionsfläche für Menschen, die das Erhabene und Numinose darin spüren und auf Papier bannen wollen. »Weil du liesest in ihr, was du selber in sie geschrieben (…) / Wähnst du, es fasse dein Geist ahnend die große Natur«, schreibt Friedrich Schiller vor über zweihundert Jahren mit klarem Blick und sanftem Spott, der sich auch gegen ihn selbst richtet. Doch es ist ja nicht schlimm, wenn mein Geist die große Natur nicht ahnend zu erfassen vermag. Deswegen muss ich ja nicht aufhören, sie zu feiern.
Schiller hat sich stark mit der Natur und dem Dichten über dieselbe auseinandergesetzt. Und viele seiner Gedanken sind immer noch gültig, ja vielleicht aktueller denn je: »Unser Gefühl für Natur«, schreibt er in einem Aufsatz, »gleicht der Empfindung des Kranken für die Gesundheit«. Aber was können wir fühlen und dichten, wenn die Natur selbst erkrankt? Noch dazu an uns? In Zeiten von Müllinseln und wärmer werdenden Ozeanen, Walsterben und Algenpest wird das Meer noch eindringlicher besungen und bedichtet als je zuvor. Doch Verklärung ist immer der Beweis für den Verlust des verklärten Gegenstandes, das gilt für die eigene Schulzeit wie für das Unkraut, das nun, da es zusammen mit den Insekten bald ausgerottet ist, in nostalgischer Zerknirschung »Wildblumen« heißt.
Vielleicht scheue ich vor poetischen Nordseeschilderungen zurück, weil ich damit zugeben würde, dass die Nordsee verloren ist. Und gleichzeitig kann ich aus demselben Grund ohne eine Handvoll bestimmter Meeresgedichte nicht leben. Der vierte Teil von Ingeborg Bachmanns »Lieder von einer Insel« gehört jedenfalls dazu:
Wenn einer fortgeht, muß er den Hut
mit den Muscheln, die er sommerüber
gesammelt hat, ins Meer werfen
und fahren mit wehendem Haar,
er muß den Tisch, den er seiner Liebe
deckte, ins Meer stürzen,
er muß den Rest des Weins,
der im Glas blieb, ins Meer schütten,
er muß den Fischen sein Brot geben
und einen Tropfen Blut ins Meer mischen,
er muß sein Messer gut in die Wellen treiben
und seinen Schuh versenken,
Herz, Anker und Kreuz,
und fahren mit wehendem Haar!
Dann wird er wiederkommen.
Wann?
Frag nicht.
Es wäre schön, wenn mein Kapitel hier zu Ende sein könnte. Doch ich brauche, gewissermaßen als Sentimentalitätsprophylaxe, eine Art Heine’sches Hohngelächter, das mich genau dann kalt erwischt, wenn ich anfange, mich zu suhlen. Es gibt einen Satz, der etwas von dem, was ich hier über Meer, Sprache, Sprache des Meeres und romantische Projektion dargestellt habe, zusammenfasst, und er kommt aus Spiekeroog. Ich weiß nicht, wer ihn geschrieben hat. Er ist längst verschwunden, und ich konnte nirgends ein Foto von ihm auftreiben, aber manche werden sich trotzdem an ihn erinnern: Auf einer der Spundmauern im Westen der Insel wurde irgendwann in den Achtzigern ein Graffiti gesprüht, das sich über ungefähr zehn Meter erstreckte. In hohen Großbuchstaben und, wie meine Mutter jedes Mal anmerkte, ohne Komma stand dort geschrieben:
SAGT EUREN ENKELN ES WAR EINMAL SCHÖN HIER!
DIE NORDSEE
Das Graffiti war typisch für den etwas selbstgerechten Anklageton der frühen Umweltschützer. Der lässt sich wahrscheinlich nicht vermeiden, wenn man ein Bewusstsein wecken möchte. Dennoch gefällt mir, dass die Nordsee hier selbst unterschrieben hat, und vor allem, dass sie nicht selbstmitleidig klingt, sondern bei aller Erhabenheit total angepisst.
Über das Finden
Fast alle, die nach Spiekeroog fahren, sind auf der Suche. Die einen suchen Heilung, andere suchen Geschichten, und wieder andere suchen Muscheln. Laut dem Grimmschen Wörterbuch von 1854 ist das Verb finden nah verwandt mit dem Wort bitten und damit nicht weit vom Verb suchen, ja, eigentlich sind suchen und finden dasselbe:
man sagt, geh hin und suche mir den verlornen schlüssel, d. i. find ihn, fr. ist allez chercher und allez trouver einerlei, it. cercare aufsuchen und finden, einen besuchen, aller trouver quelqu’un, sp. catar suchen und finden, niemand würde suchen lassen, wenn nicht gefunden werden soll. zugleich aber versteht sich, dasz der fragende etwas erfragt, der forschende erforscht, der nach etwas fahrende es erfährt, der findende also ein wahrnehmender ist (…).
Auch wenn die lexikalische Verwandtschaft heute vielleicht etwas fragwürdig erscheint und sich nach neueren etymologischen Erkenntnissen auch nicht bestätigen lässt, gefällt mir die enge Beziehung von suchen, finden und wahrnehmen aus philosophischer und poetologischer Sicht sehr gut. Nicht nur ist es ermutigend, dass jeder Suche schon das Finden innewohnt. Ja, die Suche selbst ist der Fund, und das, was wir finden, ist am Ende das Suchen. Dieser Gedanke birgt eine existenzielle Tiefe, die gar keines etymologischen Beweises mehr bedarf.
Aus der existenziellen Tiefe der Nordsee heraus wird so manches an den Strand gespült, das zu suchen und zu finden sich lohnt. Trouver, das französische Wort für finden, kommt aus dem lateinischen tropa und bedeutete ursprünglich »ein Lied oder ein Gedicht finden«. Das Finden hat damit immer eine poetische Dimension. Die Vorstellung, dass Melodien und Verse irgendwo versunken herumliegen und nur darauf warten, in mehrfacher Hinsicht aufgehoben zu werden, ist tröstlich und aufregend zugleich.
Zwei der vier Dinge, die ich schon mein Leben lang leidenschaftlich aufhebe, gibt es auf Spiekeroog. Das, was es nicht gibt, sind runde, glatte Meerkiesel und Versteinerungen. Die beiden Dinge, die es gibt und die ich liebe, sind Muscheln und Bernstein.
Muscheln
Wellhornschneckenhäuserfinden ist eine zutiefst beglückende Erfahrung. Noch immer kann ich ein Jauchzen kaum unterdrücken, wenn ich von Weitem die ruhende weibliche Form dieser großen geschwungenen Schnecke zu erkennen glaube. Wellhornschneckenhäuser liegen selten am Flutsaum oder im weichen Sand, sondern vor allem auf den großen kahlen Flächen, die sich bei Ebbe aus dem Wasser heben. Ich freue mich aber auch über die kleineren Schnecken, vor allem Pelikanfüße, Netzreusen und Wendeltreppen mit ihrer auffälligen zweifarbigen Rippenstruktur.
Wellhornschnecken sind selten geworden. Inzwischen weiß ich, dass man ihre Häuser besser nicht mehr einsammelt und wegschleppt, doch ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich die Kraft hätte, eine leere Schneckenschale, die ich sommerüber gesammelt hätte, ins Meer zu werfen und zu fahren mit wehendem Haar, wie Ingeborg Bachmann es vorschlägt. Ich müsste mich dazu zwingen, mir vorzustellen, wie Heerscharen von Einsiedlerkrebsen ihre Scheren zum Jubel erheben, wenn ihnen unverhofft ein großes, mehrfach gewundenes Haus, das ich zurück ins Meer geworfen hätte, von oben entgegensänke. Und selbst dann fände ich es noch schwierig. Liegenlassen ginge auf keinen Fall, sonst würde sie jemand anderes mitnehmen, dem die Wohnungsnot der Einsiedlerkrebse weniger am Herzen läge als mir. Und dann hätte lieber ich sie.
Früher ging ich manchmal zu Nanu-Nana und kaufte mir eine dieser Südseeschnecken: einmal eine sehr große mit weißen Stacheln und einer rosa Öffnung, glatt und kühl wie chinesisches Porzellan. Ein andermal e...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Widmung
- Inhalt
- I. ÜBERFAHRT
- II. REIZKLIMA
- III. DER STRAND
- IV. DAS DORF
- V. DIE DÜNEN
- VI. DAS MEER
- VII. ÜBERRESTE
- VIII. DAS WATT
- IX. DAS KÖRPERGEDÄCHTNIS
- Literatur
- Danksagung
- Über das Buch
- Karte