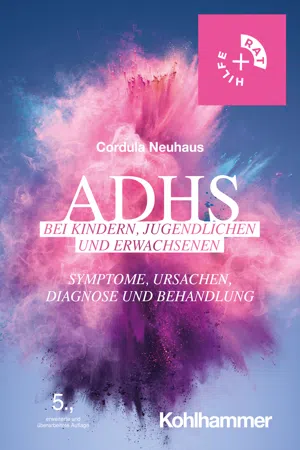![]()
1 Einleitung
ADHS – ein Spiegelbild heutiger Lebensbedingungen für Kinder?
Nach wie vor wird immer wieder von Kritikern und Skeptikern (mit und ohne spezifischen ideologischen Hintergrund) behauptet, dass unzulässigerweise der Einfachheit halber unterschiedliche Verhaltensstörungen unter der Diagnose ADHS zusammengefasst würden. Dabei seien die Auffälligkeiten wohl eher gesellschaftlich bedingt und ein Ausdruck von offensichtlich beeinträchtigten »Normalitätsvorstellungen«. Die Gesellschaft müsse sich eben ändern und schwierigen Kindern mehr Zeit und Zuwendung widmen. Das neurobiologische Erklärungsmodell des typischen »abweichenden« Verhaltens bei ADHS wird abgelehnt und die medikamentöse Behandlung als moralisch verwerflich verurteilt. Eine Journalistin fasst dies so zusammen:
»Eine minimale zerebrale Dysfunktion schränkt die Steuerungsfähigkeit des Gehirns ein, und fertig ist das Störungsbild – mit oder ohne Begleiterkrankungen, mit unterschiedlichen Ausprägungsgraden, die sich auf das Lernen, Verhalten und die Gestaltung zwischenmenschlicher Beziehungen auswirken, die den Generalverdacht entkräften sollen, dass es sich bei ADHS um eine Modediagnose, Wunschkrankheit oder auch einen listig aufgefädelten Schachzug der Pharmaindustrie, Ärzteschaft und Psychologenzunft handelt, über die Erfindung neuer Krankheiten Kundenbindung zu betreiben« (Psychologie Heute 12/05).
2005 und 2008 berichtete »Spiegel-TV« sehr seriös in ausführlichen Sendungen über Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit ADHS. Die ARD strahlte den Film »Keine Zeit für Träume« 2014 und 2016 wiederholt aus. Ab und zu gab es auch von anderen Sendern mal gute kurze Beiträge – dennoch ist der Tenor der Presseberichterstattung bis heute, ADHS sei eine »erfundene« Krankheit.
Angesichts der Tatsache, dass bereits im Oktober 2002 am Bundesministerium für Gesundheit in einer interdisziplinären Konsensus-Konferenz zur Verbesserung der Versorgung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) zwölf Eckpunkte formuliert wurden und im August 2005 die Kurzfassung der Stellungnahme der Bundesärztekammer (der Vorstand) zu ADHS veröffentlicht wurde (nachfolgend im November 2005 ein Fragen-Antworten-Katalog ebenda), wirkt eine solche Aussage doch verwunderlich.
Die Schilderungen der Symptomatik im Kindes- und Jugendalter sind seit »Urzeiten« dieselben:
Bereits 250 v. Chr. klagt eine Mutter in einer Ode von Herondas über einen Jungen, der ihr den letzten Nerv raubt, nicht richtig lesen kann, die Tafel mehr verkratzt, als schön darauf zu schreiben, keine Hausaufgaben macht, mühsam Gelerntes schnell wieder vergisst, überall herumturnt, ständig irgendwelchen Blödsinn macht und »falsche« Freunde hat!
Später erkannte man solche Kinder im Zappelphilipp von Heinrich Hoffmann (1844) oder im Michel von Lönneberga von Astrid Lindgren mit seinen vielen impulsiven und kreativen Ideen wieder.
Die motorische Unruhe galt bei der Störung, die man heute ADHS nennt, über viele Jahre bei jüngeren männlichen Kindern als Hauptsymptom. Man bezeichnete sie als zu lebhaft, zu nervös oder später als »hyperaktiv«.
1902 beschrieb der englische Kinderarzt George Still nach systematischen Beobachtungen ergänzend eine abnorme Unfähigkeit, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Er beobachtete auch, dass diese Kinder immer eine extreme emotionale Reizbarkeit zeigen sowie sofortige Befriedigung der eigenen Bedürfnisse brauchen. Nach seiner, von der damaligen sozialdarwinistischen Weltanschauung geprägten, Meinung litten diese Kinder an einem »Defekt der moralischen Kontrolle«. Er beobachtete diese Symptome ausschließlich bei Kindern, bei denen man nicht die Erziehung dafür verantwortlich machen konnte, weil sie aus »gutem Hause« stammten.
Verwirrende Begrifflichkeit im Laufe der Zeit
Solche Kinder wurden bereits im 18. und 19. Jahrhundert beschrieben. Es wurde gerätselt, ob sie unter einer gestörten Reaktion des Gehirns auf einwirkende Reize litten oder nur schwer erziehbar seien. Später nannte man sie oft neurotisch.
Es wurde überlegt, ob eine minimale Hirnschädigung vorliege, woraus sich dann der Begriff der minimalen zerebralen Dysfunktion entwickelte. Damit wurden in den 1950er- und 1960er-Jahren durchschnittlich begabte bis hochintelligente Kinder mit Lern- und Verhaltensstörungen beschrieben, bei denen in unterschiedlicher Ausprägungsform und Kombination Beeinträchtigungen der Wahrnehmung, des Gedächtnisses, zum Teil der Sprache, der Kontrolle von Aufmerksamkeit, Impulsivität und der Motorik beobachtet werden konnten.
Später wurde daraus ein frühkindlich exogenes Psychosyndrom. In der Schweiz gibt es heute noch die Bezeichnung POS (psychoorganisches Syndrom).
Um das auffällige Verhalten der Kinder vor allem auch bezüglich einer Veränderung unter Behandlungsbedingungen standardisiert bewerten zu können, wurden Ende der 1960er-Jahre spezielle Fragebögen entwickelt und das Konzept der Hyperaktivität in der Literatur beschrieben.
Hauptsymptom motorische Unruhe?
Ab den 1970er-Jahren wurde jedoch zunehmend in der inzwischen riesigen und immer interessanter werdenden internationalen Forschungsszene erkannt und belegt, dass bei der Störung, die aktuell als Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung bezeichnet wird, die motorische Unruhe nur ein Aspekt ist. Sie verliert sich meist zu Beginn oder gegen Ende der Pubertät.
Gravierender erscheinen die Defizite, die Aufmerksamkeit willentlich und situationsgerecht sofort aktivieren und aufrechterhalten zu können sowie impulsive Reaktionen kontrollieren zu können. Genau diese Defizite wurden vor allem in den letzten 15 Jahren wissenschaftlich differenziert untersucht.
In den 1980er-Jahren wurden als Ursache der ADHS-Symptomatik vor allem Allergien, speziell auf Zusatzstoffe in Nahrungsmitteln wie z. B. Salizylat oder Phosphat, aber auch Farbstoffe und Konservierungsmittel diskutiert. Aber weder dies noch der Verdacht auf die verminderte Zufuhr essenzieller Nahrungsbestandteile, wie z. B. ein Vitamin- oder Mineralstoffmangel, oder eine gestörte Darmflora konnten als Ursache der ADHS wissenschaftlich bewiesen werden. Allerdings hält sich das Thema Ernährung bis heute, da bei einzelnen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen z. B. durch spezifische Auslassdiäten, Sanierung des Darms bei Pilzbefall oder auch durch Gabe von bestimmten Vitaminen und Mineralstoffen Verhaltensverbesserungen zumindest vorübergehend beobachtbar wurden.
Anhand der Ergebnisse erster Forschungen liegt die Vermutung nahe, dass bio-psycho-soziale Faktoren für das Entstehen von ADHS verantwortlich sein könnten.
Ab den 1990er-Jahren wurde eine neurobiologische Abweichung im Belohnungs- und Motivationssystem im Gehirn sowie die eingeschränkte Entwicklung der Stirnhirnfunktionen als zusätzlich zentral bedeutend angenommen. Volumenunterschiede wurden entdeckt, die genetische Verursachung als sehr wahrscheinlich vermutet (inzwischen immer besser belegt).
Auf dem 5. Weltkongress über ADHS in Glasgow 2015 wurde umfassend vom Stand der seriösen internationalen Forschung bezüglich der Ätiologie psychischer Störungen und speziell der ADHS berichtet, mit immer mehr Belegen für die Erblichkeit. (So wurde 2013 in der renommierten Zeitschrift Lancet von einer »Cross Disorder Genome – Wide Association Study Analysis« berichtet, nach der ADHS, die Autismus-Spektrum-Störung, Schizophrenie, manisch-depressive Erkrankung und emotionale Instabilität als genetisch bedingt gelten.) Es ist noch längst nicht alles entschlüsselt, aber die »Anlage« bestimmt Verhalten weit mehr als das Umfeld, wobei die Interaktion zwischen der ererbten Disposition und den Umfeldfaktoren über Gesundheit/Krankheit bestimmt.
Die konstitutionell bedingte Neurodynamik bei ADHS führt zu einer spezifischen Regulierungsdynamik mit unmittelbaren Auswirkungen auf die »Funktionssteuerung« und somit zu einem Wahrnehmungs- und Reaktionsstil, der Betroffene von Gleichaltrigen unterscheidet.
Mit Hilfe der bildgebenden Verfahren wird es möglich, immer besser die Pathophysiologie der ADHS zu verstehen. Obwohl jedes Gehirn einzigartig, plastisch, dynamisch und komplex ist, ist bei ADHS mittlerweile klar, dass es strukturelle und funktionale Reifungsverzögerungen gibt, die Hirnrinde »dünner« ist, das Hirnvolumen geringer (was aber keinesfalls Rückschlüsse auf die Intelligenz erlaubt!).
Als gesichert gilt, dass bei Betroffenen mit ADHS eine signifikant größere intraindividuelle Variabilität bezüglich der Leistung besteht im Vergleich zu Nichtbetroffenen.
So besteht bei ADHS eben nicht nur eine Aufmerksamkeitsstörung durch Ablenkbarkeit (bei Reizoffenheit und Reizfilterschwäche) und zu geringe Ausdauer, sondern auch eine kontextabhängige Vigilanz. Die »innere Wachheit«, die man benötigt, um aufmerksam sein zu können, ist je nach Kontext »da« oder nicht. Jeder Betroffene mit ADHS kennt es von sich, dass die Aufmerksamkeit nur bei subjektiv positiver emotionaler Vorbewertung einer Sache oder Person aktiviert ist. Dann ist sogar eine extreme Konzentrationsfähigkeit möglich, mit Superausdauer und entsprechender Leistung.
Immer klarer wird mittlerweile, warum Betroffene mit ADHS alles Ungewöhnliche registrieren – ihre Retinazellen (die Zellen der Netzhaut des Auges) scheinen aktiver zu sein (»Das Rauschen hinter dem Auge«, Universität Freiburg 2015). Leider bringt das aber offensichtlich mit sich, dass Dinge mit wenig Aufforderungscharakter oft schlicht übersehen werden (Müllbeutel, Wäschestapel, abgelegte Kleidungsstücke).
Angesichts einer schwierigen oder subjektiv langweilig empfundenen Aufgabenstellung setzt schlagartiges »Ermüden« ein, bei unangenehmer Interaktion mit einem Gegenüber »Blockade« (mit Unfähigkeit, auf Strategien und/oder [Erfahrungs-]Wissen zugreifen zu können).
Anhand mittlerweile riesiger Datenmengen wurde aktuell belegt, dass die Amygdala (der Mandelkern), das Belohnungs- und Motivationssystem (Nucleus accumbens), der Altspeicherkoordinator Hippocampus und das Kleinhirn jene Regionen des Gehirns sind, die bei ADHS diese spezielle Art bestimmen, wie die Welt gesehen und auf sie reagiert werden kann.
Literaturempfehlung:
• Thomas E. Brown schildert gut verständlich geschrieben auf der Basis der sich ständig weiterentwickelnden Erkenntnisse der aktuellen wissenschaftlichen Forschung ADHS als Entwicklungsstörung der »Aufmerksamkeitsfunktionen«, die die kognitive Selbststeuerung beeinträchtigen: Thomas E. Brown (2013) »Heritability and Genetics of ADHD« in: »A New Understanding of ADHD in Children And Adults – Executive Function Impairments«, S. 72–76, New York, Routledge.
Hypothesen und Theorien
Verhaltensforscher überlegten lange, ob nicht eben doch mangelnde Einübung von Regeln in der Erziehung oder zu wenig Gleichmäßigkeit im Alltag die Ursache für die typischen Verhaltensmuster bei ADHS sein könnten.
Inzwischen behaupten manche »Kritiker«, dass alles, was ein Mensch tue, für ihn Sinn mache, da er es sonst nicht täte – unter der orthodox-psychoanalytischen Annahme, dass auffällige Kinder mit ADHS-Symptomen raffinierte Mechanismen entwickelten, um ihre »nicht verarbeiteten (negativen) Erfahrungen loszuwerden« – d. h. alle Schwierigkeiten sind, so die Grundannahme und -behauptung, reaktiv entstanden.
Einzelne (wohl eher populärwissenschaftliche?) Neurowissenschaftler versuchen nach wie vor, ihre Erkenntnisse über das Zusammenspiel von Anlage, Umwelt und dem sich entwickelnden Gehirn (speziell bezüglich dessen Plastizität) im Sinne der psychodynamischen Sicht entgegen die vielfältigen gut belegten Befunde der Genetik oder der Neuropsychologie zu ADHS zusammenzutragen.
Eine nicht unerhebliche Zahl psychoanalytisch denkender/handelnder Fachleute vermutet bis heute, dass Kinder »hyperaktiv« reagierten, weil sie entweder unbewusst schon vor der Geburt abgelehnt worden seien oder Bindungsstörungen zu ihrerseits traumatisierten, bindungsunsicheren Müttern entwickeln würden, welche selbst Schwierigkeiten mit der Stressregulation haben. Entsprechend erlebten diese Mütter beispielsweise ein schreiendes Baby vor allem als Stress und könnten nicht angemessen fürsorglich reagieren. Dies könnte schon den Boden für entstehende Gewalt gegenüber dem Kind bereiten. Verbunden damit ist die Forderung, das Kind möglichst schon früh im Leben psychoanalytisch zu behandeln.
Der Begriff Trauma wird derzeit leider sehr schnell benutzt. Dabei zeigen Beobachtungen und Untersuchungen, dass selbst bei katastrophalen Ereignissen (wie zum Beispiel die Zerstörung des World Trade Centers am 11.09.2001) etwa acht bis neun von zehn Personen damit zurechtkommen, ohne eine Störung zu entwickeln.
Viele Sozialmediziner, Sozialpädagogen, Sonderpädagogen hinterfragen einen »biologistisch inspirierten Normalitätsbegriff«, was bedeutet, dass sie sich dagegen wehren, dass Kinder mit chemischer Korrektur ihrer scheinbar unzureichenden Steuerungsmechanismen im Gehirn zu erwünschten »normalen« Verhaltensweisen gebracht werden sollen.
In der systemischen Theorie geht man davon aus, dass das Kind seine Realität und Umwelt selbst gestaltet und mit seinen Möglichkeiten des Verhaltens reagiert – mit der Einschätzung, dass das typische Verhalten eines Kindes mit ADHS Ausdruck einer sinnvollen Selbstor...