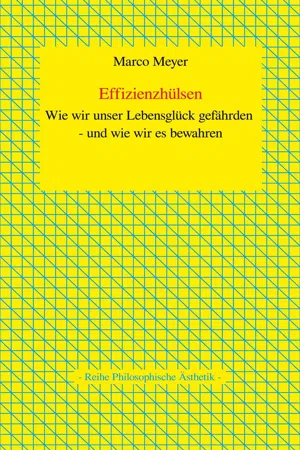![]() I MENSCHSEIN
I MENSCHSEIN![]()
Antike -
Menschsein und menschliches Glück
Ein Piniensamen, der sich vom Zapfen löst und vom Wind getragen an einem geeigneten Standort niedergeht, wird dort bei günstigen Entwicklungsbedingungen anfangen zu keimen. Je nach Jahreszeit und Umgebungsbeschaffenheit wird möglicherweise eine Samenruhe vorausgehen: der Lebenstrieb lässt den Samen selbst erkennen, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Erst wenn zum Beispiel das Frühjahr begonnen hat, mit länger anhaltendem Temperaturminimum, wird er den Keimungs- und Wachstumsprozess mit der Entwicklung zum Spross beginnen. Der Spross wird zur Pinie heranwachsen, die versuchen wird, sich gegen alle widrigen Witterungseinflüsse standhaft zu zeigen. Die mögliche Wachstumsverzögerung durch die Samenruhe, die pflanzlichen Anpassungsstrategien an die Umgebungsbedingungen: dies alles sind elementare Lebensfunktionen, und natürlich keine bewussten Entscheidungen für oder gegen das Wachstum zu einem bestimmten Zeitpunkt. – Auch der Drohn, die männliche Honigbiene, kann sein Handeln nicht in Frage stellen: genetisch programmiert, muss er nach seiner Geschlechtsreife ausschwärmen, um dann beim Hochzeitsflug mit einer Königin zunächst seinen Penis, und dann sein Leben zu verlieren. Genau so, wie das Eichhörnchen Nüsse als Futtervorrat vergraben muss, auch wenn es einen Teil davon nie wiederfinden wird. Es sind elementare Funktionen bzw. Instinkte, die die Pflanzen- und Tierwelt steuern: die Lebensprozesse sind beiden eine unhinterfragbare Selbstverständlichkeit.
Was den Menschen von allen anderen Lebewesen elementar unterscheidet, ist sein Können: und zwar nicht das Können im Sinne von Fähigkeiten, indem er etwa das Rad erfinden, Atome spalten, Computer programmieren oder musikalische Werke von betörender Schönheit erschaffen kann. Grundlegender ist das menschliche Können, nicht zu können, mit einem Wort: seine Freiheit, zu entscheiden. Die Freiheit wird somit zur zentralen Größe einer philosophischen Betrachtung der menschlichen Existenz, und es ist, wie wir sehen werden, ein folgenschweres Missverständnis unserer Zeit, dass menschliche Freiheit damit gleichbedeutend sei, einfach die eigenen Interessen in einem größtmöglichen Umfang zu verfolgen. Umwelt und Gesellschaft geben uns Rahmenbedingungen vor, und Beschränkungen, die sich aus diesem Rahmen ergeben, sind eben keine Freiheitsbeschränkungen, vielmehr sind sie gerade Teil dieser Freiheit, gleichsam Freiheitsbedingungen. - Wollten wir einen Piniensamen als frei bezeichnen, so bräuchte er dafür nur die Fähigkeit, sich bewusst für oder gegen das Keimen an dem Ort, an den der Wind ihn trug, zu entscheiden, und damit wäre seine Freiheit bereits hinreichend begründet; wir würden für seinen Freiheitsbegriff doch nicht auch noch verlangen, dass er mit Flügeln ausgestattet wäre und die Fähigkeit hätte, aus eigener Kraft an einen anderen Ort zu fliegen.
Wir erkennen damit die strukturell einfache Entscheidung zwischen Dafür und Dagegen, zwischen Ja und Nein, als grundlegende Struktur menschlicher Entscheidungen, auf die sich der gesamte Kosmos menschlicher Freiheit zurückführen lässt. (Interessanterweise hat der Mensch eine Computertechnologie erfunden, die unser Leben bereits bahnbrechend verändert hat, und unaufhaltbar noch weiter verändern wird, und die auf genau diesem binären System aus Ja und Nein, aus Eins und Null, aufbaut.) Unser Freiheitskosmos fußt also auf einem Könnenbewusstsein genauso wie auf einem Nichtkönnenbewusstsein: wir wissen um unsere Entscheidungsfreiheit im Handeln, wissen aber auch um deren Grenzen, die sich aus unserer physischen Konstitution, unseren mentalen Möglichkeiten und dem gesellschaftlichen Zusammenleben ergeben. Erst dass darüber hinaus jede Entscheidung für eine Alternative immer auch eine Entscheidung gegen unzählige andere Möglichkeiten ist, das macht das (philosophische) Nachdenken über menschliches Handeln zu einer so komplexen Angelegenheit, denn indem der Mensch kann, nicht muss, obliegt es seiner eigenen Entscheidung, ob er – um beim Beispiel des Baumsamens zu bleiben und im Gegensatz zu diesem – an einem bestimmten Ort gleichsam Wurzeln schlägt oder nicht. Und er wird diese Entscheidung abhängig machen (müssen) von zahlreichen anderen, die er zu treffen hat: mit welcher Art von Menschen möchte man sich umgeben, welchen Stellenwert sollen Karriere und Geld im Leben haben (was sich wiederum unmittelbar auf die Wohnmöglichkeiten auswirkt), möchte man Kinder, und wenn ja, sollen diese in einem konservativen oder progressiven Umfeld aufwachsen, möchte man „nur“ wohnen oder auch repräsentieren, etc. etc.
Damit ist der Rahmen für ein philosophisches Nachdenken darüber, was das Menschsein ausmacht, abgesteckt: es geht um die Frage nach einer Lebensführung, die Aspekte artspezifischer und individueller Dispositionen mit Fragestellungen gesellschaftlichen Zusammenlebens zusammenführt. Dies vor dem Hintergrund eines Können- und Nichtkönnenbewusstseins, das es dem Menschen ermöglicht, freie Entscheidungen zu treffen, oder besser, um es mit Sartre zu sagen: das den Menschen dazu verdammt, frei zu sein, denn es ist ihm eben nicht möglich, keine Entscheidungen hinsichtlich seiner Lebensführung zu treffen. Selbst ein völlig passives Vor-Sich-Hin-Leben wäre gleichbedeutend mit einer unablässigen Folge von Entscheidungen gegen die aktive Gestaltung des eigenen Lebens.
Im fünften und vierten vorchristlichen Jahrhundert setzt sich im griechischen Einflussbereich ein Denken durch, dass die Frage nach wahrem Wissen, aber auch die Frage nach Sinn und Werten und damit nach der richtigen Lebensführung in den Mittelpunkt stellt. Es ist Sokrates, geboren 469 v. Chr. in Athen, der durch konsequentes kritisches Hinterfragen allgemeingültiger Ansichten die Ablösung der Vorherrschaft sophistischen Denkens durch eine wahrheitssuchende Philosophie einleitet.
Die Sophisten hatten den Menschen in den Mittelpunkt einer Philosophie gerückt, die sich bis dahin eher theoretisch-mystischen Themen gewidmet hatte. Das sophistische Interesse hingegen galt vor allem der menschlichen Tüchtigkeit im Sinne einer erfolgreichen Teilnahme am gesellschaftlichen Leben. So galt ihnen die Redekunst als wichtigste Fähigkeit des Menschen, denn durch sie sei es möglich, Andere zu überzeugen und sich somit in der politischen oder Gerichtsrede erfolgreich durchzusetzen. Der Rhetoriklehrer Gorgias von Leontinoi verglich die Redekunst mit einem Gift, das sowohl verzaubern als auch töten könne, und Sokrates gerät mit dem Gorgias in eine Diskussion um die Frage, ob die Redekunst tatsächlich ein für den Menschen in so hohem Maße wertvolles Können sei. Dieser „Gorgias“ betitelte Dialog des Sokrates wurde von dessen Schüler Platon niedergeschrieben. Sokrates selbst hat überhaupt keine schriftlichen Aufzeichnungen hinterlassen, und insofern mag „Gorgias“ gleich sämtlichen platonischen Dialogen, die Gespräche des Sokrates wiedergeben, ebensoviel platonisches wie sokratisches Denken beinhalten. In jedem Fall führt uns der „Gorgias“ zu wichtigen Erkenntnissen über die Ansichten bezüglich des Menschseins in der antiken Philosophie. Denn die Diskussion zwischen Sokrates und dem Rhetoriker Gorgias sowie dessen Schülern Polos und Kallikles, dreht sich nur vordergründig um die Frage nach dem Stellenwert der Redekunst. Dahinter steht vielmehr die Frage nach der richtigen Lebensführung: welche Entscheidungen sollten wir treffen vor dem Hintergrund persönlicher und gattungsspezifischer Möglichkeiten und Beschränkungen, kurz: es geht um die rationale Beurteilung von möglichen Zielen und Verhaltensweisen, in letzter Konsequenz: um die höchsten Ziele, die wir in unserem Leben verfolgen, oder, um es mit Platon zu sagen: um die Frage nach dem „Worumwillen“ allen menschlichen Handelns.
Die Begründungen der antiken Rhetoriker für den hohen Stellenwert der Redekunst verliefen entlang einer Argumentationslinie, die Parallelen zur heutigen gesellschaftspolitischen Trennungslinie zwischen ökonomischem Liberalismus und eher ordnungspolitisch orientierten Ökonomiemodellen aufweist: die Redekunst diene der Überzeugung Anderer, und wer Andere überzeugt, kann seine Ziele durchsetzen, einen möglichst großen Anteil an zu verteilenden materiellen Werten für sich gewinnen, seinen Machtbereich ausweiten. Dabei sahen sich die Rhetoriker durch die vorherrschende Meinung im Volke bestätigt, dass es im Zweifel besser ist, mehr zu besitzen, als ein übertrieben rechtschaffenes Leben zu führen; wer daher auf die Einhaltung von Gesetzen poche, die für einen gerechten Ausgleich zwischen Starken und Schwachen sorgen sollen, der tue dies vor allem aus eigener Schwäche und also um zu verhindern, von den Stärkeren übervorteilt zu werden.
Wir erkennen in dieser Argumentationslinie ganz direkt eine Einstellung wieder, die sich heute in der neoliberalen Erzählung von den „Leistungsträgern“ durchsetzt: wer deutlich mehr leiste, der müsse auch deutlich mehr bekommen, dürfe also nicht übermäßig durch Steuern und Abgaben belastet werden. - Dass eine solche Argumentation in direkter Tradition sophistischer Scheinargumente steht, wird spätestens deutlich, wenn ihr noch der Anschein der Gemeinnützigkeit gegeben wird, indem man hinzufügt, der Leistungsträger tue ja Gutes für die Gesellschaft, indem er etwa Arbeitsplätze schaffe; dieses Argument aber führt die Argumentation ad absurdum: denn wenn der Gemeinnutzen (zum Beispiel Arbeitsplatzschaffung) implizit als das Gute definiert wird, kann zugleich eigentlich nicht mehr begründet werden, wieso denn gerade die Maximierung des persönlichen Nutzens, des Angenehmen, als erstrebens- und schützenswert verteidigt wird, und das eigentlich erstrebenswerte gemeinnützige Gute nur gleichsam als Nebenprodukt abfallen solle.
Diese Unterscheidung zwischen dem Guten und dem Angenehmen oder Lustvollen, zwischen Gemeinwohl und persönlichem Nutzen, wurde schon von den antiken Sophisten rhetorisch nivelliert. - Sokrates baut seine Argumentation dagegen auf dieser Unterscheidung auf, und er stellt in Zweifel, dass es richtig sei, einfach nur immer mehr und das Meiste für sich selbst zu wollen. Mit anderen Worten: da das Gute und das Angenehme nicht identisch sind, stellt sich die Frage, ob sich menschliches Glück in einer Lebensführung einstellt, die das Angenehme anstrebt, oder in einer, die sich am Guten orientiert. - Wir sind also wieder bei der Frage nach dem Worumwillen, dem letzten Zweck, dem eigentlichen Grund unseres Handelns. Sokrates‘ Antwort fällt eindeutig aus, zugunsten des Guten: der Arzt etwa müsse seinem Patienten im Zweifel von unbeschränktem leiblichen Genuss abraten, um den Körper gesund zu erhalten; eine Heildiät ist zwar nicht lustvoll, aber sie ist letztlich dazu gut, den Körper gesund zu erhalten.
Dasselbe, so sagt uns Sokrates, müsse gelten im ethischen Verhalten, im gesellschaftlichen Umgang. Was die Gesundheit für den Körper, das sind Recht und Gesetz für die Seele, denn letztlich wird der Mensch nur in Gesellschaft gedeihen. Eine Gemeinschaft, oder gar eine Freundschaft, sind also unter Menschen, die in egoistischer Maßlosigkeit Gesetze und Regeln übertreten und vor allem auf den eigenen Vorteil fixiert sind, unmöglich. Dabei muss betont werden, dass Platon implizit von gerechten Gesetzen ausging. Wir müssen also ergänzen: Freundschaft und Gemeinschaft sind auch dort nicht möglich, wo Interessengruppen die Gesetzgebung mit egoistischer Zielsetzung beeinflussen. - So implizieren die antiken Tugendethiken8 immer auch politisch-gesellschaftliche Fragen.
In der sokratisch-platonischen Argumentation wird die Differenz zwischen dem Angenehmen und dem Gutem zwar betont, beides gerät aber nicht in Widerspruch zueinander. Auf Verzicht und auf Ausgleich bedachtes Verhalten beschränkt die eigene Lustmaximierung, sichert aber langfristig das eigene politische Überleben und ermöglicht erst Freundschaft und eine funktionierende Gesellschaft. Wir sollten diesen im besten Sinne ganzheitlichen Denkansatz nicht vergessen, wenn wir uns später mit der Gegenwart beschäftigen, in der inzwischen jede auf gesellschaftlichen Ausgleich bedachte Regelung als Zumutung, weil dem Gewinnstreben des Einzelnen behindernde Beschränkung, diskreditiert wird.
Dabei ist zu betonen, dass dieser ganzheitliche antike Ansatz kein im neuzeitlichen Sinne sozialistisches, gesellschaftliche Unterschiede negierendes Gedankengut war. Was die Griechen anstrebten war nicht gesellschaftliche Gleichheit. Ganz im Gegenteil: weit von gleichen Rechten für Alle entfernt, war zum Beispiel die Wirkungsstätte der Frauen auf das familiäre Heim beschränkt, von den Rechten der als Besitz gehaltenen Sklaven ganz zu schweigen. Um so relevanter erschien es Sokrates und Platon, der Wirkungsmacht der „freien Männer“ ethische Selbstbeschränkung aufzuerlegen. Letztlich betonten sie die, wie wir heute sagen würden, „Vorbildfunktion der Elite“: Politiker müssten in erster Linie ethische Verantwortung für die Entwicklung der Gesellschaft übernehmen, und dürften erst in zweiter Linie an ihre persönlichen Vorteile denken. (Auch heute erscheint es ja, vorsichtig formuliert, fraglich, ob diese Priorität immer gegeben ist.)
Vor dem Hintergrund dieses Zielkonflikts ließ Platon den Sokrates im „Gorgias“ sagen:
Sollen wir also versuchen, auf diese Weise den Staat und die Bürger zu behandeln, um sie soviel als möglich besser zu machen? Denn ohne dies […] ist es zunichts nütze, ihnen irgendeine andere Wohltat zu erweisen, wenn nicht die Seele derer gut und schön ist, welche entweder zu großem Besitz, oder zur Herrschaft über andere, oder sonst irgendeiner Macht gelangen sollen.9
Hier wurde also nichts weniger gefordert, als die ethisch-moralische Bildung zur grundlegenden Voraussetzung für einen verantwortungsvollen Staats- oder Geschäftsmann zu machen. Doch was bedeutete diese Forderung ganz konkret aus der Sicht des „freien Mannes“? Wie wirkte sie sich auf die Lebenspraxis in einer Gesellschaft aus für den, der ein freies Leben führen wollte?
An dieser Stelle müssen wir in bestem philosophischen Sinne analytisch werden, dass heißt wir wollen uns genau über die verwendeten Begrifflichkeiten und ihre Bedeutung klar werden. - Wir hatten schon festgestellt, dass die (Entscheidungs-) Freiheit Grundlage jeder ethischen Überlegung ist. Sodann hatten wir mit Platon das Gute von dem bloß Angenehmen, Nützlichen oder Lustvollen gedanklich unterschieden. Wir haben es also genau genommen mit zwei Untersuchungsgrößen und zwei damit verbundenen Fragestellungen zu tun: Die erste Frage ist die nach der Beschaffenheit des Guten, nach dem wir streben, nach dem Worumwillen all unseren Handelns. Und zweitens ist zu fragen, wann ein Handeln wirklich frei ist, wie also menschliche Freiheit definiert werden kann.
Wir wollen diesen Fragen nachgehen und dabei neben Platon auch Aristoteles zu Rate ziehen, der als Schüler Platons, und an dessen Lehre anknüpfend, ein äußerst genaues, wissenschaftlich systematisiertes philosophisches System hinterlassen hat.
Worumwillen
Das Gute, um dessentwillen Jede und Jeder letztendlich handelt, kann nicht einfach nur das persönlich Angenehme oder Nützliche sein. So hatten wir oben mit Platon festgestellt: für den Körper mag Diät besser sein als Völlerei; Selbstbeschränkung, Gemeinsinn, Freundschaft und Gemeinschaft für die Seele besser als Egoismus. Doch was ist, abseits dieser Beispiele, allgemein gesprochen das höchste Gut, um dessen willen der Mensch handelt? - Für Aristoteles ist klar, dass das höchste Gut dasjenige sein muss, das reiner Selbstzweck ist: nur wenn wir das angestrebte Gefühl, den herbeigesehnten Zustand um seiner selbst Willen wollen, und nicht letztlich nur als Mittel für einen eigentlich anderen, höheren Zweck, wie etwa ein angenehmes Aussehen, um ...