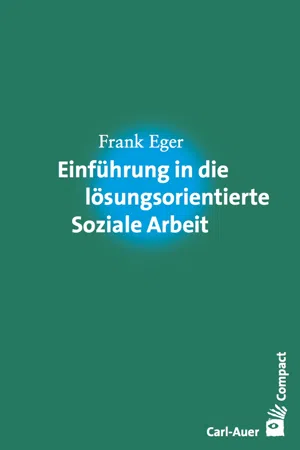![]()
1 Einleitung
Lösungsorientierung erhält, ausgehend von systemischen Grundlagen der Beratung und Begleitung, bei unterschiedlichen Trägern Sozialer Arbeit zunehmend Relevanz. Davon zeugen die entsprechenden Positionierungen in Konzeptionen von Einrichtungen und Diensten. Unterstützung erhalten diese Träger Sozialer Arbeit von Vertretern des systemischen Paradigmas der Beratung, z. B. von Paul Watzlawick. Er bezweifelte, dass Probleme eher dadurch gelöst werden, dass man sich intensiv mit ihnen beschäftigt. Insbesondere die lösungsorientiert-systemische Linie verweist in diesem Zusammenhang auf die Gefahr einer Problemtrance und praktiziert stattdessen die Auseinandersetzung mit Zielen und Ressourcen in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.
Demgegenüber bestimmt Soziale Arbeit in einigen ihrer Theorien und Konzepte (Engelke 2004; Lambers 2013) personale und soziale Probleme als Gegenstand ihrer Disziplin und Profession. Soziale Arbeit wird infolgedessen tätig, sobald auf der Grundlage einer intensiven Problemanalyse Hilfebedarf aufgezeigt wird.
Lösungsorientierte Soziale Arbeit zeichnet sich durch das Bekenntnis aus, personalen und sozialen Systemen auf der Basis ihrer Anliegen und unter Würdigung ihrer Strategien zu helfen, ohne sie zu pathologisieren. Damit knüpft lösungsorientierte Soziale Arbeit in einer ihrer zentralen Aussagen an das »Milwaukee-Axiom« des lösungsorientierten Beratungsansatzes an (Bamberger 2010, S. 11), dem zufolge Lösungen erreicht werden, indem die Konzentration von Anfang an auf Ressourcen und Ziele gerichtet ist.
Lösungsorientierte Soziale Arbeit bedeutet mehr als eine partielle Anwendung von Instrumenten. Sie erfordert eine konstituierende Ausrichtung auf Ressourcen und Ziele. Denn lösungsorientierte Soziale Arbeit wird von der Überzeugung getragen, dass Entwicklungsaufgaben sowohl personaler als auch sozialer Systeme mit der entsprechenden Fokussierung als Herausforderung betrachtet werden können. Ressourcen werden bei lösungsorientierter Sozialer Arbeit prinzipiell als vorhanden vorausgesetzt, und im sozialarbeiterischen Handeln wird eine Erwartung darauf aufbauender Veränderung geschaffen.
Nach vorliegendem Verständnis wird lösungsorientierte Soziale Arbeit infolge der personalen und sozialen Entwicklungstatsache tätig, wonach personale und soziale Systeme in ihrer Entwicklung laufend mit Aufgaben konfrontiert werden. Im Kern widmet sich Soziale Arbeit dabei Inklusions- und Exklusionsthemen. Die Funktion Sozialer Arbeit liegt nun darin, personale und soziale Systeme in Anbetracht ihrer Entwicklungsaufgaben ressourcen- und zielfokussiert anzuregen.
Diese Perspektive birgt ein außerordentliches Potenzial für eine Veränderung Sozialer Arbeit hinsichtlich ihrer basistheoretischen Grundlegung, ihres Gegenstandes, ihrer gesellschaftlichen Funktionsbestimmung sowie ihrer relevanten Handlungsmuster.
In den folgenden Kapiteln sollen Implikationen, wie sie sich mit einer lösungsorientierten Perspektive auf Soziale Arbeit ergeben, einführend behandelt werden. Dabei werden Grundzüge aus Eger (2015b) weitergeführt und vertieft.
![]()
2 Personen und soziale Systeme in Regeltrance
2.1 Ziele, Ressourcen – Lösungen
Mit dem Merkmal der Lösungsorientierung setzt sich Soziale Arbeit in einen Gegensatz zu all denjenigen Verfahren, die davon ausgehen, dass eine Veränderung in Richtung gewünschter Ziele stets eine Problemanalyse erfordert.
Lösungsorientierung in der Sozialen Arbeit bedeutet, die vorgetragenen Probleme, Konflikte, Störungen usw. nicht vertiefend zu explorieren, sondern möglichst rasch auf die vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen zu fokussieren und alle Möglichkeiten ihrer aktiven Nutzung auszuschöpfen, damit man möglichst direkt zu einer Lösungsperspektive gelangt.
Die Frage nach dem Warum wird bei der Lösungsorientierung nicht gestellt. Sie wird ersetzt durch die Frage: »Was ist statt des Problems da?« Dabei muss auch lösungsorientierte Soziale Arbeit anerkennen, dass die Formulierung eines Problems explizit oder implizit nur in Anbetracht von Alternativen vorgenommen werden kann (und umgekehrt). Kurt Ludewig (2000, S. 9) führt dazu treffend aus:
»Die Klientin leidet nicht nur unter einem Problem, sondern sie kennt auch alternative Zustände ohne dieses Problem. Sonst gäbe es in ihrem kognitiven Bereich das Problem nicht. Dabei dürfte die Kehrseite des Problems kein bloßes Nichtproblem und kein beliebiger Zustand sein, sondern eine Klasse von Zuständen beinhalten, die im pragmatischen Sinne alternativ zum Problem sind. Von dieser Komplementarität von Problem und Alternativen leben die lösungsorientierten Ansätze. Sie bauen bekanntlich darauf auf, dass die Aktivierung von derzeit ungenutzten Alternativen die Klientin in einen mit dem Problem inkompatiblen Zustand versetzen kann.«
Das Konzept der Lösungsorientierung stützt sich auf drei Merkmale, die eine Abwesenheit von Problemorientierung signalisieren und nachfolgend näher betrachtet werden sollen: Ziele, Ressourcen und Lösung.
Ziele
Ziele umfassen eine inhaltliche Orientierung, die in der lösungsorientierten Sozialen Arbeit als Reaktion auf die Beschreibung des Anliegens definiert wird. Ziele sollten in der lösungsorientierten Sozialen Arbeit als Fähigkeiten, Kompetenzen und sonstige erwünschte Gegebenheiten formuliert werden und nicht einfach als Abwesenheit von Problemen. Sozialarbeiter werden mit einem doppelten bis dreifachen Mandat in der Sozialen Arbeit tätig. Insofern arbeiten sie oftmals mit mehreren, teils konkurrierenden Zielen. Lösungsorientierte Soziale Arbeit hebt sich somit von de Shazers Konzept der »solution-focused therapy« ab, das »sich ganz an den Zielen des Klienten orientiert« (vgl. Sparrer 2006, S. 28). Die Zielformulierung in der lösungsorientierten Sozialen Arbeit bedeutet oft ein Aushandeln unterschiedlicher Ziele auf den unterschiedlichen Systemebenen und beinhaltet z. B. neben personalen und organisationalen auch gesellschaftliche (z. B. Gerechtigkeits-)Ziele. Ziele repräsentieren in hohem Maße den emanzipatorischen Anteil lösungsorientierter Sozialer Arbeit. Denn Veränderungen auf den unterschiedlichen Systemebenen werden erreicht, indem mithilfe von Ressourcen auf Ziele Bezug genommen wird.
In ihrer Zielpräferierung erhält Lösungsorientierung seit einiger Zeit Unterstützung von dem in den USA entwickelten und dort in Sozialer Arbeit erprobten »task-centered approach« (Naleppa a. Reid 2003).
Ressourcen
Als personale, soziale und materielle Ressourcen (vgl. Möbius u. Friedrich 2010, S. 15) werden diejenigen Mittel betrachtet, die zur Bewältigung von Entwicklungsaufgaben personaler und sozialer Systeme wesentlich beitragen. Dabei orientieren wir uns an dem Modell der Unabhängigkeit von Problem und Ressource (Willutzki 2003). Demnach verfügen selbst Personen und soziale Systeme (Gruppen, Organisationen, Gesellschaft) mit ausgeprägten Beeinträchtigungen über Ressourcen, die einen stabilisierenden Einfluss ausüben (können). Das hier vertretene Modell geht über die Idee des Kontinuums von Antonovski (1997) hinaus, dem zufolge Ressourcen und Vulnerabilitäten in einem Mischverhältnis bestehen. Entlang einer multimodalen Ressourcendiagnostik lassen sich Ressourcen personaler (Klemenz 2003) und sozialer Systeme unabhängig von Defiziten bestimmen und direkt nutzbar machen. Neben dem Bezug auf Personenressourcen ist insbesondere die Identifizierung und Nutzbarmachung sozialer Ressourcen auf der Ebene von Gruppen, Organisationen und gesellschaftlichen (Teil-)Systemen eine der zentralen Aufgaben lösungsorientierter Sozialer Arbeit. Damit steht sie im Gegensatz zu einer »klientifizierenden« und defizitfixierten Sichtweise.
Das hier vorgetragene Ressourcenverständnis ist mit der Zielorientierung gekoppelt und markiert als ressourcen- und zielorientierte Haltung die nachfolgend beschriebene Lösungsorientierung.
Lösung
Der Begriff »Lösung« enthält keine exakte inhaltliche Beschreibung (wie dies bei Zielen der Fall ist), sondern bezieht sich hauptsächlich auf die Haltung bzw. die Operation, die eine Abwesenheit vom Problem ermöglicht. Es wird ein neuer Kontext erzeugt, der es personalen und sozialen Systemen erlaubt, auf Ressourcen und Ziele zu fokussieren. Infolge dieser Umfokussierung »lösen« sich erlebte Starre, Ohnmacht usw.
Eine Formulierung von Ludewig (2000, S. 36) verdeutlicht den aktiven, operativen Anteil des Lösungsbegriffs: Ein Problem sei dann verschwunden,
»wenn dessen Wiederholungsstruktur auf dem Wege der Aktivierung von Ressourcen destabilisiert und durch Umfokussierung auf Alternativen abgelöst«
wäre. Dieser Blickwechsel ermöglicht die Formulierung eines allgemeinen Lösungsbildes, von dem aus exakte Ziele definiert werden können. Der Autor teilt die Einschätzung Ludewigs, dass der Lösungsbegriff semantische Schwächen impliziert (vgl. ebd.), da er oft so verwendet wird, als gäbe es bezüglich eines Problems eine (inhaltliche) Lösung. Diese Betrachtung mag für Mathematik und Naturwissenschaften angemessen sein. Im Hinblick auf personale und soziale Systeme ist es jedoch eher angezeigt, von der Lösung als einem Modus personaler und sozialer Systeme auszugehen, der eine Fokussierung auf Ziele und Ressourcen induziert. Damit übersteigt der Lösungsbegriff bloße technologische Handlungsweisen (z. B. die Konstruktion der Frage nach Ausnahmen) und impliziert insbesondere eine Haltung. Das Konzept lösungsorientierter Sozialer Arbeit hält an dem Begriff der Lösungsorientiertheit fest, um damit für Sozialarbeiter eine Option zum Ausdruck zu bringen, die vom unmäßigen Analysieren der Problemkonstruktionen personaler und sozialer Systeme umleitet und stattdessen Aufmerksamkeit auf Ressourcen und Ziele richtet.
Exkurs: Warum erscheint es selbstverständlich, dass ein Problem analysiert und verstanden sein muss, damit es gelöst werden kann?
Die Idee, dass ein Problem analysiert und verstanden sein muss, damit es gelöst werden kann, wird in unterschiedlichen kulturellen und wissenschaftlichen Zusammenhängen, mehr oder weniger prominent, vertreten. Insofern kann von kommunikativen Mustern gesprochen werden, die einen problemorientierten Anschluss in der Kommunikation nahelegen. Die nachfolgenden Beispiele solcher Muster können und sollen sicherlich keinen Wissenschaftsbereich stellvertretend abbilden; allerdings mögen die Beispiele den Leser animieren, selbst auf Erkundung zu gehen, um kulturelle Muster der Orientierung entlang von Problem- bzw. Lösungsorientierung in der Gesellschaft zu identifizieren.
Der Kirchenlehrer Augustinus (354–430) hat die Lehre von der Erbsünde entwickelt. »Erbsünde« als theologischer Begriff wurde aus dem Sündenfall von Adam und Eva, die vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, als Unheilszustand abgeleitet. Augustinus ging davon aus, dass infolge dieses Sündenfalls kein Mensch ohne Sünde geboren wird, dass alle Menschen den Zustand der Sünde gleichsam geerbt haben. Psalm 51,7 und Römer 5,12 werden als Belege für die Lehre von der Erbsünde angeführt. Insbesondere im Zuge der europäischen Aufklärung entstanden zur Erbsündelehre Gegenkonzepte, wie sie beispielsweise von Rousseau vertreten wurden, der gesellschaftliche Einflüsse und speziell Erziehung als maßgeblich für den an sich guten Menschen betrachtete. Heute distanziert sich auch die katholische Dogmatik (vgl. Schneider 2000, S. 95 f.) von einem Erbsündebegriff, wie Augustinus ihn verwandt hat.
Die Idee, dass Probleme verstanden sein müssen, damit sie gelöst werden können, wurde nicht zuletzt mit der Entstehung moderner Mathematik und Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert angelegt. Bei der Entfaltung dieser Idee kommt der rationalen Mechanik seit Newton eine besondere Rolle zu. Ihr gemäß können Probleme entziffert, als mathematische Aufgaben formuliert, und anschließend gelöst werden. Das Festhalten an der Idee des Analysierens von Problemen resultiert somit aus einem wissenschaftlichen Denken, das noch immer an einem Modell der rationalen (deterministischen) Mechanik orientiert ist.
Es wird jedoch bereits in der Mathematik selbst deutlich, dass die tatsächliche Lösbarkeit von Gleichungen äußerst limitiert ist. Die rationale Mechanik stößt im eigenen Einsatzgebiet an Grenzen, die mit der Komplexität der betrachteten Systeme zu tun haben. Selbst wenn fundamentale Gesetze und Strukturen bekannt und damit mathematisch formulierbar sind, gelingt ab einer bestimmten Komplexitätsbarriere weder eine mathematische (theoretische) noch rechnerische (praktische) Lösbarkeit (vgl. Lenhard 2015).
Solche Probleme entlang der Komplexitätsbarriere können jedoch auf eine pragmatische Weise gelöst werden, ohne dass sie (im Sinne der rationalen Mechanik) verstanden und analysiert werden müssten. Ein Beispiel für ein alternatives Verfahren ist der sogenannte Sintflutalgorithmus (Dueck 2006), der in Optimierungsaufgaben angewendet wird, die infolge ihrer hohen Komplexität sowohl das vollständige Ausprobieren aller Möglichkeiten als auch einfache mathematische Verfahren ausschließen.
Am Beispiel des SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) lässt sich für den Bereich der Rechtswissenschaften zeigen, dass bei Zielbestimmungen (etwa § 1 SGB VIII), nicht jedoch bei Individualleistungen (beispielsweise den Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff.) lösungsorientierte Denkweisen akzeptiert sind.
Rein technisch werden bei Leistungsansprüchen stets »konditionale« Auslösekriterien für das staatliche Entscheiden benötigt. So sind Ziele nichts anderes als ein Leitfaden für die Ermittlung der Konditionen, die die Entscheidung zwischen Recht und Unrecht tragen. Ohne Konditionen kein Code, kein Programm, keine strukturierte Komplexität, letztlich kein Recht.
Im Bereich der Individualleistungen bleibt problemorientierte Kommunikation (bisher; da ja auch eine andere Vorgehensweise möglich ist) nicht aus, da die Operationalisierung als Mängelzuweisung erfolgt. Im Rahmen einer Fallbeschreibung ist anzugeben, unter welchen Bedingungen Positivziele nicht erreicht sind. In der Abwesenheit der Mängel liegt dann der Positivzustand vor, und das Ziel ist erreicht.
Die Idee der Lösungsorientierung sieht demgegenüber vor, als konditionale Auslösekriterien für das staatliche Entscheiden die noch zu erwerbenden Ressourcen bzw. zu erreichenden Ziele zu bezeichnen. In lösungsorientierter Hinsicht wird davon ausgegangen, dass Ressourcen und Ziele beispielsweise als zu erwerbende Kenntnisse und Fähigkeiten zu formulieren sind.
Kritische Sozial- und Gesellschaftstheorie vermittelt ebenfalls Hinweise auf Problemorientierung. Kritische Gesellschaftstheorie zielt unter anderem auf den
»Nachweis, dass die Struktur und Dynamik der kapitalistischen Ökonomie, die diese [Struktur und Dynamik] stabilisierenden Macht- und Herrschaftsverhältnisse sowie ihre ideologische Verklärung zu inakzeptablen Ungerechtigkeiten, zu Einschränkungen der individuellen Autonomie, zur fortschreitenden Zerstörung der natürlichen Lebensgrundlagen sowie zur Gefährdung demokratisch verfasster Politik führen« (Scherr 2015, S. 18).
Kritische Sozial- und Gesellschaftstheorie ist somit laut Scherr in ihrer grundsätzlichen Kapitalismuskritik normativ voraussetzungsvoll. Und sie nimmt gesellschaftliche Strukturen als problemerzeugende in den Blick und will mit diesem perspektivischen Hebel eine Umgestaltung der Gesellschaft herbeiführen (ebd., S. 17).
Soziale Arbeit ...