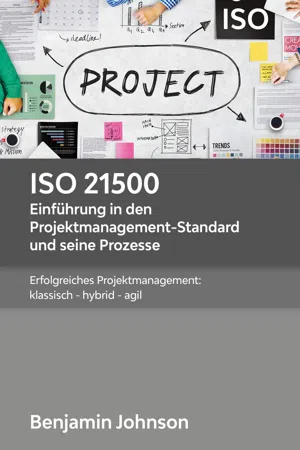
eBook - ePub
ISO 21500 - Einführung in den Projektmanagement-Standard und seine Prozesse
Erfolgreiches Projektmanagement: klassisch - hybrid - agil
- 120 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
ISO 21500 - Einführung in den Projektmanagement-Standard und seine Prozesse
Erfolgreiches Projektmanagement: klassisch - hybrid - agil
Über dieses Buch
Der ISO 21500 Standard ist die internationale Norm für Projektmanagement. Sie setzt auf den Erfahrungen und Erkenntnissen aller großen internationalen Projektmanagement-Methoden und Frameworks wie Prince2 ®, PMP ®, IPMA oder DSDM auf, bietet aber auch die Möglichkeit für den Einsatz von agilen Frameworks wie Scrum, Kanban, XP etc. Benjamin Johnson, erfahrener Projektleiter in namhaften internationalen Organisationen, führt seit über zwanzig Jahren erfolgreich Projekte in unterschiedlicher Größe sowohl national wie auch international durch. Im vorliegenden Buch vermittelt er einen Einblick in das Prozessmodell und wichtige Erfolgsfaktoren im Kontext von modernem Projektmanagement, basierend auf dem ISO 21500-Prozessmodell.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu ISO 21500 - Einführung in den Projektmanagement-Standard und seine Prozesse von Benjamin Johnson im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Betriebswirtschaft & Verwaltung. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
4. Projektmanagementprozesse
Anders als die Norm habe ich mich entschlossen, die Projektmanagementprozesse weitgehend chronologisch darzustellen, sofern es die Zuordnung zu verschiedenen Projektphasen betrifft. Es sollte aber nicht so verstanden werden, dass die einzelnen Prozesse innerhalb einer Projektphase chronologisch abzuarbeiten wären. Oft laufen diese parallel oder iterativ ab. Die Nummerierungen entsprechen den relevanten Darstellungen in der Norm.
Projekte werden in der Norm generell durch Inputs, Werkzeuge & Techniken und Outputs charakterisiert. Ich werde mich in meiner Darstellung an diese Vorgehensweise halten, dabei einer höheren Nutzbarkeit der Praxis zuliebe gewisse Werkzeuge und Techniken genauer darzustellen, als dies die Norm tut, welche keine Wahl vorschreibt, zumal unterschiedliche Projekte zweifellos auch unterschiedliche Werkzeuge mehr oder weniger hilfreich erscheinen lassen. Entsprechend sollte sich der Leser selbstverständlich frei fühlen, beschriebene Werkzeuge und Techniken gegen andere, im eigenen Kontext erfolgversprechendere auszutauschen.
4.2.2.2 Initiierung (Projektphase 1)
Die Initiierungsphase steht für viele Projekte am Anfang. Es besteht allerdings die Möglichkeit, dass Organisationen davor bereits ein Assessment, ein Vorprojekt, eine Feasibility-Phase oder Ähnliches einsetzen. Die Norm reglementiert dies nicht – es gibt aber aus Sicht der Norm auch nichts, was gegen ein solches Vorgehen spräche. Grundsätzlich wird die Initiierungsphase dafür eingesetzt, die Grundlagen für ein Projekt zu schaffen und damit eine weitreichende Entscheidungsgrundlage zu erstellen, welche eine fundierte Entscheidung erlaubt, ob ein Projekt weiterverfolgt werden soll und wenn ja, die Grundlagen zu schaffen, auf denen eine solide Projektplanung aufsetzen kann.
Die Phase besteht aus den Prozessen:
- Erstellen eines Projektauftrages (Themengruppe: Integration)
- Ermitteln der Stakeholder (Themengruppe: Stakeholder)
- Zusammenstellen des Projektteams (Themengruppe: Ressourcen)
4.3.2 Erstellen eines
Projektauftrages (Develop Project Charter)
Ein Projektauftrag verbindet ein Projekt mit den strategischen Zielen einer Organisation und hält die Rahmenbedingungen, Annahmen und Einflussfaktoren fest. Zentrale Aufgaben sind:
- formale Freigabe eines Projekts oder einer Projektphase ermöglichen
- Festlegen des Projektleiters mit seinen Aufgaben und Entscheidungskompetenzen
- Festhalten des erwarteten Nutzens, der Projektziele, Liefergegenstände sowie des ökonomischen Kontexts
Projekte werden üblicherweise als Folge eines oder mehrerer der nachfolgenden Gründe gestartet:
- Marktnachfrage
- Geschäftsanforderung
- Kundennachfrage
- technologischer Fortschritt (sei es, diesen nachzuvollziehen oder ihn zu initiieren)
- gesetzliche oder regulatorische Anforderungen
- gesellschaftliche Anforderungen
In diesem Prozess wird eine Leistungsbeschreibung (Statement of work) sowie ein Business Case erstellt, welche die Basis für die Zustimmung/Vereinbarung zum weiteren Projektvorgehen darstellen.
Leistungsbeschreibung (Statement of work)
Die Leistungsbeschreibung stellt die Grundlage für das Projekt dar. Sie kann als Referenz herangezogen werden, um sicherzustellen, dass alle am Projekt Beteiligten von den gleichen Grundlagen ausgehen. Entsprechend wichtig ist es, zu Projektbeginn eine solide Grundlage zu schaffen.
„Der Leistungsbeschreibung kommt bei umfangreichen Verträgen eine zentrale Rolle bereits bei Angebot oder Ausschreibung zu. Sie führt im Detail in einem Verzeichnis auf, zu welchen Leistungen sich der Verkäufer oder Auftragnehmer vertraglich verpflichtet und welche Leistungsmerkmale vorgesehen sind. Die Festlegung der Sachleistung ist neben der Festlegung der Gegenleistung, also in der Regel des Kaufpreises, ein unverzichtbarer Bestandteil des Vertrages und meist Schwerpunkt der Vertragsverhandlungen. Die Leistungsbeschreibung kommt kaum vor bei einfachen Kaufverträgen des Alltags (die Gebrauchsanleitung oder Packungsbeilage stellen eine Gebrauchsinformation dar), sie spielt dagegen eine große Rolle bei Werkverträgen wie dem Bauvertrag (dort als Bausoll bezeichnet) oder dem Reisevertrag für Pauschalreisen.”4
Eine Leistungsbeschreibung (SOW) sollte mindestens die folgenden Elemente umfassen:
- alle Liefergegenstände und ihre Lieferzeitpunkte
- die Arbeitsschritte, die zur Erstellung der Liefergegenstände führen, und die dafür Verantwortlichen
- die benötigten Ressourcen
- die Projektsteuerung für das Projekt
- Kosten und Fristen
Business Case
Der Business Case soll drei zentrale Aufgaben erfüllen: Er stellt alle Informationen zur Verfügung, um das Projekt durchzuführen, dient als Grundlage für die Außendarstellung und Kommunikation über das Projekt und dient als Referenz während des gesamten Projektlebenszyklus.
Dafür sollte er zumindest die folgenden Fragen beantworten:
- Welches Ziel verfolgt das Projekt bzw. welchen Kundennutzen soll es realisieren?
- Welche Lösungsansätze wurden geprüft?
- Warum wurde der vorgeschlagene Lösungsansatz gewählt? Welche Risiken oder Einflussfaktoren sind bekannt?
- Welche Kosten werden entstehen?
- Wie wird der Projekterfolg gemessen?
- Wer trägt welche Verantwortung?
- Welche Auswirkungen wird das Projekt (z. B. auf die Firma, den Kunden) haben?
Im Verlauf des Projektes kann es zu Situationen kommen, welche eine Anpassung des Business Case notwendig machen. Dafür müssen klare Vorgehensweisen und Verantwortungen (Erstellung, Prüfung, Freigabe) festgelegt werden.
Zustimmung/Vereinbarung
Basierend auf den genannten Schritten (Erstellen einer Leistungsbeschreibung und eines Business Case) wird im positiven Falle eine Vereinbarung getroffen; diese kann die Form eines Vertrags, einer Absichtserklärung, eines Service Level Agreements o. ä. haben und je nach Projekt(-Volumen) sehr formell oder auch informell, z. B. in Form einer einfachen E-Mail, erfolgen.
Die genannten Arbeiten bilden gemeinsam den Projektauftrag. Ein guter Projektauftrag muss ausgewogen sein. Er darf nicht nur Chancen und positive Faktoren darstellen, sondern muss auch Risiken und mögliche negative Auswirkungen klar festhalten. Typische Herausforderungen im Kontext von Projekten sind beispielsweise:
- unklare Ziele
- Veränderungen des Projektfokus
- unrealistische zeitliche Rahmenbedingungen
- nicht verfügbare fachliche oder methodische Kompetenzen im Team
- mangelnde Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
- unzureichendes Risikomanagement
- Kommunikationsprobleme
- mangelnde Einbindung und/oder Kooperation der Stakeholder
Sie alle sollten im Rahmen der Arbeiten bedacht werden und – wo diese festgestellt werden – auch gemeinsam mit einem vorgeschlagenen Lösungsansatz festgehalten werden.
4.3.9 Ermitteln der Stakeholder
(Identify Stakeholders)
Ziel des Prozesses “Ermitteln der Stakeholder” ist es, Personen, Gruppen und Organisationen festzuhalten, welche entweder vom Projekt betroffen sind oder selbst Einfluss auf das Projekt haben. Sie werden mit ihren Zielen und dem Grad ihrer Einflussnahme festgehalten. Das dafür eingesetzte Dokument wird “Stakeholder Register” genannt.
Stakeholder können sowohl innerhalb der Projektorganisation als auch außerhalb auf unterschiedlichen Entscheidungsebenen zu finden sein.
Wenn man erfolgreich Stakeholdermanagement betreiben will, ist es wichtig, sich einen Überblick über die Organisation zu verschaffen, um die Projektherausforderungen der Organisation und das mit diesem Marktsegment verbundene Risiko zu verstehen. Allgemeine Informationen über die betreffende Organisation sollten gesammelt werden, um ihre Mission, Strategien, Hauptziele, Werte usw. besser einschätzen zu können. Dies trägt dazu bei, die Kohärenz und Abstimmung mit den strategischen Zielen sicherzustellen.
Man unterscheidet hier nach verschiedenen Ebenen von Zielen, welche es in Einklang zu bringen gilt:
- Mission (Mission) – Der Daseinszweck der Organisation, der Grund, weshalb es wichtig ist, dass die Organisation (so) besteht.
- Werte (Values) – Die Grundlagen für das Handeln einer Organisation, was die Mitglieder der Organisation eint. Hieraus entspringt Identifikation von Mitarbeitern und anderen Beteiligten.
- Ziele (Objectives) – Ziele, welche eine Organisation erreichen will, entsprechen i. a. den SMART-Kriterien5.
- Strategien (Strategies) – bestehen aus einer Folge von Maßnahmen, um eines oder mehrere Ziele zu erreichen.
Es gibt verschiedene Techniken und Ansätze, um den strategischen Kontext einer Organisation besser wahrzunehmen. Grundsätzlich könnte das ein eigenes Projekt sein. Wenn wir es im Kontext der Arbeiten an einem Projekt analysieren, so ist zweifellos eine gewisse Fokussierung wichtig. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Identifizierung und Analyse bekannter Bedrohungen und externer Projektanforderungen im Zusammenhang mit dem Kontext der Organisation gewidmet werden.
Oft eingesetzte Techniken in diesem Kontext sind die SWOT-Analyse, die PEST-Analyse oder Porters Five Forces:
SWOT-Analyse
„Die SWOT-Analyse (engl. Akronym für Strengths (Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities (Chancen) und Threats (Risiken)) ist ein Instrument der strategischen Planung.
Sie dient der Positionsbestimmung und der Strategieentwicklung von Unternehmen und anderen Organisationen.
Chancen sind Möglichkeiten, durch neue und/oder verbesserte Produkte und Dienstleistungen vorhandene und/oder neue Kunden zu gewinnen oder Stammkunden zu halten. Diese Chancen können durch (attraktive) Angebote von Wettbewerbern oder durch technologische und wirtschaftspolitische Veränderungen gefährdet sein (Risiken). Sobald die Risiken aus Sicht der Verantwortlichen z...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- Die Norm
- 3. Projektmanagementkonzepte
- 4. Projektmanagementprozesse
- Nachwort
- Literaturverzeichnis
- Impressum