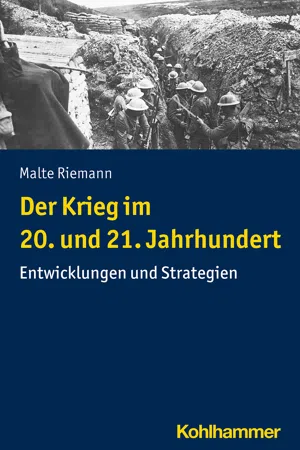![]()
1 Krieg und Kriegsführung
»Der Krieg […] ist ein wahres Chamäleon, weil er in jedem konkreten Falle seine Natur etwas ändert.«
(Carl von Clausewitz 1989, S. 212)
Was ist Krieg? Diese Frage mag zunächst trivial klingen, glauben wir doch, dass dieses Phänomen für uns klar zu erkennen ist. Wir beziehen uns hierbei zumeist auf gegenwärtige (Syrien, die Ukraine) und geschichtliche Ereignisse (der Erste und Zweite Weltkrieg), welche mit diesem Begriff beschrieben und dadurch begreifbar werden. Darüber hinaus benutzen wir den Begriff des Krieges, um unterschiedliche Aspekte wie Kriegstechniken, Motivationen und Ursachen verschiedener Kriege und Kriegsformen begrifflich einzuordnen. In diesem Sinne finden wir eine endlose Liste an Kriegsbegriffen: totaler Krieg, Kalter Krieg, Weltkrieg, konventioneller und nuklearer Krieg, Angriffs- und Verteidigungskrieg, Stellvertreterkrieg, Revolutionskrieg, Unabhängigkeitskrieg, Dekolonisationskrieg, Eroberungskrieg, Guerillakrieg, Heiliger Krieg, ethnischer Krieg, Bürgerkrieg, humanitärer Krieg und viele andere. Aufgrund dieser unterschiedlichen Kriegsbegriffe stellt sich die Frage, ob der Krieg ein Wesen hat. Oder anders ausgedrückt, ob diese unterschiedlichen Konfliktformen und Begriffe etwas ihnen Inhärentes haben, welches die Benutzung des Begriffes Krieg ermöglicht. Um den Krieg somit zu ergründen, benötigen wir zunächst eine Definition. Hierbei wird schnell das klar, dass es für Krieg keine allgemein akzeptierte Definition gibt. Bluhm und Geis geben dieser Problematik Ausdruck:
»In den Sozialwissenschaften kann man sich selten auf eine allgemeingültige Definition von Begriffen einigen, pluralistische Deutungen und unterschiedliche konzeptuelle Zuspitzungen von sozialen Phänomenen, die historischem Wandel unterliegen, sind die Regel.« (Bluhm/Geis 2004, S. 420)
Schon ein kurzer Blick auf die Geschichte des Krieges reicht aus, um sich der Schwierigkeit eines solchen Unterfangens bewusst zu werden, da die Bedeutungen, Absichten, Mittel, Wege und Ergebnisse des Krieges einer immerwährenden Transformation unterworfen sind. Der Krieg, wie der berühmte preußische General Carl von Clausewitz (1780–1831) bereits im 19. Jahrhundert anmerkte, ist somit ein Chamäleon, welches sich seinen Umweltbedingungen anpasst. Moderner drückt dies der Politikwissenschaftler Sven Chojnacki aus: »Weil Krieg immer auch mit den Strukturen und dem Wandel interner und externer gesellschaftlicher Rahmenbedingungen verkoppelt ist, unterliegt er als soziale und politische Praxis vielfältigen, historisch kontingenten Veränderungsprozessen«. (Chojnacki 2004, S. 403) Dass der Krieg »zugleich auch selbst Motor des Wandels« (Chojnacki 2004, S. 403) ist, der Geschichte verändert und transformiert, erschwert darüber hinaus eine begriffliche Definition. Der Krieg ist in diesem Sinne ein Chamäleon, das sich nicht nur seiner Umgebung anpasst und somit seine Gestalt wandelt, sondern das auch seine Umgebung verwandelt. Anna Geis merkt deshalb an: »Krieg ›wesenhaft‹ oder zeitlos gültig zu definieren, ist angesichts seiner Historizität, seines Gestalt- und Formwandels im Laufe der Geschichte, seiner vielfältigen Erscheinungsformen wohl kaum möglich.« (Geis 2006, S. 14)
Trotz dieser definitorischen Probleme oder gerade deswegen ist der Krieg Gegenstand wissenschaftlicher und politischer Debatten, in denen wir »unterschiedliche Konzepte und Deutungsrahmen von dem, was Krieg ist« finden. (Ehrhart 2017, S. 9) Ein Ansatzpunkt ist es Krieg, quantitativ zu erfassen. Am bekanntesten ist die an der University of Michigan entwickelte Correlates of War Datenbank. Diese klassifiziert gewaltsame Konflikte mit mindestens 1 000 kampfbedingten Todesopfern innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten und an denen organisierte Streitkräfte beteiligt sind als Krieg. (Sarkees/Wayman 2010) Dieser Ansatz ist vielfältig kritisiert worden. Erstens ist die Schwelle von 1 000 Kriegstoten schwer nachzuvollziehen (können etwa gewaltsame Konflikte mit 999 Todesopfern nicht als Krieg gelten?). Zweitens sind präzise Daten über Kriegsopferzahlen oft schwer zu erhalten. Und drittens stellt sich die Frage, ob Krieg nur über dessen physische Auswirkungen definiert werden sollte.
Ein anderer Ansatz ist es, den Krieg qualitativ anhand seiner funktionalen Charakteristika zu erfassen. Clausewitz tat dies als einer der ersten in seinem unvollendeten Hauptwerk Vom Kriege (1832). Für Clausewitz ist der Krieg die »Fortsetzung des politischen Verkehrs mit Einmischung anderer Mittel«. (Clausewitz 1980, S. 674) Krieg wird als »politisches Werkzeug« verstanden, dessen Ziel es ist, einem Gegner den eigenen Willen aufzuzwingen. Den Krieg verbindet hierbei »stets die Tirade aus Ziel (Niederwerfen des Gegners), Mittel (Anwendung physischer Gewalt) und politischem Zweck (Aufzwingen des eigenen Willens).« (Tsetsos 2014, S. 22) An Clausewitz’ Kriegsdefinition wird vornehmlich kritisiert, dass diese zu kurz greift, da »neben politischen Zwecken Kriege auch aus anderen Gründen geführt werden. Die Motive reichen von ideologischen und religiösen Ansichten über persönlichen Geltungsdrang von Eliten bis hin zur individuellen Bereicherung.« (Tsetsos 2014, S. 23) Weitergefasst lässt sich Krieg in Anlehnung an Clausewitz als organisierte Gewalt zwischen zwei oder mehreren organisierten Gruppen zur Durchsetzung politischer, wirtschaftlicher, ideologischer und militärischer Interessen verstehen.
Neben quantitativen und qualitativen Ansätzen hat sich in den letzten Jahren der Ansatz der kritischen Kriegsstudien (Critical War Studies) (Barkawi/Brighton 2011) entwickelt. Aus dieser Perspektive, angelehnt an das Werk des französischen Philosophen Michel Foucault, wird der Krieg als ein ontogenetischer Moment des sozialen Lebens verstanden. Der Krieg wird den Critical War Studies folgend als ein generativer und produktiver Gewaltakt definiert, der kein Wesen hat, sondern als transformative Kraft verstanden werden muss. Hüppauf sieht deshalb Krieg als etwas an das sich aus Gewalt und Diskurs zusammensetzt. »Es gibt keinen Krieg ohne einen gesellschaftlichen Diskurs aus Reflexion, Imagination und Gedächtnis. Der Diskurs ist im Krieg. Zugleich ist auch der Krieg stets im Diskurs.« (Hüppauf 2013, S. 32)
Was als Krieg bezeichnet wurde und wird, ist somit historischen Veränderungen unterworfen und in hohem Maße von politischen Interessen, rechtlichen Interpretationen, ideologischen Standpunkten und kulturellen Traditionen abhängig, auf welche der Krieg selbst transformativ einwirkt. Aufgrund dieser Vielzahl von Kriegsverständnissen ist aus der Sicht des Völkerrechtes »der Begriff des Krieges funktionslos geworden« (Bothe 2007, S. 469) In der Charta der Vereinten Nationen kommt der Begriff nur einmal vor und die »stattdessen verwendeten juristischen Bezeichnungen lauten ›internationaler bewaffneter Konflikt‹ und ›nichtinternationaler bewaffneter Konflikt‹« (Ehrhart 2007, S. 9) Abschließend ist somit festzuhalten, dass der Krieg ein definitorisch schwer erfassbares Phänomen ist.
1.1 Kriegsursachentheorien
Neben der Frage, was der Krieg ist, ist auch die Frage nach den Gründen des Krieges umstritten. Dieser Frage wird in der Kriegsursachenforschung nachgegangen. Es gibt in der Kriegsursachenforschung keine einheitliche Theorie, vielmehr finden sich verschiedene Erklärungsmodelle, auf welche im Folgenden eingegangen werden soll. Kriegsursachen zwischen Staaten können in drei unterschiedliche Analyseebenen unterteilt werden: »das Individuum, die Gesellschaft bzw. der Staat und das internationale System.« (Bonacker/Imbusch 1996, S. 88) In der Kriegsursachenforschung finden sich für jede dieser drei Analyseebenen unterschiedliche Erklärungsmodelle.
1) Auf der Ebene des Individuums stehen zwei Erklärungsansätze im Mittelpunkt.
• Einerseits wird postuliert, dass der Krieg zur Natur des Menschen gehört. »Hier wird der Mensch mit seinen Neigungen, Trieben und seinem Machwillen als Quelle der Gewalt ausgemacht, die die Ursache für Konflikte im allgemeinen und Kriege im Besonderen ist.« (Bonacker/Imbusch 1996, S. 88)
• Ein zweiter individualistischer Ansatz leitet die Kriegsursache von der Natur spezifischer Individuen (z. B. Staatsoberhäupter, religiöse Führer) ab. Dieser Ansatz basiert auf der Annahme, dass die psychologischen und persönlichen Charakteristika von Personen in Führungspositionen die Entscheidung zum Krieg beeinflussen. Kriege, nach diesem Ansatz, wären anders verlaufen oder hätten nicht stattgefunden, wenn ein bestimmtes Individuum keine politische Macht innegehabt hätte. (Tsetsos 2014) So stellt sich hier z. B. die Frage, ob der Zweite Weltkrieg auch ohne Hitlers Ernennung zum Reichskanzler ausgebrochen wäre.
2) Auf der gesellschaftlichen Ebene wird der Ausbruch organisierter Gewalt in der Organisation und Struktur der kriegsführenden Akteure verortet. Der amerikanische Politikwissenschaftler Kenneth Waltz fasste diesen Erklärungsansatz mit der Prämisse »bad states lead to war« (Waltz 1959, S. 122) zusammen. Dieser Prämisse folgend bestimmen die Binnenstruktur eines Staates (politisch-gesellschaftlich), dessen Verfassungsform und die von dieser Verfassungsform maßgeblich geprägte politische Praxis das internationale Verhalten eines Staates. (Waltz 1959) Despotische Unrechtsregime, z. B. tendieren eher dazu, binnen- sowie außenpolitische Konflikte mit Gewalt zu lösen als rechtsstaatlich verfasste Gemeinwesen.
3) Das internationale System bildet den dritten Kriegserklärungsansatz. Diesem liegt eine spezifische Interpretation der internationalen Politik zugrunde, nach der die Struktur des internationalen Systems durch die Abwesenheit einer höheren Autorität gekennzeichnet ist. Durch ihre Abwesenheit finden sich Staaten in einem anarchischen Selbsthilfesystem wieder. Da Anarchie »Zwangsregulierung seitens einer übergeordneten Autorität entbehrt« (Herz 1974, S. 57), zwingt der reine Selbsterhaltungswille die Staaten zum Machtwettstreit; »ihrer eigenen Sicherheit wegen müssen sie, wenn sie nicht den Untergang riskieren wollen, auf Verteidigung gegen einen möglichen Angriff gerüstet sein«. (Herz 1974, S. 57) Dies führt zu einem Sicherheitsdilemma, in welchem Staaten kontinuierlich ihre eigene Sicherheit erhöhen (z. B. durch Aufrüstung), welches gleichzeitig in anderen Staaten ein Gefühl der Unsicherheit hervorruft und diese ebenfalls dazu zwingt, ihre eigene Sicherheit zu erhöhen. Obwohl die Sicherheitserhöhung der Verteidigung dienen soll, wird diese oft als Bedrohung wahrgenommen, welche unter Umständen zum Krieg führen kann. Der internationale Erklärungsansatz betrachtet den Krieg somit als endemische Eigenschaft des Staatensystems, welcher nur durch eine grundlegende Änderung dieses Systems überwunden werden kann. Innerhalb der Disziplin der Internationalen Beziehungen ist dieser Erklärungsansatz jedoch stark umstritten. Die Kritik reicht hierbei von einer Ablehnung der Annahme, dass das internationale System inhärent anarchisch ist (Wendt 1992), das internationale Kooperation den Effekt der Anarchie regulieren kann (Milner 1991) und das Anarchie nur eine diskursive Konstruktion ist. (Ashley 1988)
Neben diesen unterschiedlichen Analyseebenen sind speziell seit dem Ende des Kalten Krieges und dem gesteigerten Interesse an innerstaatlichen Konflikten weitere Gründe für den Ausbruch des Krieges angeführt worden. Eine der prägendsten Wissenschaftlerinnen in dieser Debatte ist die Engländerin Mary Kaldor. Basierend auf einer qualitativen Analyse des Konfliktes in Bosnien und Herzegowina argumentiert Kaldor, dass in den 1980er- und frühen 1990er-Jahren eine neue Art von organisierter Gewalt (Gewalt zur privaten Bereicherung) entstanden ist, die als »Neuer Krieg« bezeichnet werden kann. (
Kap. 5.2) Diese Kriege müssen im Kontext der Schwächung der staatlichen Souveränität durch die Globalisierung verstanden werden, welche zu innenpolitischen Krisen durch die internationale Verflechtung mit anderen globalen Risiken wie der Ausbreitung von Krankheiten, der Anfälligkeit für Katastrophen und Armut führt. (Kaldor 2000) Kennzeichnend für diese Kriege ist eine spezifische Kriegsökonomie. Diese basiert auf Raub und Kriminalität, weshalb Konfliktparteien kein Interesse an einer Beendigung des Konfliktes besitzen, da die Re-Etablierung eines staatlichen Gewaltmonopols negative Auswirkungen auf diese hätte. Neben der Kriegsökonomie wurde auch besonderes Augenmerk auf die Rolle von Ethnizität als Konfliktursache »Neuer Kriege« gelegt. Jüngste Beispiele sind der Völkermord in Ruanda und die Balkankriege. Ethnizität schließt Identitätskonflikte mit ein, bei denen kriegsführende Gruppen aufgrund einer bestimmten Identität (z. B. Stammesverband), Religion oder Sprache politische Machtansprüche stellen.
Die beiden wichtigsten theoretischen Diskurse über ethnische oder kulturelle Konflikte sind erstens die primordialistische und zweitens die konstruktivistische Theorie. Der primordiale Ansatz meint, dass ethnische Konflikte in uraltem Gruppenhass und Gruppenloyalitäten verwurzelt sind und dass diese alten Quellen der Feindseligkeit und Erinnerungen an vergangene Gräueltaten kollektives Selbstverständnis und Handeln bestimmen, wodurch Gewalt nur schwer zu vermeiden ist. (Kaplan 1994) Die konstruktivistische Konflikttheorie nimmt an, dass Ethnizität ein soziales Konstrukt ist, welches von Eliten als Instrument zur gewaltsamen Mobilisierung missbraucht wird.
»Die konstruktivistische Perspektive verdeutlicht, dass die Identität jedes Individuums und jeder Gruppe keineswegs nur durch ethnische Merkmale bestimmt wird. Daneben besteht eine Vielzahl weiterer Prägungen: Stand, Dynastie, Religion, Weltanschauung, Klasse, Geschlecht, Alter, Einkommen, Bildung usw.« (Schrader 2012)
Durch den Prozess der »Ethnisierung« werden solche Eigenschaften marginalisiert oder durch ethnische Eigenschaften ersetzt. Kritiker der ethnischen Konflikttheorien argumentieren, dass diese zu monokausal seien und oftmals die politischen und wirtschaftlichen Wurzeln von Konflikten nicht angemessen analysieren. (Stewart 2002) Untersuchungen zur relativen Benachteiligung in Gesellschaften und ihrer Assoziation mit Konflikten kommen zu dem Ergebnis, dass bei einer signifikanten Diskrepanz zwischen dem, was Menschen glauben, das ihnen zusteht, und dem, was sie glauben zu bekommen, die Wahrscheinlichkeit eines (gewaltsamen) Konflikts besteht. (Gurr 1970) Politische Gewalt wird als wahrscheinlicher angesehen, wenn die Bevölkerung glaubt, dass die derzei...