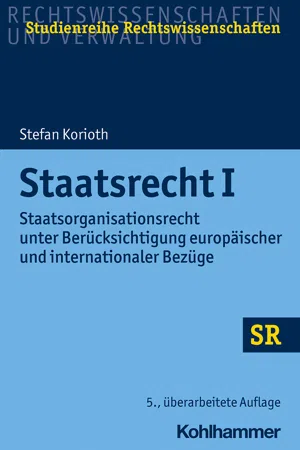
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Staatsrecht I
Staatsorganisationsrecht unter Berücksichtigung europäischer und internationaler Bezüge
- 376 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Staatsrecht I
Staatsorganisationsrecht unter Berücksichtigung europäischer und internationaler Bezüge
Über dieses Buch
Das Lehrbuch vermittelt Studierenden aller Ausbildungsstufen einen kompakten Überblick über das Staatsorganisationsrecht. Die Neuauflage geht ausführlich auf aktuelle Entwicklungen in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein. Am Ende des Buches findet sich ein umfangreiches Wiederholungskapitel, das mit Übersichten und Schemata sowie einer Zusammenstellung möglicher Prüfungsgegenstände aus dem Staatsorganisationsrecht der Vorbereitung auf die Zwischenprüfung sowie die Erste Juristische Prüfung dienen soll.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Staatsrecht I von Stefan Korioth, Winfried Boecken, Stefan Korioth, Winfried Boecken,Stefan Korioth im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Jura & Öffentliches Recht. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil III:Die Staatsorgane
Das Staatsorganisationsrecht im engeren Sinn regelt die verfassungsrechtliche Ausgestaltung der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben. Die folgende Darstellung orientiert sich am Aufbau des Grundgesetzes: Zunächst werden die Verfassungsorgane mit ihren Kompetenzen und den rechtlichen Anforderungen an ihre Wahrnehmung und Binnenorganisation vorgestellt. Teil IV behandelt ihr Zusammenwirken bei der Ausübung staatlicher Tätigkeit.
§ 22Der Begriff des Staatsorgans
373Der Bund stellt als Gebietskörperschaft des öffentlichen Rechts (ebenso wie die Länder und die Kommunen) eine juristische Person des öffentlichen Rechts dar. Juristische Personen sind zwar rechtsfähig, d. h. sie können Träger von Rechten und Pflichten sein. Anders als natürliche Personen sind sie aber nicht in der Lage, ihre Rechte und Pflichten selbstständig auszuüben. Sie sind nicht handlungsfähig. Sie benötigen daher natürliche Personen, die für sie handeln, d. h. ihre Funktionen ausüben, ihre Rechte wahrnehmen und ihre Pflichten erfüllen. Das Handeln dieser natürlichen Personen muss rechtlich der juristischen Person zugerechnet werden, so dass die Rechtsfolgen ausschließlich sie treffen. Abhängig von den für eine juristische Person vorgesehenen Aufgaben und Funktionen bedarf es deshalb einer entsprechenden Organisationsstruktur, die eine Zuweisung der Funktionen und Aufgaben an einzelne handlungsfähige natürliche Personen vornimmt (sachliche und persönliche Zuständigkeiten).
374Erforderlich ist daher zunächst die Schaffung von einzelnen Organen (Werkzeugen) durch einen rechtlichen Organisationsakt. Organe sind verselbstständigte Institutionen innerhalb einer juristischen Person (Organträger), die mit Zuständigkeiten betraut sind1. Das Handeln der Organe wird der juristischen Person unmittelbar zugerechnet. Die Organe erlangen innerhalb des Organträgers in gewisser Weise Rechtsfähigkeit, weil sie entsprechend ihren Zuständigkeiten über Organrechte und -pflichten verfügen. Diese Organrechte und -pflichten gelten aber nur in der Sphäre des Organträgers, nicht jedoch nach außen gegenüber Dritten. Die Organe setzten sich wiederum aus verschiedenen Organteilen zusammen. Diese können jedoch nicht eigenständig nach außen für die juristische Person handeln, sie sind vielmehr unselbstständige Teile des jeweiligen Organs.
375Allerdings handelt es sich auch bei der Annahme eines für den Staat auftretenden Organs um eine rechtliche Fiktion. Dem Organ als solchem kommt ebenfalls keine eigene Handlungsfähigkeit zu. Es bedarf deshalb der Ausfüllung durch eine natürliche Person, einen sog. Organwalter. Organwalter erfüllen die dem Organ obliegenden Funktionen und Aufgaben durch tatsächliches menschliches Handeln. Handelt der Organwalter (also etwa die gegenwärtigen Abgeordneten des Bundestags), ist sein Handeln rechtlich zunächst das Handeln des Organs (der Bundestag) und wird über das Organhandeln gleichzeitig dem Organträger als juristischer Person (im Beispiel dem Bund) zugerechnet2. Die Existenz eines Organs ist von der Besetzung durch den konkreten Organwalter unabhängig, jedoch unmittelbar an den Bestand des Organträgers gebunden. Geht der Organträger unter, kann er auch keine Organe mehr haben.
376Eng mit dem Organbegriff verbunden ist der Begriff des (öffentlichen) Amtes und bezogen auf dessen Wahrnehmung durch eine natürliche Person der Begriff des Amtswalters. Ein öffentliches Amt kann im staatsrechtlichen Sinne definiert werden als institutionalisierter Zuständigkeitsbereich, der auf eine natürliche Person als Amtswalter zugeschnitten ist. Dieser Amtswalter erfüllt die Aufgaben, die mit seinem Amt verbunden sind, sein Handeln wird dem Träger des Amtes (der Anstellungskörperschaft) zugerechnet. Wird ein Organ nur durch eine Person ausgeübt, stellt es zugleich ein Amt dar (z. B. das Amt des Bundespräsidenten). Organe können sich auch aus mehreren Organteilen zusammensetzen, die jeweils auf eine natürliche Person zugeschnitten sind und deshalb Ämter sind. So besteht etwa der Deutsche Bundestag aus den Bundestagsabgeordneten, das Amt des Bundestagsabgeordneten wird durch natürliche Personen ausgeübt.
377Für die Organisation der Staatsfunktionen bedeutet dies, dass durch einen rechtlichen Organisationsakt die Staatsorgane geschaffen werden müssen, die die staatlichen Zuständigkeiten wahrnehmen. Für die obersten Staatsorgane geschieht dieser Rechtsakt im Rahmen der Verfassunggebung, da durch diese die staatliche Grundordnung definiert wird. Dabei müssen zunächst die Zuständigkeiten geregelt werden, die die Staatsorgane sowohl innerhalb der staatlichen Sphäre, als auch nach außen wahrnehmen dürfen oder müssen. Diese Zuweisung verlangt zum einen die funktionale Einteilung der Zuständigkeiten und gleichzeitig die entsprechende organisatorische Zuordnung. Für die staatliche Ordnung bedeutet dies insbesondere die Zuweisung der klassischen drei Staatsfunktionen Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung an entsprechende Organe. Erforderlich sind die Regelung der inneren Struktur sowie organinterne und organexterne Verfahrensregeln für die Wahrnehmung der zugewiesenen Zuständigkeiten. Um den Staat durch seine Staatsorgane handlungsfähig zu machen, muss auch die personelle Besetzung der Staatsorgane durch Organwalter festgelegt werden.
378Im Grundgesetz sind sieben oberste Staatsorgane geregelt, die im Folgenden der Reihe nach vorgestellt werden:
– Der Bundestag (Art. 38 ff. GG);
– Der Bundesrat (Art. 50 ff. GG);
– Der Gemeinsame Ausschuss (Art. 53a GG);
– Der Bundespräsident (Art. 54 ff. GG);
– Die Bundesversammlung (Art. 54 ff. GG);
– Die Bundesregierung (Art. 62 ff. GG);
– Das Bundesverfassungsgericht (Art. 93 GG).
§ 23Der Bundestag
379Der Bundestag nimmt unter den obersten Staatsorganen des Bundes eine hervorgehobene Stellung ein, weil er als einziges Bundesorgan unmittelbar demokratisch legitimiert ist. Die demokratische Legitimation erfolgt durch die Wahl der Abgeordneten, aus denen sich der Bundestag zusammensetzt (vgl. Art. 38 Abs. 1 GG, § 1 Abs. 1 Satz 1 BWahlG). Hauptfunktionen des Bundestags sind die zentrale Stellung als Gesetzgebungsorgan des Bundes, die Kontrolle der Exekutive, vor allem der Bundesregierung, die Vermittlung der demokratischen Legitimation der sonstigen Staatsgewalt des Bundes in personeller und sachlich-funktionaler Hinsicht durch Wahl- und Zustimmungsrechte sowie die Wahrnehmung des Budgetrechts als klassische Parlamentskompetenz.
380Zentrale normative Grundlage des Bundestags im Grundgesetz ist der Abschnitt III mit den Art. 38–48 GG. Dieser Abschnitt trifft die wesentlichen organisatorischen Regelungen, die durch einfachgesetzliche Vorschriften und durch die Selbstorganisation mittels einer Geschäftsordnung konkretisiert oder ergänzt werden (Parlamentsautonomie, Art. 40 Abs. 1 Satz 2 GG). Neben den Art. 38–48 GG nimmt die Verfassung in etlichen weiteren Regelungen funktional auf den Bundestag Bezug, indem sie dem Parlament Kompetenzen, Mitwirkungs- und Informationsrechte bei der Ausübung der Staatsfunktionen einräumt. Wichtigstes Beispiel ist das Gesetzgebungsverfahren des Abschnitts VII in den Art. 70–82 GG.
I.Organteile
381Der Bundestag besteht aus mehreren Organteilen. Dazu gehören das Präsidium mit dem Präsidenten an der Spitze, der Ältestenrat, die Fraktionen, die Ausschüsse sowie die einzelnen Abgeordneten.
382Beim Begriff der parlamentarischen Opposition handelt es sich nicht um einen ausdrücklichen Rechtsbegriff, sondern zunächst lediglich um die politische Bezeichnung für die parlamentarische Minderheit, die der regierungstragenden Parlamentsmehrheit gegenübersteht. Als solche ist sie aber eine parlamentarische Institution, die in gewissen Parlamentsbräuchen und in der Rechtsprechung des BVerfG anerkannt ist3.
1.Präsident
383Vom Bundestag wird ein Abgeordneter für die Dauer der Wahlperiode zum Präsidenten gewählt (vgl. Art. 40 Abs. 1 Satz 1 GG, § 2 GOBT). Es entspricht einer parlamentarischen Gewohnheit, dass die stärkste Bundestagsfraktion den Bundestagspräsidenten stellt und dieser auch von den anderen Fraktionen gewählt wird. Abwählbar ist der Bundestagspräsident mangels rechtlicher Regelung nur bei einer vorherigen Abänderung der Geschäftsordnung des Bundestags (vgl. § 126 GOBT)4. Protokollarisch steht der Bundestagspräsident als Spitze des Bundestags an zweiter Stelle im Staat nach dem Bundespräsidenten5. Allerdings vertritt er diesen nicht, der Vertreter des Bundespräsidenten ist vielmehr der Präsident des Bundesrates (vgl. Art. 57 GG). Nach der Wahl des Bundestagspräsidenten werden dessen Stellvertreter (Vizepräsidenten) gewählt. Die Anzahl der Vizepräsidenten ist variabel, weil jede Fraktion mindestens einen stellen darf (vgl. § 2 GOBT).
Für die Wahl der Stellvertreter gelten die gleichen Grundsätze wie für die Wahl des Präsidenten: Findet sich nach drei Wahlgängen keine Mehrheit für einen vorgeschlagenen Kandidaten, finden weitere Wahlgänge mit demselben Bewerber nur nach Vereinbarung des Ältestenrates statt (§ 2 III GOBT), im Übrigen ist der Wahlvorschlag als gescheitert anzusehen. § 2 GOBT geht somit ersichtlich von einer Begrenzung der Anzahl der Wahlgänge aus, womit er dem Prinzip der Begrenzung parlamentarischer Entscheidungsfindungsprozesse Rechnung trägt. Es ist gerade der Sinn von Wahlen und Abstimmungen, den theoretisch endlosen Diskurs zu begrenzen und zu einer Entscheidung zu gelangen. Dem würde es widersprechen, wenn endlose Wahlgänge durchgeführt würden, bis ein bestimmter Kandidat irgendwann einmal die erforderliche Mehrheit hat6.
384Der Bundestagspräsident ist oberstes Leitungsorgan des Bundestags und Vorsitzender des Bundestagspräsidiums. Damit verbunden sind besondere Organzuständigkeiten sowohl gegenüber den „einfachen“ Abgeordneten als auch gegenüber Dritten. Er hat die Aufgabe, den Bundestag zu vertreten und seine Geschäfte zu regeln. Insbesondere leitet er „die Verhandlungen gerecht und unparteiisch und wahrt die Ordnung im Hause“ (vgl. § 7 Abs. 1 GOBT). Dazu zählt im parlamentarischen Innenverhältnis die Bestimmung der Rednerreihenfolge (vgl. § 28 Abs. 1 GOBT) und die Erteilung des Wortes (vgl. § 27 GOBT). Der Präsident kann Abgeordnete zur Sache und zur Ordnung rufen und Ordnungsverletzungen sanktionieren (vgl. §§ 36 ff. GOBT). Gegen seine Ordnungsmaßnahmen ist ein Einspruch statthaft, der vom Bundestagsplenum behandelt wird (§ 39 GOBT). Daneben besteht die Möglichkeit eines Organstreitverfahrens, wenn sich ein Abgeordneter durch eine Ordnungsmaßn...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Impressum
- Vorwort
- Abkürzungsverzeichnis
- Verzeichnis der abgekürzt zitierten Literatur
- Kommentare zum Grundgesetz
- Teil I: Grundlagen
- Teil II: Staatsstrukturprinzipien und Staatszielbestimmungen
- Teil III: Die Staatsorgane
- Teil IV: Die Staatsfunktionen
- Teil V: Übersichten – Schemata – Definitionen
- Stichwortverzeichnis