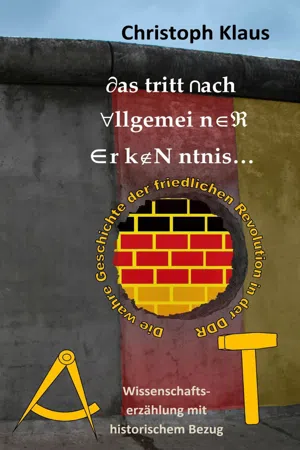![]()
1
Gerd Tulök war einige Jahre jünger als ich. Sein Vater stammte aus Ungarn und war in die gerade gegründete DDR übergesiedelt, weil er mit einer gewissen Katharina Steiner aus Berlin Bekanntschaft geschlossen hatte. Jene sollte kurz darauf Gerds Mutter werden.
Der junge Gerd war ein aufgewecktes Kind. Als seine Altersgenossen noch mit Puppen und Holzeisenbahnen spielten, spielte er vorzugsweise mit Zahlen. Jahre später kam das Gerücht auf, dass diese doch mehr oder weniger ungewöhnliche Vorliebe aus einem verwandtschaftlichen Verhältnis zu einem Herrn Rubik – sie wissen, der mit dem Zauberwürfel – herrührte. Bestätigt wurde dieses nie, aber es war die beste Erklärung, die zur Verfügung stand. Immerhin begleitete ihn diese Vorliebe nicht nur als eine kurze Episode in seinem Leben, die sich spätestens mit der Pubertät auswächst. Als Schüler belegte er regelmäßig vordere Plätze bei den Mathematikolympiaden auf regionaler, nationaler und auch internationaler Ebene. Sein Werdegang war vorgezeichnet.
Zum ersten Mal begegnet bin ich ihm im Jahr 1968 an der Universität in Leipzig. Er hatte gerade sein Mathematikstudium aufgenommen; ich war dorthin versetzt worden, um die politische Lage innerhalb der Studentenschaft im Nachgang der Ereignisse, die sich im selben Jahr in der ČSSR abgespielt hatten, zu sondieren und unter Kontrolle zu halten. Insbesondere war ich angehalten, ein strenges Auge auf Studenten mit Beziehungen ins Ausland, gleich welcher Himmelsrichtung, zu haben, weil man von dort wohl in erhöhtem Maße zersetzende Einflüsse befürchtete. Mir ging das nicht so recht ein, aber ich folgte den erteilten Anweisungen. Welche Rolle gerade diesem Land Ungarn viele Jahre später einmal zufallen würde, daran war zu jenem Zeitpunkt in keinster Weise zu denken.
So hielt ich Gerd Tulök unter besonderer Beobachtung. Seine Mutter war zwar ein treues Mitglied der Partei der Arbeiterklasse, was aber noch lange kein Garant für die Staatstreue ihres Sohnes darstellte. In manchem Fall tritt das genaue Gegenteil ein. Im vorliegenden, muss man sagen, war das Ergebnis eine gewisse Indifferenz; Tulök war in der Tat als unpolitisch zu bezeichnen. So manchem Funktionär wäre ein solches Verhalten zumindest ein Dorn im Auge, um nicht zu sagen suspekt gewesen. Tulök war aber weit davon entfernt, auf diese Weise irgendeine Position zu seinem Heimatland zu bekunden; für ihn gab es nur seine Zahlen, für den Funktionär die Hoffnung, ihn nach Abschluss des Studiums wohlwollend in die gewünschte Position wenden zu können. Intelligente Köpfe wurden gebraucht, aber sie mussten in die richtige Richtung blicken. Ich bemühte mich im Rahmen der mir übertragenen Aufgabe, bei ihm eine gewisse dahingehende Agitation zu betreiben. Deren einziges Resultat bestand zunächst darin, dass wir miteinander persönlich bekannt wurden, ja sogar so etwas wie ein Vertrauensverhältnis aufbauten. Ich fühlte, dass dieser Mann für mich noch eine bedeutende Rolle spielen würde, auch wenn ich dieses Gefühl noch nicht mit konkreten Fakten zu bekräftigen wusste. Ich nutzte meine Position, um für ihn so manches Mal zum Fürsprecher zu werden, wenn es darum ging, einem fachlichen Genie mit noch mangelhafter politischer Überzeugung die richtigen Türen zu öffnen. Er schien zu spüren, was er mir verdankte, auch wenn er zum damaligen Zeitpunkt zu diesen Dingen wohl noch keinen Zugang hatte. Auf jeden Fall entwickelte sich daraus eine Art Freundschaft – zwar nicht von der, jeden Abend miteinander durch die Kneipen zu ziehen, aber immerhin.
Wir verloren uns dann eine Zeitlang aus den Augen, woran ich eine gehörige Portion Mitschuld trug. Mein Engagement für sein Vorankommen und seine Leistungen im Studium – in dieser Reihenfolge oder auch nicht – ermöglichten ihm, den unter den gegebenen gesellschaftlichen Verhältnissen einzig verfügbaren Ritterschlag zu empfangen: Ein Studium in der UdSSR. Ob dies sein Ziel gewesen war, wage ich zu bezweifeln; dieses Angebot aber auszuschlagen, davon hätte ihm jeder abgeraten, falls ihm nicht selbst die Unmöglichkeit einer solchen Handlungsweise eingängig gewesen wäre. Zudem würde es seiner Karriere von förderlicher Wirkung sein, wie sich später herausstellen sollte.
Ich sah ihn wieder, als er, frisch promoviert, in den frühen Achtzigerjahren aus Moskau zurückkehrte, um an der Leipziger Universität den Lehrstuhl für Systemtheorie zu besetzen. Da war er noch nicht einmal fünfunddreißig Jahre alt, aber augenscheinlich innerlich wie äußerlich gereift. Zugegeben, er hatte schon als Student nicht vollständig meiner Vorstellung von einem Mathematiker entsprochen, mit seiner etwas untersetzten Statur und den kräftigen Oberarmen sowie Händen, die beim Fingerrechnen keine gute Figur gemacht hätten. Immerhin hatte er damals eine Brille getragen, die seiner Erscheinung zumindest einen Rest an Intellektualität bewahren konnte. Dieser wurde nicht einmal vom völlig fehlenden Bartwuchs wieder ausgelöscht. In meinen Augen hätte ihm eine Laufbahn als Klaviervirtuose besser zu seinem kantigen Gesicht gestanden, aber er selbst wäre wohl der Erste gewesen, den das überhaupt nicht interessierte.
Inzwischen hatte sein Äußeres einen gewissen Wandel erfahren. Das einstmals wirre rotblonde Haar trug er jetzt von sachkundiger Hand perfekt in Form gebracht und gescheitelt. Die Brille war verschwunden; ob er sie nicht mehr brauchte, einfach nicht mehr anlegte oder durch Kontaktlinsen ersetzt hatte, weiß ich nicht. Die Bartstoppeln, derer er sich im fortschreitenden Alter nun doch noch erfreuen und die man aufgrund ihrer Farbe nur bei genauem Hinsehen ausmachen konnte, waren bei einem Mann in seiner Position eigentlich unerwünscht, seiner Berufung dennoch nicht von abträglicher Wirkung gewesen. Offenbar hatte er den richtigen Weg gewählt. Er war sogar der Partei beigetreten, dennoch weit davon entfernt, sich gängeln zu lassen. Er vertrat seine eigenen Überzeugungen, was wiederum den Funktionären missfallen musste. Andere hätten sich zum eigenen Wohl und dem Wohl ihres Vorankommens in die Rolle des Mitläufers gefügt, dessen Stimme derjenigen des Führungspersonals lediglich als Nachhall dient. Er tat es nicht und er hatte dafür seine Gründe, wie er mir später noch erläutern würde. Seiner Karriere tat es jedoch keinen Abbruch, da man an seiner fachlichen Qualifikation nicht vorbeikam, ohne sich selbst zu disqualifizieren.
![]()
2
Es musste wohl eine kritische Äußerung Tulöks zur Linie der Partei gewesen sein, die mir entgangen war; vielleicht war es auch nur eine, die vonseiten der innerparteilichen Geltungssucht als willkommene Gelegenheit erachtet wurde, sich in den Brennpunkt der Aufmerksamkeit der übergeordneten Führung zu rücken. Ich weiß es nicht mehr, habe es wohl damals schon nicht gewusst. Ich hatte regelmäßig wichtige Aufgaben in Berlin und verbrachte nur noch einen Teil der Zeit in Leipzig. Das »Ministerium« hingegen schien es sehr genau gewusst zu haben und der Befehl, mich der Sache anzunehmen, kam vom Genossen Minister persönlich.
Man hätte meinen können, dass solche Situationen auf andere Weise einer Lösung zugeführt werden. Nicht zur Chefsache machen, sondern still und unheimlich effizient vom Personal vor Ort. Viel bedurfte es dessen nicht: Erstens, eine Nacht, zweitens einen Nebel, drittens ein als Zivilfahrzeug getarnter dienstlicher Kleintransporter. Mit »Drittens« wurde dann bei »Erstens« eine Fahrt in den »Zweitens« unternommen und anschließend deren Zielpunkt vergessen. So oder so ähnlich. Je höher aber das Delikt, sprich der Delinquent in der sozialen Hierarchie angesiedelt war, desto schwieriger war es, eine solche Aktion ohne Erregung eines entsprechenden Aufsehens vonstattengehen zu lassen. Tulök war schließlich nicht irgendwer, sondern ein Professor mit inzwischen internationaler Anerkennung, demzufolge sogar Reisekader. Er hatte Vorträge auf internationalen Kongressen in Leningrad, Paris, Bologna und Tokio gehalten. Demnächst stand sogar Harvard auf seinem Reiseplan.
Die Sache hingegen auf sich beruhen zu lassen ging aber auch nicht. Es war November 1985. Die Vorbereitungen für den XI. Parteitag, der im Folgejahr stattfinden sollte, waren in vollem Gange; ein letzter Sturmangriff auf eine nicht zu brechende Bastion, wie sich aber erst später herausstellen würde. Für den Moment galt es, keine Widerworte zu dulden, schon gar nicht aus den eigenen Reihen. Geschlossenheit war verordnet worden.
So machte ich mich an einem kühlen Herbsttag genannten Jahres mit meinem Dienstwagen vom Typ »Wartburg« auf den Weg von der Hauptstadt in die Hochburg des sächsischen Rebellentums. Es nieselte leicht und der Wind blies totes Laub von den Bäumen, das von den Rädern der Geschichte überrollt wurde. Von dieser Metapher – daran erinnerte ich mich in dieser Situation – hatte ein Genosse mit größerem Talent im Schwafeln denn im Denken auf einer der letzten Parteiversammlungen im Hinblick auf einige »Elemente« in unserer sozialistischen Gemeinschaft mit geringer Willigkeit, aber umso höherer Ausreisewilligkeit Gebrauch gemacht. »Und wenn ein richtiger Winter kommt, ist der Baum kahl«, hatte ich darauf geantwortet und mir einige strenge Blicke von jenen eingefangen, die dasselbe dachten, es zu artikulieren aber niemals gewagt hätten.
Es sollte ein »freundschaftliches Gespräch unter Genossen« werden, so war es mir aufgetragen worden. Aus diesem Grund hatte man auch gerade mich mit dieser Aufgabe betraut; man wusste um mein Verhältnis zur Zielperson. Zwar hatte ich mich bei Tulök angemeldet, jedoch nichts über den konkreten Hintergrund des Treffens verlauten lassen. Man wollte bei ihm keinen Verdacht, geschweige denn den Wunsch erregen, sich dieser Maßnahme zu entziehen; er sollte unvorbereitet sein. Ich hingegen war bestens vorbereitet. Schon Tage vorher war eine Kommission einberufen worden, die das strategische Vorgehen auszuarbeiten hatte. Demnach sollte ich zunächst vorsichtig die persönliche Lage Tulöks sondieren, eine Liste von Argumenten vortragen, die mir von vorgesetzter Seite diktiert worden war, und den Frevler, notfalls mit Nachdruck, daran erinnern, dass alles zu unterlassen sei, was das »E« im Namen unserer Partei ins Wanken bringen könnte.
Als ich bei Tulök eintraf, war ich festzustellen gezwungen, dass er wohl doch weniger unvorbereitet war als von meinen Auftraggebern erhofft. Doch schließlich hatte er einen höheren IQ als wir alle zusammen; insofern war diese Hoffnung mit geringer Berechtigung versehen gewesen. Ausdruck fand dies in der Tatsache, dass er seine Frau angewiesen hatte, ein Nachtmahl mit einem aus Königsberger Klopsen bestehenden Hauptgang zu servieren, um dessen Status als mein Leibgericht er noch aus Studentenzeiten wusste. Es schien, als wolle er auf diese Weise meine Linientreue untergraben. Ich versuchte, mich davon nicht beeinflussen zu lassen.
»Wir müssen reden«, begann ich, als zum Abschuss der Beköstigung zwei Gläser mit einem erstklassigen Weinbrand befüllt wurden.
»Worum geht es?«, versuchte er sich den Anschein einer fehlenden Vorstellung davon zu geben, was jetzt kommen würde.
»Die Genossen in Berlin sind besorgt.«
Da die Frage »Worüber?« ausblieb, verständlicherweise, selbst dann, wenn er es nicht bereits gewusst hätte – schließlich gehörte er der echten Intelligenz an und nicht nur der sozialistischen –, sprach ich weiter:
»Es geht um deine jüngsten Äußerungen, du weißt schon. Schließlich bist du Parteimitglied und man fragt sich, ob du wirklich noch zu uns gehörst.«
Die Antwort kam verzögert, auch wenn das offensichtlich nicht daran gelegen hatte, dass er darüber hätte nachdenken müssen.
»Und wenn dem nicht so wäre?«
»Nun, ich denke, du hast eigentlich keinen Grund, dich zu beklagen. Schließlich hast du der Partei einiges zu verdanken. Dir wurden Wege eröffnet, die nur wenige gehen können. Man erwartet vielleicht nicht zu Unrecht eine gewisse Dankbarkeit.«
»Dankbar bin ich schon, das steht außer Frage.«
»Warum dann aber ein solches Verhalten? Man könnte meinen, du seiest nur Parteimitglied geworden, um deine Karriere zu sichern. Und jetzt, wo du sie gemacht hast, brauchst du uns nicht mehr.«
»Ich kann dir versichern, dass ich nicht Mitglied geworden bin, um persönlich davon zu profitieren.«
»Warum dann?«
Ich hielt mich streng an den Plan, den man mir gemacht hatte, und bis jetzt lief alles wie erhofft. Tulök würde Farbe bekennen müssen, das war das Ziel.
»Weil mich die Idee von einer gerechten Welt begeistert und weil ich an der Quelle sitzen möchte, dort, wo es Informationen aus erster Hand gibt. Ich bin aber nicht eingetreten, um mir den Mund verbieten zu lassen.«
»Diese Einstellung mag ja löblich sein, schließlich haben wir in unserem Land viel zu viele Duckmäuser und Mitläufer. Wenn du dich aber von der Ideologie unserer Partei abwendest, können wir das doch nicht tolerieren, oder?«
»Auf diese Frage habe ich gewartet«, sprach er und lächelte.
Ich bemühte mich, ernst zu bleiben. Der Genosse Minister tat das auch immer, obwohl es – wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke – meistens unfreiwillig komisch wirkte.
»Ich muss dir diese eine Frage stellen: Wie steht es um deine ideologische Einstellung, stehst du noch zum Marxismus-Leninismus oder nicht?«
»Das sind ja gleich zwei Fragen, eigentlich sogar drei«, nahm er es sehr genau. »Aber da du so offen fragst, sollst du auch eine offene Antwort bekommen.«
Er leerte sein Glas, dann kam er seinem Versprechen nach:
»Du redest wie viele andere nur von Ideologie. Ich sage dir, Ideologie ist etwas für Leute, die anderen eine Lüge für wahr verkaufen wollen. Ich lehne das ab.«
Wir waren zwar Freunde, aber jetzt geriet ich in Zorn.
»Du willst damit sagen, dass unsere Idee von einer sozialistischen oder kommunistischen Gesellschaft falsch ist?«
»Im Gegenteil. Ich will sagen, dass sie so wahr ist, dass man dafür keine Ideologie braucht.«
Ich spürte, dass sich das Gespräch in eine Richtung entwickelte, auf die man in keinem Parteilehrjahr vorbereitet worden wäre.
»Also lehnst du den Marxismus-Leninismus ab?«
Diese Frage musste ich stellen, weil der Genosse Minister darauf bestanden hatte, aber die Antwort bestätigte das Gefühl, das mich kurz zuvor überkommen hatte.
»Ich stehe zu Marx, Lenin lehne ich ab.«
Damit war der vorbereitete Plan am Ende und ich musste improvisieren. Eigentlich hätte ich mein Gegenüber bereits an dieser Stelle der Berliner Inquisition überantworten müssen, aber erstens war er noch bis vor einer Minute mein Freund gewesen, zweitens war ich so überrumpelt worden, dass meine Gedanken für einen Moment ihre Klarheit preisgaben, und drittens wollte ich, wohl aus reiner Neugier, noch seine Antwort auf meine nächste Frage hören.
»Was hast du gegen Lenin?«
»Was hast du gegen Marx?«, gab er zurück.
Der Disput lief irgendwie aus dem Ruder. Hätte ich ihn nicht so gut gekannt, ich hätte gemeint, er will mich vorführen. So aber vermutete ich, dass er nur seine intellektuelle Überlegenheit zum Ausdruck bringen wollte, indem er Absurditäten einstreute. Meine einzige Möglichkeit gegenzuhalten bestand darin, unnachgiebig zu bleiben.
»Das ist keine Antwort auf meine Frage«, bestand ich auf eine solche, die meinen geistigen Fähigkeiten angemessen war.
»Gut...