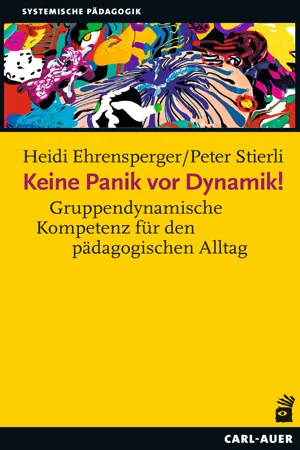![]() Gruppendynamik im Schulalltag
Gruppendynamik im Schulalltag![]()
1Konflikt in der Klasse
Konflikte haben einen schlechten Ruf.
Doch wer möchte ein Buch lesen,
das ohne einen auskommt?
Heidi Ehrensperger
Ereignis
Einmal mehr sind sich Roger und Max in die Haare geraten. Dies ist schon an den hochroten Köpfen und den Mienen der beiden ersichtlich. Zudem wurde die Klassenlehrerin, Frau Keller, bereits von ihrem Kollegen, der die Pausenaufsicht wahrnahm, über den Faustkampf auf dem Pausenplatz informiert. Obwohl er die beiden Streithähne getrennt und den Streit zu schlichten versucht hat, fliegen noch immer Beschimpfungen und Schuldzuweisungen hin und her, als Eva Keller das Schulzimmer betritt. Für ihre Mittelstufenklasse ist dies ein willkommenes Schauspiel, und die Schülerinnen und Schüler tragen mit ihren Äußerungen nichts zu einer Beruhigung bei. Frau Keller ist angesichts der Unruhe im Klassenzimmer unschlüssig, ob sie mit der geplanten Mathematiklektion beginnen oder zuerst auf den Konflikt eingehen soll. Die bevorstehende Lektion ist jedoch die letzte vor dem anstehenden Test, die sie für die Vorbereitung nutzen will. Sie hat aber auch keine Lust, zum wiederholten Mal in der Pause oder nach der Schule Zeit für eine Schlichtung und Klärung aufzuwenden.
Frau Keller meint, die Ursache der Schwierigkeiten zu kennen: Max prahlt häufig mit Erlebnissen und eckt mit seinen Behauptungen immer wieder an. Die anderen Schülerinnen und Schüler reagieren auf die offensichtlichen Unwahrheiten von Max mit höhnischen Bemerkungen und bissigen Beiträgen im Klassenchat. Mit solchen Provokationen kann Max schlecht umgehen, und es entstehen Konflikte. Es ist ihr klar, dass es nicht nur um die beiden geht; auch andere Jugendliche leisten ihren Beitrag zu diesem immer wiederkehrenden Konflikt. Die Interventionen von Eva Keller bei Vorkommnissen, die Besprechungen im Klassenrat, welche die Diskussion von Ursachen und Verhaltensmöglichkeiten beinhalten, bringen keine wirkliche Besserung. Max bleibt im Klassenverband trotz aller Bemühungen von Frau Keller ein Außenseiter.
Der gruppendynamische Raum und Außenseiterphänomene
In der Theorie des gruppendynamischen Raumes wird davon ausgegangen, dass die wechselseitigen Beziehungen innerhalb einer Gruppe von drei Bedürfnissen der einzelnen Gruppenmitglieder geprägt werden (Antons, Ehrensperger u. Milesi 2019): Zugehörigkeit, Macht/Einfluss sowie Intimität. Jede Gruppe wird sich mit diesen drei Dimensionen auseinandersetzen.
Zugehörigkeit
Hier geht es um das Grundbedürfnis jedes Individuums, mit anderen zusammen sein zu können und zu einer Gemeinschaft zu gehören. Der Klassenverband selbst definiert eine klare (System-)Grenze. Wer nicht zur Klasse gehört, ist draußen; wer dazugehört, ist drinnen. Die Gruppe kann aber, wie im Fallbeispiel beschrieben, auch ein an sich zugehöriges Mitglied ausgrenzen. Mitglied einer Klasse zu sein gibt noch nicht die Sicherheit, gemocht, gehört und akzeptiert zu werden. Zudem entstehen innerhalb einer Klasse sehr schnell Untergruppen (Subgruppen), welche sich je nach Interessen, Bedürfnissen und (oft unausgesprochenen) Normen der einzelnen Jugendlichen gegen andere Subgruppen abgrenzen. Dies kann innerhalb der Klasse zu starken Eruptionen führen, wenn z. B. andere Kinder oder Jugendliche ebenfalls zu einer dieser Untergruppen oder Cliquen gehören möchten, aber nicht zugelassen werden. »Darf ich mitspielen, kann ich beim Treffen der anderen nach der Schule oder im entsprechenden Chatroom mit dabei sein?« Stehen solche Themen – gerade bei Konflikten – im Raum, so geht es um Zugehörigkeit.
Macht/Einfluss
Jedes Mitglied einer Gruppe steht im Spannungsfeld zwischen dem Bedürfnis, eine Bedeutung in der Gruppe zu haben, und der Gefahr, wenig bewirken zu können, bedeutungslos zu sein. »Wer hört auf mich, auf wen höre ich, über wen kann ich bestimmen, und von wem lasse ich mich beeinflussen? Was muss ich tun, damit meine Bedürfnisse innerhalb der Gruppe erfüllt werden? Mit wem muss ich Koalitionen eingehen, um ein bestimmtes Ziel zu erlangen?« Oder: »Zu wem begebe ich mich in Konkurrenz?« (siehe Kap. 9) Einfluss steht zudem in einer Wechselwirkung von Geben und Nehmen; ich nehme mir Macht, die anderen geben sie mir.
Es ist klar, dass nicht alle Gruppenmitglieder gleich viel Einfluss nehmen können, vielen erscheint dies auch nicht erstrebenswert. Kommt es jedoch immer wieder zu Diskussionen oder Streitereien darüber, wer was bestimmen oder steuern kann, so spricht man von einer starken Ausprägung im Bereich Macht und Einfluss.
Intimität
Das dritte Bedürfnis beinhaltet die Frage, wem ich nahestehe und gegenüber wem ich Distanz halte. Gerade innerhalb eines Klassenverbandes gibt es viele – oft unausgesprochene – Regeln, wie Nähe und Vertrautheit ausgedrückt werden: sich gegenseitig umarmen, Begrüßungsküsschen, das Zusammenstehen in der Pause und das Verraten von Geheimnissen, das Flüstern zu zweit oder zu dritt usw. Schnell führen dabei unterschiedliche Wünsche und Abgrenzungen zu Unruhe und Konflikten im Verband. Auch hier spricht man je nach Häufigkeit des Themas von einer starken oder schwachen Ausprägung.
Die drei Dimensionen des gruppendynamischen Raumes greifen ineinander und können nicht unabhängig voneinander betrachtet werden. Die verschiedenen Bedürfnisse können als Kräfte verstanden werden, die in unterschiedliche Richtungen ziehen. Es lohnt sich zu beobachten, in welchen Dimensionen die Klasse mehr agiert.
Im Zusammenhang mit diesem Modell können nun Hypothesen zum Verhalten von Max gebildet werden.
Hypothesen
Außenseiter entstehen gemäß Ulich (2001) entweder an den Rändern der Leistungshierarchie der Klasse oder werden von den Mitschülern wegen des »wenig klassenkonformen Verhaltens abgelehnt und isoliert« (ebd., S. 64). So entstehen folgende Hypothesen:
Könnte es sein, dass …:
•Max besonders leistungsstark oder -schwach ist?
•sein von der Mehrheit der Gruppe nicht akzeptiertes Verhalten zu den Schwierigkeiten führt?
•Max in einer bestimmten Gruppe dazugehören möchte?
•etwas auf einen Machtkonflikt zwischen den beiden Streithähnen hindeutet?
•Konkurrenz bezüglich Liebschaften oder der Nähe zu anderen Schülerinnen oder Schülern besteht?
•die Untergruppen innerhalb der Klasse schon sehr fix sind?
Die folgenden Hypothesen beziehen sich auf das Außenseiterphänomen, wie es Jörg Fengler (1981) beschreibt:
•Könnte es sein, dass es der Gruppe oder Einzelnen nützt, dass der Konflikt bestehen bleibt? (Ebd., S. 110: Die Gruppe ist sich einig, dass es einen Konflikt braucht: »Die Position des Außenseiters entsteht aufgrund einer ganz bestimmten Konstellation aller Feldkräfte, die in der Gruppe herrschen, und in stiller Übereinkunft aller Gruppenmitglieder.«)
•Könnte es sein, dass es sich um einen Stellvertreterkonflikt handelt, bei dem es in Wirklichkeit noch um etwas ganz anderes in der Gesamtgruppe geht? (Ebd., S.113: »Die Gruppe wehrt eigene, nichtakzeptierte Teile ab und projiziert sie auf einen Außenseiter.«)
•Könnte es sein, dass Max bewundert wird für sein manchmal provokatives Verhalten? (Ebd., S. 114: »[…] der Außenseiter weckt Wünsche und Sehnsüchte.«) Das führt auch zur Frage, wie man sein muss, damit man (nicht) herausfällt.
Das Thema der Außenseitersituation wird auch in anderen Modellen der folgenden Kapitel wieder aufgegriffen. Aber schon hier wird deutlich, welche Vielfalt von Aspekten bei einem Konflikt zwischen Schülern eine Rolle spielen können.
Selbstverständlich bekommt die Lehrperson nicht alles mit, und das ist auch gut so. Jugendliche wollen und sollen ihre Freiräume ohne Erwachsene haben. Solange aber gegen eine bestimmte Person (oder auch gegen einen Sachverhalt) so gekämpft wird, kann man annehmen, dass innerhalb der Gruppe ein Konflikt besteht, den niemand anzugehen wagt. Deshalb sollte Eva Keller bei auftretenden Konflikten sich entsprechende Fragen stellen, um sich eine klarere Sicht bezüglich der einzelnen Aspekte des gruppendynamischen Raums zu verschaffen. Gerade im Klassenrat oder bei Diskussionen über einen Konflikt geht die Frage »Wo seht ihr die Ursachen dieses Streites?« oft verloren. Es soll keine verhärtete Situation entstehen, in der Max für alles herhalten muss. Denn: Reife Gruppen brauchen keinen Sündenbock. Der Einbezug aller Beteiligten soll auch klarstellen, dass jeder Einzelne in der Verantwortung steht.
Interventionsmöglichkeiten
Vorauszuschicken ist, dass an Schulen Gewaltanwendung nicht toleriert wird und dies auch in den Leitbildern und Schulordnungen vermerkt ist. Es ist erforderlich und oft auch präventiv wirksam, mit Regelungen ein klares Statement zu proklamieren. Kontraproduktiv und heikel ist es jedoch, feste Strafnormen festzulegen. Erstens bedarf jeder Konflikt – wie in der Darstellung des gruppendynamischen Raums und in den angeführten Hypothesen deutlich wird – einer individuellen Beurteilung, zudem schränkt das Lehrteam seinen Handlungsspielraum mit festgelegten Maßnahmen ein. Individuelle Vereinbarungen für eine Wiedergutmachung sind sinnvoller als von vornherein festgelegte Strafen (vgl. Omer u. von Schlippe 2010; Lemme u. Körner 2016; sowie Omer u. Haller 2019).
Gerade bei Konflikten mit Gewaltanwendung steht als Erstes die Deeskalation im Vordergrund. Diese Deeskalation hat der Kollege von Eva Keller bereits in einem ersten Schritt zu erreichen versucht, indem er die streitenden Jungen getrennt und für Distanz gesorgt hat. Die emotionale Erregung ist immer noch groß; eine Klärung muss deshalb warten (vgl. dazu neurobiologische Ergebnisse, Bauer 2008). Frau Keller gibt in der Klasse kund, dass sie vom ...