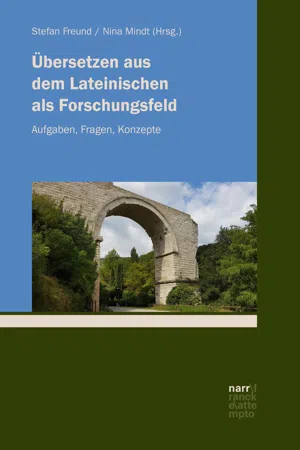a) Historische Untersuchungen zu Theorie und Praxis des Übersetzens aus dem Lateinischen
Für das Lateinische liegen bisher keine Grundlagen einer sprachspezifischen Translatologie vor. Dabei müsste die Klassische Philologie, speziell die Latinistik, an sich ein großes Interesse an Übersetzungsprozessen haben, sind solche doch für die lateinische Literatur selbst zentral. Daher ist es nicht verwunderlich, dass sich aufgrund der allgemein wachsenden Aufmerksamkeit für Übersetzungsvorgänge Untersuchungen finden, die das römische Übersetzen, und auch Reflexionen dazu, ins Zentrum stellen.1 Hier können solche Arbeiten zum Übersetzen ins Lateinische nicht näher betrachtet werden, vielmehr geht es um übersetzungsgeschichtliche Untersuchungen zum Übersetzen aus dem Lateinischen ins Deutsche.
Die historisch und kulturell ausgerichteten translation studies, allen voran die Descriptive Translation Studies, wurden als Teildisziplin spätestens seit den 2000er-Jahren immer stärker, was auch mit dem ‚translational turn‘ der Kulturwissenschaften zusammenhängt.2 Das hat zwar einerseits zu einer Ausweitung dessen geführt, was unter ‚Übersetzung‘ bzw. ‚translation‘ gefasst wird, doch auch das Übersetzen an sich, die Sprachmittlung, hat neue Aufmerksamkeit erfahren. Die Untersuchungen zu Übersetzungen antiker und somit auch lateinischer Texte haben in diesem Zusammenhang durchaus einen Aufschwung erlebt: Neben interessanten Einzeluntersuchungen ist die Tagung „Pontes V: Übersetzung als Vermittlerin antiker Literatur“ mit dem gleichnamigen Tagungsband herauszuheben.3 Und vor allem hat das Teilprojekt „Übersetzung der Antike“ des SFB 644 „Transformationen der Antike“ (2005–2016) in Berlin dort angesetzt: Zunächst wurde ein besonderer Teil der Übersetzungsgeschichte, nämlich die Theoriegeschichte, aufgearbeitet, um darzustellen, welche Überlegungen, Konzepte, Reflexionen im Zusammenhang mit dem Übersetzen aus den Alten Sprachen seit 1800 bis in die Gegenwart formuliert wurden.4 In einem zweiten Schritt wurden Übersetzungen desselben Zeitraums exemplarisch analysiert.5 Der ursprünglich geplante letzte Schritt, nämlich die Formulierung von Übersetzungsanleitungen, von präskriptiven Forderungen an eine Übersetzung, welche aus den Ergebnissen der ersten beiden Phasen abgeleitet werden sollten, wurde letztendlich nicht unternommen. Zentral an dem dort zugrunde gelegten Transformationskonzept ist, dass es, als weitergedachte und prononcierte Theorie der Rezeption, alle Formen der Anverwandlung historischer Objekte mit ihren Eigengesetzlichkeiten unter genauer Analyse der Rolle innerhalb der Zielkultur untersucht. Dabei geht es von einer grundsätzlichen Relationalität, Reziprozität und Wechselwirkung zwischen antiker Referenz- und nachantiker Aufnahmekultur aus. Im Prozess der selektiven Aneignung verändert sich der antike Referenzbereich ebenso wie die beteiligte Aufnahmekultur. Diese Wechselwirkung wird mit dem neu geprägten Zentralbegriff der ‚Allelopoiese‘ erfasst.6 Das Konzept interessiert sich somit nicht, oder allenfalls sekundär, für die ‚Richtigkeit‘ und tatsächliche Adäquatheit der verhandelten Antikebilder. In diesem Fall ist also der antike Referenzbereich der lateinische Text, das Transformationsprodukt ist die Übersetzung, die wiederum auf den Ausgangstext zurückwirkt. Über die Konsequenzen für das Übersetzen, die dieses Konzept beinhaltet, soll im abschließenden Teil nachgedacht werden. Zunächst werden konkrete historische Übersetzungsreflexionen schlaglichtartig nachskizziert.7 Dies geschieht zunächst insbesondere anhand von Friedrich Schleiermachers Ausführungen, einem Grundlagentext zum Übersetzen antiker Literatur, sowie anhand von Wolfgang Schadewaldt, da er innerhalb der Klassischen Philologie eine wichtige Größe und sein Konzept des dokumentarischen Übersetzens innerhalb des Faches bekannt ist. Zudem werden die Überlegungen von Manfred Fuhrmann dargestellt, weil er einer der wenigen Latinisten ist, die sich ausführlich mit dem Thema des Übersetzens auseinandergesetzt haben. Wilhelm von Humboldt und Ulrich von Wilamowitz Moellendorff werden dabei mitberücksichtigt, sind deren Reflexionen doch anhand antiker Texte entstanden und innerhalb des Übersetzungsdiskurses auch außerhalb der Grenzen der Klassischen Philologie bekannt.
Aus latinistischer Perspektive ist zunächst zu vermerken, dass es innerhalb – und aufgrund – des untersuchten Zeitraums meist griechische Texte gewesen zu sein scheinen, die zu einflussreichen und/oder zu auch außerhalb der engen Fachgrenzen bekannten Übersetzungsreflexionen der letzten zweihundert Jahre geführt haben: sei es Friedrich Schleiermacher mit der Akademierede Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens (1813), die durchaus konkret im Kontext seiner Erfahrungen mit der Übersetzung Platons steht, Wilhelm von Humboldt (1816) mit seiner Vorrede zu Aischylos’ Agamemnon, Ulrich von Wilamowitz-Moellendorffs Was ist übersetzen? (zuerst 1891) als Vorwort zur Übersetzung des Euripideischen Hippolytos oder Wolfgang Schadewaldts Konzept des „dokumentarischen Übersetzens“, welches Ende der 1950er- und in den 1960er-Jahren anhand von Homer und den griechischen Tragödien entwickelt wurde.8
Im Zuge des erwachten historischen Bewusstseins und somit des Bewusstseins der Andersartigkeit der Antike auf der einen Seite sowie der Griechenbegeisterung und der Vorliebe für als archaisch-ursprünglich Erachtetes auf der anderen Seite wurde dabei nicht selten der „ausgangssprachenorientierte“ Ansatz bevorzugt. Eine Ausnahme, auf die noch zurückzukommen sein wird, war natürlich Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff, dessen Übersetzungskonzept der „Metempsychose“9 zweifelsohne zielsprachenorientierte Übersetzungen favorisiert. Bei einem Durchgang durch die Übersetzungstheorie-Geschichte muss man freilich aufpassen, bei einer solchen Dichotomisierung wie ‚ausgangssprachenoriert – zielsprachenorientiert‘ nicht ganz unterschiedlich motivierte Ansichten zusammenzufassen, die eigentlich nicht wirklich identisch sind.
b) Möglichkeiten, Grenzen und Erweiterungen dichotomischer Methodendiskussion: mehr als ‚wörtlich vs . frei‘, ‚ausgangssprachen- vs. zielsprachenorientiert‘ oder ‚dokumentarisch vs. transponierend‘
Die bekannte und einflussreiche Alternative beim Übersetzen, die Friedrich Schleiermacher in seiner vielrezipierten Akademierede Ueber die verschiedenen Methoden des Uebersetzens im Jahre 1813 vor der Königlichen Akademie der Wissenschaften in Berlin formulierte, lautet folgendermaßen:1
Entweder der Uebersetzer läßt den Schriftsteller möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm entgegen; oder er läßt den Leser möglichst in Ruhe, und bewegt den Schriftsteller ihm entgegen.2
Man hat, durchaus zu Recht, hinter Schleiermachers Ausführungen immer wieder dessen eigene Platon-Übersetzung erkannt.3 Doch seine Ausführungen sind mehr als nur eine Rechtfertigung seiner eigenen Übersetzungspraxis. Schleiermacher problematisiert die von ihm abgelehnte Methode, das Bewegen des Schriftstellers, durchaus anhand eines lateinischen (!) Beispiels:
Wir können uns in einem gewissen Sinne denken, wie Tacitus würde geredet haben, wenn er ein Deutscher gewesen wäre, das heißt, genauer genommen, wie ein Deutscher reden würde, der unserer Sprache das wäre, was Tacitus der seinigen; und wohl dem, der es sich so lebendig denkt, daß er ihn wirklich kann reden lassen! Aber ob dies nun geschehen könnte, indem er ihn dieselbigen Sachen sagen läßt, die der römische Tacitus in lateinischer Sprache geredet, das ist eine andere und nicht leicht zu bejahende Frage.4
Es ist auffällig, dass Schleiermachers eigene Übersetzungsarbeit, seine konkrete Erfahrung mit dem Text Platons, in der Rede unerwähnt bleibt. Vielmehr bleibt er entweder all...