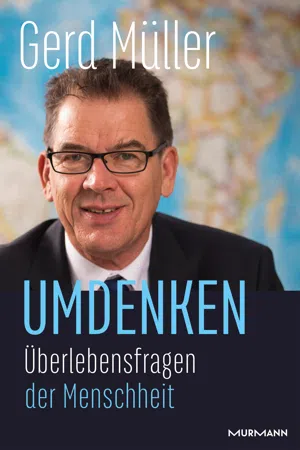![]()
KLIMASCHUTZ –
BEDROHUNG UND CHANCE
![]()
Klimaschutz – eine Überlebensfrage der Menschheit, besonders in Afrika
■China trägt 27 Prozent zum weltweiten CO2 Ausstoß bei – Deutschland 2 Prozent.
■Sollte in den nächsten 20 Jahren jeder Haushalt in Afrika und Indien Zugang zu einer Steckdose auf der Basis von Kohle erhalten, bedeutet dies circa 1000 Kohlekraftwerke.
■2017 entstanden durch dramatische Wetterkatastrophen global Schäden in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar.
■In den Permafrostgebieten der Erde werden zwischen 1300 und 1600 Gigatonnen Kohlenstoff gespeichert.
■Afrika muss der grüne Kontinent der erneuerbaren Energien und nicht der schwarze Kontinent der Kohle werden.
Der Klimaschutz ist eine Überlebensfrage der Menschheit. Die Grundfrage, mit der wir konfrontiert sind, ist die folgende: Lassen sich industrielles Wirtschaftswachstum und CO2-Emissionen entkoppeln?
Denn Wirtschaft und Wohlstand brauchen Energie. Und die ist bisher weit überwiegend fossil. Das erzeugt die CO2-Emissionen und damit das Klimaproblem. Die Dynamik der Erhöhung der CO2-Emissionen liegt in den Entwicklungs- und Schwellenländern. Diese vertreten den nachvollziehbaren Standpunkt, dass sie noch lange ihre Emissionen (pro Kopf) erhöhen dürfen, weil wir das ja auch über lange Zeit und teilweise bis heute so gemacht haben.
Die harte internationale Debatte um mehr Klima- und Umweltschutz gipfelte schon 1972 bei der Weltumweltkonferenz in Stockholm in einer aufsehenerregenden Rede der damals jungen indischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi. Sie bestand für die ärmeren Länder auf dem Primat der wirtschaftlichen Entwicklung, der dem Umweltschutz voranzustellen sei. China ist diesen Weg in den vergangenen Jahrzehnten konsequent gegangen, war damit wirtschaftlich sehr erfolgreich und hat Hunderte Millionen Menschen aus der Armut geholt. Aber der ökologische Preis ist hoch. Zwischenzeitlich ist China mit einem Anteil von 27 Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß der Hauptemittent – mehr CO2-Emissionen als die USA, Europa und Japan zusammen verursachen. Indira Gandhi hat nicht zu Unrecht darauf hingewiesen, dass der Wohlstand der reichen Länder im 19. und 20. Jahrhundert auf wenig umwelt- und klimafreundliche Weise entstanden ist. In der Tat sind historisch betrachtet die Hauptverantwortlichen für den Klimawandel die Industrieländer. Heute liegen die Entwicklungs- und Schwellenländer an der Spitze der klimaschädlichen Emissionen – unter anderem auch aufgrund der sehr großen Bevölkerung.
Bei meinem Gespräch mit dem indischen Energieminister machte mir dieser unmissverständlich klar, dass er um die rauchenden Schlote im Ruhrgebiet – den Einsatz von Kohle, Erdöl und Erdgas – als Basis des deutschen Wirtschaftswunders sehr wohl weiß. Indien liege unter zwei Tonnen CO2 pro Kopf im Vergleich zu Deutschland mit mehr als zehn Tonnen. Er könne es nicht akzeptieren, dass Deutschland, Europa und die westlichen Industrieländer nun darauf drängten, in Indien auf preiswerte Kohle und auf reichlich vorhandenes Öl als Basis der Energieversorgung und des wirtschaftlichen Aufschwungs auf dem Kontinent zu verzichten. Es sei denn, so fügte er hinzu, wir würden eine entsprechende Alternative finanzieren.
In der Tat habe ich bei meinem Besuch eine Solarpartnerschaft zwischen Deutschland und Indien auf den Weg gebracht und dem Minister symbolisch für seinen Schreibtisch ein solarbetriebenes Windrad geschenkt. Die Frage ist aber, ob und wie klimaneutrales Wirtschaftswachstum nicht nur in Deutschland, sondern in den Schwellen- und Entwicklungsländern in Afrika, Indien und Asien möglich ist. Die Kosten werden jedenfalls erheblich sein. Wir können das nicht allein aus dem deutschen Entwicklungsetat bezahlen. Selbst wenn er verdoppelt oder verdreifacht würde.
Blicken wir auf den afrikanischen Kontinent. Afrikas CO2-Emissionen sind mit circa einer Milliarde Tonnen vergleichsweise niedrig. Dabei ist zu beachten, dass allein auf Südafrika 350 Millionen Tonnen (massiver Kohleeinsatz, auch zur Produktion von Benzin) und auf Nigeria (durch massive Erdgasverbrennung) 100 Millionen Tonnen entfallen. Doch dies wird nicht so bleiben. Ein mögliches Szenario zeichnet sich ab. Indien und Afrika werden bis 2050 zusammen auf circa vier Milliarden Menschen anwachsen. Sollte sich, bedingt durch eine steigende wirtschaftliche Entwicklung, die diesen Staaten nicht zu verwehren ist, ein Anstieg auf durchschnittlich 3,5 Tonnen CO2 pro Kopf ergeben, würde dies einen Zuwachs von zehn Milliarden Tonnen CO2 entsprechen, in etwa dem dreifachen Emissionspotenzial der heutigen EU. Unsere deutschen Einsparziele bis 2050 würden nicht einmal einem Fünfundzwanzigstel des Zuwachses in Indien und Afrika entsprechen. Nach allem, was wir wissen, ist dieses Szenario derzeit realistisch. Erhebungen zeigen, dass weltweit die derzeit 120 größten Unternehmen im Sektor Kohle insgesamt 945 Projekte an über 450 Standorten planen. Weder China noch Indien und auch nicht die afrikanischen Staaten planen einen kurzfristigen Ausstieg oder Verzicht auf Kohle und Öl als Basis der Energieproduktion für eine wachsende Bevölkerung und wachsende Wirtschaft. Und die USA tun dies genauso wenig.
Die Beispiele zeigen, dass wir mit dem Pariser Vertrag noch längst nicht am Ende der Klimadebatte angekommen sind. Es muss entschieden mehr passieren als das, was im Pariser Klimaabkommen vereinbart werden konnte. Ganz klar ist, dass wir als Industrieländer mit hohen Pro-Kopf-Emissionen ehrgeizig vorangehen und die Vorgaben des Klimaabkommens einhalten müssen. Wie schwierig allein das schon ist, zeigt die Debatte um die Umsetzung des deutschen Klimaschutzgesetzes in den einzelnen Sektoren.
Aber es muss noch viel mehr passieren. Wir müssen Lösungskonzepte international auf den Weg bringen. Allein um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, müssten die weltweiten Emissionen bis 2030 um 45 Prozent gegenüber 2010 sinken. Ohne einschneidende Maßnahmen in China, Indien und auf dem afrikanischen Kontinent ist dies nicht zu erreichen. Notwendig sind in jedem Fall massive Investitionen in den Aufbau erneuerbarer Energien in Afrika, Indien und den Schwellenländern. Aber wer soll das bezahlen? Allen voran muss Afrika der grüne Kontinent erneuerbarer Energien, der Nutzung der Sonne, des Wassers und der Biomasse werden.
Aktuell aber haben mehr als 600 Millionen Menschen in Afrika keinen Zugang zu Strom. Dies ist ein massives Defizit in Bezug auf die Umsetzung der Menschenrechte. Ein massiver Ausbau der Kapazitäten ist geplant und unter Aspekten der Menschenwürde auch geboten. Sollte in den nächsten 20 Jahren jeder Haushalt in Afrika und Indien Zugang zu einer Steckdose und damit Anschluss an Elektrizität erhalten, bedeutet dies auf der Basis von Kohle circa 1000 neue Kohlekraftwerke.
Der beeindruckende wirtschaftliche und zugleich sehr ressourcenintensive Aufschwung, der China gelang, ist für viele ärmere Staaten, insbesondere auch in Afrika, ein Vorbild. Dieser Aufschwung ist aber klimaverträglich nicht möglich – so wenig wie in China. Dabei dürfen wir nicht nur auf den Energiesektor schauen, sondern müssen auch die steigende Mobilität, die Entwicklungen in der Landwirtschaft und die neu entstehende Infrastruktur in indischen und afrikanischen Städten mit in Betracht ziehen. Auch hier kann China nicht das Vorbild sein. In chinesischen Städten wurde allein innerhalb der letzten Jahre mehr klimaschädlicher Beton verbaut als in den USA im gesamten 20. Jahrhundert. Auf dem afrikanischen Kontinent wird in den nächsten zehn Jahren so viel gebaut werden wie in ganz Europa in den vergangenen 100 Jahren. Die Beispiele zeigen die enormen Herausforderungen, die sich im Energie- und Klimasektor stellen.
Die Lösung der Energie- und Klimafrage ist deshalb weltweit auf das Engste mit unserem Nachbarkontinent Afrika verbunden. Die Afrikaner sind aufgeschlossen, erwarten aber ganz klar Unterstützung und Investitionen der Industrieländer in ihre Infrastruktur und Energiewirtschaft.
Schon heute sind die Menschen in Afrika die Hauptleidtragenden des Klimawandels. Die Konflikt- und Krisenlage in der Sahelregion geht auch auf die Veränderung des Klimas zurück. Dürre, Hitze, Wasserknappheit führten zu noch mehr Elend, Not und Hunger. Schätzungsweise bis zu 20 Millionen Menschen in der Region haben ihre Existenzgrundlage verloren. Und bis zu 100 Millionen Menschen sind in Subsahara-Afrika, Lateinamerika und Südasien existenziell bedroht, weitere 100 Millionen Menschen in Küsten- und Dürregebieten durch Hitze und Meeresanstieg unmittelbar gefährdet.
Allein 2017 entstanden durch schwerste Wetterkatastrophen global Schäden in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar. Als Folge der Erderwärmung zeichnet sich in vielen Regionen eine Verknappung der Wasserversorgung ab. Das Abschmelzen der Gletscher, vor allem in der Himalayaregion, könnte unabsehbare Auswirkungen haben. Konflikte zwischen China, Indien und Pakistan, ebenso zwischen Äthiopien, dem Sudan und Ägypten sind denkbar. Hinzu kommt, dass in den Gletschergebieten des Himalayas, in der Kaschmirregion und auf dem tibetischen Plateau zwölf der größten Flüsse der Erde entspringen, darunter Indus, Ganges, Brahmaputra und Jangtse. Mehr als zwei Milliarden Menschen in Indien, Pakistan, China beziehen ihr Wasser über diese Flüsse.
Auch in Spitzbergen wurde ich Zeuge des Abschmelzens von Eispanzern in der Arktis, das als Folge neue Ressourcen verfügbar macht, um die es bereits jetzt heftige Auseinandersetzungen gibt. Eine freie Nord-Ost-Passage für die Schifffahrt könnte die Handelsströme gewaltig verändern und würde neue Gewinner und Verlierer erzeugen. Russland, Mitunterzeichner des Pariser Klimaschutzabkommens, ist aufgrund seiner Größe und Lage dabei ein Hauptakteur.
Russland hat das Pariser Klimaschutzabkommen ratifiziert. Bei meinen Gesprächen im Kreml wurde insbe...