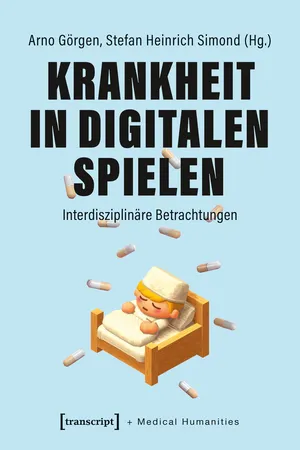
eBook - ePub
Krankheit in Digitalen Spielen
Interdisziplinäre Betrachtungen
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Krankheit in Digitalen Spielen
Interdisziplinäre Betrachtungen
Über dieses Buch
Krankheit in digitalen Spielen hat viele Facetten – egal ob psychisch oder somatisch. Ihre Darstellung fußt dabei auf Prozessen, die gesellschaftliches Wissen zu Krankheiten aufgreifen und gemäß der Eigenlogik digitaler Spiele verändern. Ästhetik, Narration und Spielmechanik partizipieren so an Kämpfen um Deutungshoheiten zwischen der Tradierung stigmatisierender Krankheitsvorstellungen einerseits und selbstreflexivem Empowerment andererseits. Die Beiträger*innen dieses ersten Sammelbandes zum Thema widmen sich theoretischen, analytischen und praktischen Fragestellungen rund um die Bedeutungsvielfalt von Krankheitskonstruktionen in digitalen Spielen aus interdisziplinärer Perspektive.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Krankheit in Digitalen Spielen von Arno Görgen, Stefan Heinrich Simond, Arno Görgen,Stefan Heinrich Simond im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Literaturkritik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
SozialwissenschaftenThema
LiteraturkritikII.Wahn|Sinn – Psychische Krankheiten in digitalen Spielen
Psychiatrische Kliniken als totale Institutionen in digitalen Spielen
Abstract: Time and time again derelict psychiatric institutions and rogue inmates serve as settings and antagonists in cultural narratives, and digital games are no exception. The eeriness of exploring what Erving Goffman calls ›total institutions‹ and the tension of being confronted with the mentally ill orchestrate a persistent conflict between madness and reason. How this conflict is constructed on a narrative, aesthetic, and ludic level is the central focus of this article. The perspective applied leans heavily on discourse analysis to give a brief overview of contemporary ideas on mental illness and psychiatric institutions. Theoretically founded in Erving Goffman’s concept of total institutions, Outlast (Red Barrels, 2013) and The Town of Light (LKA, 2016) are comparatively interpreted, concluding in the assumption that the perspective of both titles, while differing considerably, construct mirroring glances on psychiatric institutions and the madness within
Keywords: Mental Illness; Total Institution; Psychiatry; Digital Games; Game Studies
Schlagworte: Psychische Krankheit; Totale Institution; Psychiatrie; Digitale Spiele; Game Studies
1.Einleitung
Die schier endlosen Korridore psychiatrischer Institutionen sind ein etabliertes Setting kultureller Erzählungen.1 Das Horror-Genre scheint aus dem Unbehagen der Psychiatrie und ihrer Geschichte stets neue Inspiration zu ziehen, weshalb die Texte – seien sie literarisch, filmisch, theatralisch oder spielerisch – ein umfangreiches Korpus bilden. Während die akademische Auseinandersetzung mit der Konstruktion psychischer Krankheiten2 und ihrer Institutionen in Literatur und Film reichhaltig ist, fliegen digitale Spiele bislang überwiegend unter dem Radar analytischer Aufmerksamkeit.
Dieser Beitrag begegnet jenem Desiderat mit einer qualitativen, komparativen Textanalyse. Vor dem Hintergrund theoretischer Ansätze von Erving Goffman und Michel Foucault, welche die kulturphilosophische und soziologische Auseinandersetzung mit psychischen Krankheiten und ihren Institutionen maßgeblich vorantrieben, wende ich mich den Titeln Outlast (Red Barrels, 2013) und The Town of Light (LKA, 2016) zu, um die nachfolgenden Fragen zu beantworten: Wie werden psychische Krankheiten und psychiatrische Institutionen in beiden Titeln konstruiert und worin unterscheiden sich jene Konstruktionen? Welchen Anteil haben spezifisch ludische Elemente an der Konstruktion psychischer Krankheit? Und welche Schlussfolgerungen lassen sich anhand der Konstruktion psychiatrischer Kliniken für das gesellschaftliche Bild der Institutionen und ihrer Insassen ziehen? Wie aus den Fragen augenscheinlich hervorgeht, sind die beiden Titel bewusst gewählt, um den Kontrast zwischen verschiedenen Perspektiven auf psychiatrische Institutionen im Kontext digitaler Spiele herauszuarbeiten.
Zum Zwecke der theoretischen Vorarbeit werden zunächst das zugrunde liegende Krankheitsbild und die Relevanz der Moral für jenes erläutert. Anschließend folgt ein Überblick über den Forschungsstand zur medialen Konstruktion psychischer Krankheiten und über den Anti-Stigma-Diskurs. Ein Blick auf die Praxis der Psychiatrie in der Moderne dient sodann der Illustration des historischen Kontextes. In einer Auseinandersetzung mit dem Konzept der ›totalen Institution‹ von Erving Goffman werden Begriffe und Annahmen für die anstehende Analyse geschärft. Im Zuge der Analyse werden zunächst die narrativen, ästhetischen und ludischen Spezifika der beiden Titel Outlast und The Town of Light hinsichtlich ihrer Konstruktion psychiatrischer Institutionen herausgearbeitet und im abschließenden Fazit zur Beantwortung oben aufgeführter Fragen zusammengeführt.
2.Die (Un-)Trennbarkeit von Krankheit und Moral
Von der vermeintlichen Versündigung kranker Menschen im Mittelalter über die strafende Internierung des 19. Jahrhunderts bis zur Selbstverantwortlichkeit der Gesunderhaltung im Neoliberalismus erscheint eines evident: Krankheit und Moral sind voneinander nicht zu trennen (Góralczyk 2014; Franke 2012, 16, 68; Foucault 1961/2015, 130). Ob Gesundheit als religiöse Pflicht gegenüber Gott, moralische Pflicht gegenüber sich selbst oder als soziale Pflicht gegenüber der Gemeinschaft gedacht wird; ihr Gegenteil bleibt stets ein soziales Ereignis (Franke 2012, 55-56; Dross und Metzger 2018; Jaspers 1920, 4ff.). Diese normativistische Position geht davon aus, dass Gesellschaften diejenigen Phänomene als ›krank‹ attribuieren, welche den Norm- und Idealvorstellungen nicht entsprechen, die ihrerseits Teil und Ergebnis diskursiver Prozesse sind3 (Dross und Metzger 2018; Franke 2012, 27; Boorse 1975, 50-51). Somit ist Krankheit kaum rein medizinisch oder gar quantitativ-empirisch, sondern stets auch als soziales, kulturelles, historisches und nicht zuletzt moralisches Phänomen denkbar (Dross und Metzger 2018; Franke 2012, 35).
Ein biopsychosoziales Krankheitsmodell, welches auch diesem Beitrag zugrunde liegt, integriert deshalb das komplexe Zusammenwirken verschiedener Faktoren: Die funktionalistischen Operationen des Organismus, die subjektive Krankheitserfahrung und die sozialen Kontexte (Franke 2012, 130-132; Egger 2015). In der anhaltenden Debatte um Medikalisierungsprozesse4 kommt psychischen Krankheiten dabei eine besondere Rolle zu, insofern diese unmittelbar die Persönlichkeit im Verhältnis zu ihrer sozialen Umwelt und damit den Ursprung moralischer Verantwortung betreffen (Boorse 1975, 66). Demnach wird über das Instrument medikaler Diagnostik und Therapie eine Form biopolitischer Kontrolle über Formen der Devianz ausgeübt (Conrad und Schneider 1992). So attestiert etwa Michel Foucault den Frühformen psychiatrischer Diagnostik im 18. Jahrhundert eine Definition des Wahnsinns5 als »[…] psychologische Wirkung eines moralischen Fehlers« (Foucault 1961/2015, 306). Aus der Annahme, dass psychische Krankheit und Moral historisch in besonders engen Bezug zueinander gestellt wurden, ergeben sich Konsequenzen für die Analyse medialer Konstruktionen, die im Zuge einer Eruierung des Forschungsstandes im nächsten Abschnitt beleuchtet werden.
3.Mediale Konstruktionen und der Anti-Stigma-Diskurs
Seit den 1990er Jahren ist eine zunehmende Sensitivität gegenüber stigmatisierenden Konstruktionen psychischer Krankheit in den Medien zu beobachten. Dies ist eine Entwicklung, die sowohl dem Einsatz von Awareness-Kampagnen Betroffener als auch der analytischen Aufmerksamkeit seitens des akademischen Feldes zu verdanken ist (Harper 2016, 460-461). Da sich die Stigmatisierung psychisch kranker Menschen beträchtlich auf deren Umgang mit der Krankheit niederschlagen kann,6 ist von einer moralischen Verantwortung der Gesellschaft auszugehen, Stigmatisierung zu vermeiden und zu dekonstruieren, um den Leidensdruck Betroffener zu mindern (Klein und Lemish 2008, 434-435, 444; Mahar 2013). Während die Errungenschaften bisheriger Auseinandersetzungen mit der Konstruktion psychischer Krankheiten in den Medien keinesfalls gering geschätzt werden sollen, gilt es dennoch initial die Ergebnisse und Prämissen des Anti-Stigma-Diskurses aufzugreifen und zu modifizieren.
Die negativen und positiven Stereotype psychischer Krankheiten, die seitens zahlreicher fiktionaler Erzählungen in verschiedenen Medien reproduziert werden, sind reichhaltig beschrieben. Zwischen dem ›homicidal maniac‹ und dem ›specially gifted genius‹ entfaltet sich ein breites Spektrum von Oberflächlichkeiten, denen folgend die fiktionalen Figuren zuvorderst psychisch krank sind und, wenn überhaupt, nur sekundär eine differenziertere Charakterzeichnung aufweisen.7 Die spezifische Auseinandersetzung mit digitalen Spielen ist dabei selten und erst in den letzten Jahren zu verzeichnen.8 Sowohl für digitale Spiele als auch für das erweiterte Korpus der Konstruktion psychischer Krankheit in den Medien ist augenscheinlich, dass psychische Krankheiten besonders häufig mit gewalttätigem Verhalten korrelieren: »The media in all of their forms often present the mentally ill as violent.« (Harper 2016, 466; vgl. auch Signorielli 1989) Prototypisch wird dies anhand des/der wahnsinnigen Antagonist_in deutlich (Mahar 2013).
Doch es sind beileibe nicht nur psychisch kranke Menschen, die von stigmatisierenden Repräsentationen betroffen sind, sondern auch deren soziales Umfeld, insbesondere im Kontext psychiatrischer Institutionen. Auf die kulturelle Ubiquität der Horror-Psychiatrie wurde eingangs bereits hingewiesen und es ist aufgrund der Geschichte der Psychiatrie (vgl. Kapitel 4) wenig verwunderlich, dass das Horror-Genre die Psychiatrie als Setting stetig wiederkehrend aufgreift (Mahar 2013). Von stigmatisierenden Konstruktionen betroffen sind in diesem Zuge sowohl die Mitarbeiter_innen psychiatrischer Institutionen – zuvorderst Psychiater_innen9, die nicht selten als sadistisch und ›pervers‹ figuriert sind – als auch diverse Therapieformen wie die Elektrokonvulsionstherapie10 (EKT) und die transorbitale Lobotomie, deren therapeutischer Zweck hinter ihre Funktion als Straf- und Folterinstrument zurücktritt (Klein und Lemish 2008, 439, 441).
Im Zuge analytischer Auseinandersetzungen neigt der Anti-Stigma-Diskurs allerdings nicht selten dazu, die Diversität der Popkultur zu unterschätzen. Besonders deutlich wird dies immer dann, wenn Realismus – unmittelbar gekoppelt an normative Urteile – zur leitenden analytischen Kategorie wird. Konkret ist die Annahme gemeint, dass die fiktionalen Konstruktionen psychischer Krankheiten in kulturellen und künstlerischen Texten letztlich daran zu messen sind, wie sehr sie dem Kenntnisstand der psychiatrischen Forschung bzw. dem alltäglichen Erleben von Betroffenen entsprechen. Die Fixation auf ›realistische Repräsentationen‹ hat zweifelsohne ihre Berechtigung; letztlich sind es oftmals Missrepräsentationen und Mythen, welche zur Stigmatisierung psychisch Kranker beitragen (Harper 2016, 461). Die Kunst kann sich aber auch Überformungen und Abstraktionen bedienen, deren Bedeutungsebenen vielfältig sind. Realismus als Maßstab anzulegen, kommt dann einer Verkürzung gleich, welche die Polysemie fiktionaler Texte vernachlässigt (Middleton 2016, 185; Stollfuß 2018; Harper 2016, 460, 476-477).
Aus jener Kritik resultiert ein Desiderat, zu dessen Aufarbeitung dieser Artikel beitragen soll. Klein und Lemish (2008, 437, 444) stellen etwa heraus, dass es auffallend wenige Produktionsstudien zur Konstruktion psychischer Krankheiten in den Medien gibt. Um der Limitierung des Textumfanges gerecht zu werden, entfallen jene Anteile jedoch für diesen Beitrag. Middleton (2016, 187) und Harper (2016, 475) unterstreichen überdies die Notwendigkeit, spezifische ästhetische Aspekte der Konstruktion psychischer Krankheit in der Analyse zu berücksichtigen: »In considering media images of madness, it may be time for critics to consider more detailed and tightly focused studies of media texts that seek to reveal their narrative, generic and formal complexities.« (Harper 2016, 478)
Diesen Überlegungen folgend geht die hier vorgestellte Analyse den Realitätsbezügen der Texte nur nach, insofern sie explizit sind. Realismus und Authentizität werden nicht als normativer Indikator für ›gelungene‹ Konstruktionen angelegt. Überdies wird nachfolgend darauf verzichtet, fiktionalen Figuren Diagnosen zuzuschreiben, insofern diese nicht im Text selbst expliziert werden. Die fiktionalen Konstruktionen entsprechen realen Krankheiten nicht unbedingt und sie müssen es auch nicht, um ihr Bedeutungspotenzial zu entfalten.
4.Die Praxis der modernen Psychiatrie
Auf den wenigen Seiten dieses Beitrages ist es selbstredend unmöglich, die facettenreiche und mithin diffuse Geschichte der psychiatrischen Internierung zu illustrieren. Sowohl für das Verständnis der nachfolgenden Beobachtungen von Goffman als auch für die komparativen Analysen sind jedoch einige Anmerkungen erforderlich, welche die historische Situation der Psychiatrie im 20. Jahrhundert verdeutlichen. Nicht umsonst zeigt sich an den Internierungshäusern, so Foucault, wie die Moral zu einem Akt staatlicher Verwaltung wird (Foucault 1961/2015, 94-95).
Die Psychiatrie als Institution blickt auf eine lange Geschichte zurück, etwa mit der Eröffnung des Bethlehem Hospital in London im Jahre 1247; eine Institution, die als »longest continuing mental hospital in Europe« bezeichnet wird (Braddock und Parish 2001, 19). Von der Isolierung und Kriminalisierung psychisch kranker Menschen11 im Z...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Digitale Spiele für die Medical Humanities – Geleitwort
- Krankheiten in digitalen Spielen – Einleitung
- I. Theorien
- II. Wahn|Sinn – Psychische Krankheiten in digitalen Spielen
- III. Bioschocker – Somatische Krankheiten in Games
- IV. Games for Health
- Zu den Autoren