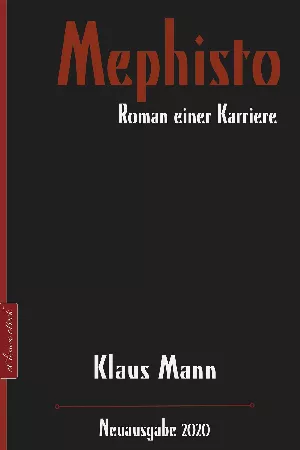
- 298 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Klaus Mann: Mephisto - Roman einer Karriere | Neu editierte Ausgabe 2020Der Roman zeichnet das Leben des fiktiven Schauspielers Hendrik Höfgen, der in jungen Jahren für kommunistische Ideen schwärmt, sich aber später, als die Nationalsozialisten in Deutschland die Macht übernehmen, aus Karrieredrang, Eitelkeit und Geltungssucht von diesen vereinnahmen und protegieren lässt. Am Ende wird er, blind geworden für die Schandtaten der Nazis, zum willfährigen Unterstützer des Terrorregimes. | Wegen deutlicher Parallelen zum Schauspieler Gustaf Gründgens und einem Rechtsstreit mit einem Gründgens-Erben konnte das Werk bis 1981 in Deutschland nicht legal publiziert werden. © Redaktion eClassica, 2020Über den Autor: Klaus Mann war der älteste Sohn des Schriftstellers Thomas Mann, geboren als dessen zweites Kind nach Schwester Erika, am 18. November 1906 in München. Von einem leichtfertigen, selbstbezogenen und bohéme-artigen Nachwuchsschriftsteller, der im Schatten seines berühmten Vaters stand, entwickelt er sich im Lauf der Jahre zu einem der wichtigsten Kritiker der Nazi-Diktatur im Exil. Er arbeitet für im Ausland publizierte Widerstandsblätter und geht in den USA auf Vortragsreisen, um das Bild eines "anderen", humanen Deutschland zu vermitteln. Am 21. Mai 1949 starb er in Cannes nach einer Überdosis Schlaftabletten.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Information
Thema
LiteraturThema
Europäisches Drama1 – H. K.
In den letzten Jahren des Weltkrieges und in den ersten Jahren nach der Novemberrevolution hatte das literarische Theater in Deutschland eine große Konjunktur. Um diese Zeit erging es auch dem Direktor Oskar H. Kroge glänzend, den schwierigen Wirtschaftsverhältnissen zum Trotz. Er leitete eine Kammerspielbühne in Frankfurt am Main: In dem engen, stimmungsvoll intimen Kellerraum traf sich die intellektuelle Gesellschaft der Stadt und vor allem eine angeregte, von den Ereignissen aufgewühlte, diskussions- und beifallsfreudige Jugend, wenn es die Neuinszenierung eines Stückes von Wedekind oder Strindberg gab oder eine Uraufführung von Georg Kaiser, Sternheim, Fritz von Unruh, Hasenclever oder Toller. Oskar H. Kroge, der selbst Essays und hymnische Gedichte schrieb, empfand das Theater als die moralische Anstalt: Von der Schaubühne sollte eine neue Generation erzogen werden zu den Idealen, von denen man damals glaubte, dass die Stunde ihrer Erfüllung gekommen sei – zu den Idealen der Freiheit, der Gerechtigkeit, des Friedens. Oskar H. Kroge war pathetisch, zuversichtlich und naiv. Am Sonntagvormittag, vor der Aufführung eines Stückes von Tolstoi oder von Rabindranath Tagore, hielt er eine Ansprache an seine Gemeinde. Das Wort »Menschheit« kam häufig vor; den jungen Leuten, die sich im Stehparkett drängten, rief er mit bewegter Stimme zu: »Habet den Mut zu euch selbst, meine Brüder!« – und er erntete Beifallsstürme, da er mit den Schillerworten schloss: »Seid umschlungen, Millionen!«
Oskar H. Kroge war sehr beliebt und angesehen in Frankfurt am Main und überall dort im Lande, wo man an den kühnen Experimenten eines geistigen Theaters Anteil nahm. Sein ausdrucksvolles Gesicht mit der hohen, zerfurchten Stirn, der schütteren, grauen Haarmähne und den gutmütigen, gescheiten Augen hinter der Brille mit schmalem Goldrand war häufig zu sehen in den kleinen Revuen der Avantgarde; zuweilen sogar in den großen Illustrierten. Oskar H. Kroge gehörte zu den aktivsten und erfolgreichsten Vorkämpfern des dramatischen Expressionismus.
Es war ohne Frage ein Fehler von ihm gewesen – nur zu bald sollte es ihm klar werden – sein stimmungsvolles kleines Haus in Frankfurt aufzugeben. Das Hamburger Künstlertheater, dessen Direktion man ihm im Jahre 1923 anbot, war freilich größer. Deshalb akzeptierte er. Das Hamburger Publikum aber erwies sich als längst nicht so zugänglich dem leidenschaftlichen und anspruchsvollen Experiment wie jener zugleich routinierte und enthusiastische Kreis, der den Frankfurter Kammerspielen treu gewesen war. Im Hamburger Künstlertheater musste Kroge, außer den Dingen, die ihm am Herzen lagen, immer noch den ›Raub der Sabinerinnen‹ und ›Pension Schöller‹ zeigen. Darunter litt er. Jeden Freitag, wenn der Spielplan für die kommende Woche festgesetzt wurde, gab es einen kleinen Kampf mit Herrn Schmitz, dem geschäftlichen Leiter des Hauses. Schmitz wollte die Possen und Reißer angesetzt haben, weil sie Zugstücke waren; Kroge aber bestand auf dem literarischen Repertoire. Meistens musste Schmitz, der übrigens eine herzliche Freundschaft und Bewunderung für Kroge hatte, nachgeben. Das Künstlertheater blieb literarisch – was seinen Einnahmen schädlich war.
Kroge klagte über die Indifferenz der Hamburger Jugend im besonderen und über die Ungeistigkeit einer Öffentlichkeit im allgemeinen, die sich allem Höheren entfremdet habe. »Wie schnell es gegangen ist!« stellte er mit Bitterkeit fest. »Im Jahre 1919 lief man noch zu Strindberg und Wedekind; 1926 will man nurmehr Operetten.« Oskar H. Kroge war anspruchsvoll und übrigens ohne prophetischen Geist. Hätte er sich beschwert über das Jahr 1926, wenn er sich hätte vorstellen können, wie das Jahr 1936 aussehen würde? – »Nichts Besseres zieht mehr«, grollte er noch. »Sogar bei den ›Webern‹ gestern ist das Haus halb leer gewesen.«
»Immerhin kommen wir doch zur Not noch auf unsere Rechnung.« Direktor Schmitz bemühte sich, den Freund zu trösten: Die Kummerfalten in Kroges gutmütigem und kindlich-altem Katergesicht taten ihm weh, wenngleich er doch selber allen Grund zur Sorge und auch schon mehrere Falten hatte in seiner feisten, rosigen Miene.
»Aber wie!« Kroge wollte sich durchaus nicht trösten lassen. »Aber wie kommen wir denn auf unsere Rechnung! Berühmte Gäste aus Berlin müssen wir uns einladen – so wie heute Abend – damit die Hamburger ins Theater gehen.«
Hedda von Herzfeld – Kroges alte Mitarbeiterin und Freundin, die schon in Frankfurt Dramaturgin und Schauspielerin bei ihm gewesen war – bemerkte: »Du siehst wieder mal alles schwarz in schwarz, Oskar H.! Es ist ja schließlich keine Schande, Dora Martin gastieren zu lassen – sie ist wundervoll – und übrigens kommen unsere Hamburger auch, wenn Höfgen spielt.« Während sie Höfgens Namen aussprach, lächelte Frau von Herzfeld klug und zärtlich. Über ihr großes, matt gepudertes Gesicht mit der fleischigen Nase, den großen, goldbraunen, wehmütig intelligenten Augen ging ein bescheidenes Aufleuchten.
Kroge sagte brummig: »Höfgen wird überzahlt.«
»Die Martin übrigens auch«, fügte Schmitz hinzu. »Ihren ganzen Zauber in Ehren und zugegeben, dass sie ungeheuer zieht, aber tausend Mark Abendgage, das ist doch wohl ein bisschen toll.«
»Berliner Staransprüche«, machte Hedda spöttisch. Sie hatte in Berlin nie zu tun gehabt und behauptete, den Betrieb der Hauptstadt zu verachten.
»Tausend Mark im Monat für Höfgen ist auch übertrieben«, behauptete Kroge, plötzlich gereizt. »Seit wann hat er denn eigentlich tausend?« fragte er herausfordernd Schmitz. »Es sind doch immer nur achthundert gewesen, und das war reichlich genug.«
»Was soll ich machen?« Schmitz entschuldigte sich. »Er ist zu mir ins Büro gesprungen, und er hat sich mir auf den Schoß gesetzt.« Frau von Herzfeld konnte mit Belustigung feststellen, dass Schmitz etwas rot wurde, während er dies erzählte. »Er hat mich am Kinn gekitzelt und hat immer wieder gesagt: ›Tausend Mark müssen es sein! Tausend, Direktorchen! Es ist eine so schöne runde Summe!‹ Was sollte ich da machen, Kroge? Sagen Sie selbst!«
Es war Höfgens schlaue Gewohnheit, wie ein nervöser kleiner Sturmwind in Schmitzens Büro zu fahren, wenn er Vorschuss oder Gagenerhöhung wollte. Zu solchen Anlässen spielte er den übermütig Launischen und Kapriziösen, und er wusste, dass der ungeschickte dicke Schmitz verloren war, wenn er ihm die Haare zauste und den Zeigefinger munter in den Bauch stieß. Da es sich um die Tausend-Mark-Gage handelte, hatte er sich ihm sogar auf den Schoß gesetzt: Schmitz gestand es unter Erröten.
»Das sind Albernheiten!« Kroge schüttelte ärgerlich das sorgenvolle Haupt. »Überhaupt ist Höfgen ein grundalberner Mensch. Alles an ihm ist falsch, von seinem literarischen Geschmack bis zu seinem sogenannten Kommunismus. Er ist kein Künstler, sondern ein Komödiant.«
»Was hast du gegen unseren Hendrik?« Frau von Herzfeld zwang sich zu einem ironischen Ton; in Wahrheit war ihr keineswegs nach Ironie zumute, wenn sie von Höfgen sprach, für dessen geübte Reize sie nur zu empfänglich war. »Er ist unser bestes Stück. Wir können froh sein, wenn wir ihn nicht an Berlin verlieren.«
»Ich bin gar nicht so besonders stolz auf ihn«, sagte Kroge. »Er ist doch nicht mehr als ein routinierter Provinzschauspieler, und das weiß er übrigens im Grunde selbst ganz genau.«
Schmitz fragte: »Wo steckt er denn heute Abend?« – worauf Frau von Herzfeld leise durch die Nase lachte: »Er hat sich in seiner Garderobe hinter einem Paravent versteckt – der kleine Böck hat es mir erzählt. Er ist immer furchtbar aufgeregt und eifersüchtig, wenn Berliner Gäste da sind. So weit wie die werde er es niemals bringen, sagt er dann – und versteckt sich hinter einem Paravent, vor lauter Hysterie. Die Martin bringt ihn wohl besonders aus der Fassung, das ist so eine Art von Hassliebe bei ihm. Heute Abend soll er schon einen Weinkrampf gehabt haben.«
»Da seht ihr seinen Minderwertigkeitskomplex!« rief Kroge und schaute triumphierend um sich. »Oder vielmehr: dass er im Grunde irgendwo die richtige Einschätzung hat für sich selber.«
Die drei saßen in der Theaterkantine, die, nach den Initialen des Hamburger Künstlertheaters, kurz »H.K.« genannt wurde. Über den Tischen mit den fleckigen Tüchern gab es eine verstaubte Bildergalerie: die Photographien all jener, die sich im Lauf der Jahrzehnte hier produziert hatten. Frau von Herzfeld lächelte während des Gespräches manchmal hinauf zu den Naiven und Sentimentalen, den komischen Alten, Heldenvätern, jugendlichen Liebhabern, Intriganten und Salondamen, die von Schmitz und Kroge übersehen wurden.
Drunten, im Theater, spielte Dora Martin, die mit ihrer heiseren Stimme, der verführerischen Magerkeit des ephebischen Körpers und den tragisch weiten, kindlichen und unergründlichen Augen das Publikum der großen deutschen Städte verhexte, einen Reißer zu Ende. Die beiden Direktoren und Frau von Herzfeld hatten nach dem zweiten Akt ihre Loge verlassen. Die übrigen Mitglieder des Künstlertheaters waren im Saal geblieben, um der Berliner Kollegin, die sie halb bewunderten und halb hassten, bis zum Schluss zuzusehen.
»Das Ensemble, das sie sich mitgebracht hat, ist ja wirklich unter jeder Kritik«, stellte Kroge verächtlich fest.
»Was wollen Sie?« meinte Schmitz. »Wie soll sie jeden Abend ihre tausend Mark verdienen, wenn sie sich auch noch teure Leute mit auf die Reise nimmt?«
»Aber sie selber wird immer besser«, sagte die kluge Herzfeld. »Sie kann sich jede Manieriertheit leisten. Sie kann wie ein geisteskrankes Baby sprechen: Sie bezwingt.«
»Geisteskrankes Baby ist nicht schlecht«, lachte Kroge. »Man scheint unten fertig zu sein«, fügte er hinzu, mit einem Blick durchs Fenster. Die Leute kamen den gepflasterten Weg herauf, der vom Theater, an der Kantine vorbei, zu dem Tor führte, durch das man auf die Straße trat.
Nach und nach füllte sich die Kantine. Die Schauspieler grüßten mit einer respektvoll betonten Herzlichkeit den Direktorentisch und riefen dem Wirt, einem gedrungenen, kräftigen Greise mit weißem Knebelbart und blauroter Nase, kleine Scherze zu. Väterchen Hansemann, der Kantinenbesitzer, war für das Ensemble eine beinah ebenso bedeutungsvolle Persönlichkeit wie Schmitz, der geschäftliche Direktor. Von Schmitz konnte man Vorschuss bekommen, wenn er sich gerade in gnädiger Laune befand; bei Hansemann aber musste man anschreiben lassen, wenn in der zweiten Monatshälfte die Gage aufgebraucht und ein Vorschuss nicht genehmigt worden war. Alle standen bei ihm in der Kreide; man behauptete, dass Höfgen ihm mehr als hundert Mark schuldig war. Hansemann hatte es also keineswegs nötig, auf die Witze seiner unsoliden Gäste einzugehen; unbewegten Gesichtes, drohenden Ernst auf der Stirne, servierte er Cognac, Bier und kalten Aufschnitt, den niemand bezahlte.
Alle sprachen über Dora Martin, jeder hatte seine eigene Ansicht über den Rang ihrer Leistung; nur darüber, dass sie entschieden zuviel Geld verdiente, waren sich alle einig.
Die Motz erklärte: »An dieser Starwirtschaft geht das deutsche Theater zugrunde« – wozu ihr Freund Petersen grimmig nickte. Petersen war Väterspieler mit dem Ehrgeiz zum Heroischen; er bevorzugte Könige oder adlige alte Haudegen in historischen Stücken. Leider war er etwas zu klein und dick für diese Partien – was er auszugleichen suchte durch eine stramme und kampfeslustige Haltung. Zu seinem Gesicht, das den Ausdruck falscher Biederkeit zeigte, hätte ein grauer Schifferbart gepasst; da er fehlte, wirkte seine Miene ein wenig kahl, mit der langen, rasierten Oberlippe und den sehr blauen, ausdrucksvoll blitzenden, zu kleinen Augen. Die Motz liebte ihn mehr als er sie: das wussten alle. Da er genickt hatte, wandte sie sich nun direkt an ihn, um in einem intimen und bedeutungsvollen Ton zu sagen: »Nicht wahr, Petersen: Über diese Misswirtschaft haben wir schon häufig miteinander gesprochen?« Er bestätigte treuherzig: »Gewiss doch, Frau!« und blinzelte Rahel Mohrenwitz zu, die aufgemacht war als das perverse und dämonische junge Mädchen: mit schwarzen Ponys bis zu den rasierten Augenbrauen und einem großen, schwarz gerandeten Monokel im Gesicht, das übrigens kindlich, pausbäckig und völlig ungeformt war.
»In Berlin wirken die Martinschen Mätzchen vielleicht«, sprach die Motz resolut. »Aber unsereinem kann sie nichts vormachen, wir sind schließlich lauter alte Theaterhasen.« Sie blickte Beifall heischend um sich. Ihr Fach war die komische Alte; zuweilen durfte sie auch reife Salondamen spielen. Sie lachte gern, viel und laut, wobei sie scharfe Falten um den Mund bekam, in dessen Innern Gold funkelte. Im Augenblick freilich zeigte sie eine würdevoll ernste, beinah zornige Miene.
Rahel Mohrenwitz sagte, wobei sie hochmütig mit ihrer langen Zigarettenspitze spielte: »Niemand kann schließlich leugnen, dass die Martin irgendwo eine enorm starke Persönlichkeit ist. Was sie auf der Bühne auch macht: immer ist sie unerhört intensiv da – ihr versteht, was ich meine …« Alle verstanden es; die Motz aber schüttelte missbilligend den Kopf, während die kleine Angelika Siebert mit ihrem hohen, schüchternen Stimmchen erklärte: »Ich bewundere die Martin. Es geht eine zauberhafte Kraft von ihr aus, finde ich …« Sie wurde sehr rot, weil sie einen so langen und gewagten Satz vorgebracht hatte. Alle sahen mit einer gewissen Rührung zu ihr hin. Die kleine Siebert war reizend. Ihr Köpfchen mit dem kurzgeschnittenen, links gescheitelten blonden Haar glich dem eines dreizehnjährigen Buben. Ihre hellen und unschuldigen Augen wurden dadurch nicht weniger anziehend, dass sie kurzsichtig waren: Manche fanden, dass gerade die Art, auf die Angelika beim Schauen die Augen zusammenkniff, ihren besonderen Charme ausmache.
»Unsere Kleine schwärmt wieder einmal«, sagte der schöne Rolf Bonetti und lachte etwas zu laut. Er war jenes Mitglied des Ensembles, das die meisten Liebesbriefe aus dem Publikum erhielt: daher sein stolzer, müder, vor lauter Blasiertheit beinah angewiderter Gesichtsausdruck. Der kleinen Angelika gegenüber jedoch war er der Werbende: schon seit längerem bemühte er sich um sie. Auf der Bühne durfte er sie oft in den Armen halten, das brachte sein Rollenfach mit sich. Im übrigen aber blieb sie spröde. Mit einer wunderlichen Hartnäckigkeit verschenkte sie ihre Zärtlichkeit nur dorthin, wo nicht die mindeste Aussicht bestand, dass man sie erwiderte oder auch nur wünschte. Rührend und begehrenswert, wie sie war, schien sie ganz dafür gemacht, viel geliebt und sehr verwöhnt zu werden. Der sonderbare Eigensinn ihres Herzens aber ließ sie kühl und spöttisch bleiben vor Rolf Bonettis stürmischen Beteuerungen, und ließ sie bitterlich weinen über die eisige Geringschätzung, die Hendrik Höfgen ihr gegenüber an den Tag legte.
Rolf Bonetti sagte kennerhaft: »Als Frau kommt diese Martin jedenfalls gar nicht in Frage: ein unheimlicher Zwitter – sicher hat sie so etwas wie Fischblut in den Adern.«
»Ich finde sie schön«, sagte Angelika, leise aber entschlossen. »Sie ist die schönste Frau, finde ich.« Schon standen ihr die Augen voll Tränen: Angelika weinte häufig, auch ohne besonderen Anlass. Träumerisch sagte sie noch: »Es ist merkwürdig – ich spüre irgendeine geheimnisvolle Ähnlichkeit zwischen Dora Martin und Hendrik …« Dies erregte allgemeine Verwunderung.
»Die Martin ist eine Jüdin.« Es war der junge Hans Miklas, der sich unvermittelt so vernehmen ließ. Alle schauten betroffen und etwas angewidert zu ihm hin. – »Der Miklas ist köstlich«, sprach die Motz in ein betretenes Schweigen hinein und versuchte zu lachen. Kroge runzelte die Stirn, verwundert und degoutiert, während Frau von Herzfeld nur den Kopf schütteln konnte; übrigens war sie blass geworden. Da die Pause lang und peinlich wurde – der junge Miklas stand bleich und trotzig an die Theke gelehnt – sagte Direktor Kroge schließlich ziemlich scharf: »Was soll denn das?« und machte ein Gesicht, so böse, wie es ihm eben möglich war. Ein anderer junger Schauspieler, der sich bis dahin leise mit Vater Hansemann unterhalten hatte, sagte forsch und versöhnlich: »Hoppla, das ist danebengegangen! Lass nur, Miklas, so was kann vorkommen, du bist sonst ein ganz braves Kind!« Dabei klopfte er dem Übeltäter auf die Schulter und lachte so herzlich, dass alle einstimmen konnten; sogar Kroge entschloss sich zu einer Heiterkeit, die freilich krampfhaften Charakter hatte: Er schlug sich mit der flachen Hand auf den Schenkel und warf den Oberkörper nach vorne, so heftig schien er sich plötzlich zu amüsieren. Miklas aber blieb ernst; er drehte das verstockte, bleiche Gesicht zur Seite, die Lippen böse aufeinandergepresst. »Sie ist doch eine Jüdin.« Er sprach so leise, dass fast niemand es hören konnte; nur Otto Ulrichs, der gerade erst durch seine Unbefangenheit die Situation gerettet hatte, hörte es, und nun strafte er ihn...
Inhaltsverzeichnis
- Innentitel
- Über das Buch
- Über den Autor
- Widmung & Motto
- Vorspiel – 1936
- 1 – H. K.
- 2 – Die Tanzstunde
- 3 – Knorke
- 4 – Barbara
- 5 – Der Ehemann
- 6 – »Es ist doch nicht zu schildern ...«
- 7 – Der Pakt mit dem Teufel
- 8 – Über Leichen
- 9 – In vielen Städten
- 10 – Die Drohung
- Impressum
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Mephisto – Roman einer Karriere von Klaus Mann im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Europäisches Drama. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.