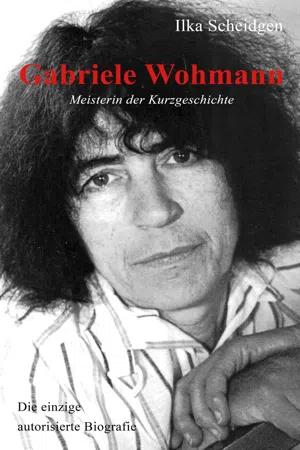![]()
Schönes Gehege (1971-1976)
In der Tat: Gabriele Wohmann hat ihre „Schritte aufgehoben“. Sie hat die subjektiv erlebte Krise durch Sprache überwunden. Zuerst in Form von „Selbstverteidigung“, dem 1971 erschienenen Erzählband, sodann in dem Band „Gegenangriff“ von 1972, der die sprachexperimentellen Texte aus dem Krisenjahr 1971 (neben einigen früheren Prosatexten) beinhaltet. Die Sprache selbst, die sie so meisterhaft beherrscht, wird Anlass zur Reflexion, wird auf den Prüfstand gestellt, wird Anstoß zur Selbsterforschung und Neuorientierung. Die Sprachboxkämpfe dieser Prosa sind einerseits Sprach-Spielereien („Wenn jemand mit der Sprache jemanden flach auf den Boden legt“), andererseits durchleuchten sie die Verletzungen, die Menschen einander mit Wörtern antun, wie schon in Gabriele Wohmanns früheren Arbeiten, dort aber noch stärker ironisiert, sarkastisch überspitzt, mokant überheblich, auf gewisse Weise denunziatorisch. In den Erzählungen dieser Bände liefert Gabriele Wohmann die Analyse der durch Sprache möglichen Bösartigkeiten und Beleidigungen, manchmal auch nur Unachtsamkeiten zwischen Menschen. Darüber hinaus aber geht es bei diesen sprachanalytischen Überlegungen auch um ihr Selbstverständnis als Schriftstellerin. So heißt es in dem Stück „Sylvester“: „Unser Zitatenschatz, unser Verzweiflungsvolumen, unsere vielsprachige, gestenreiche, in der Farbskala unschlagbar universale innere Erlebnis-Anarchie, wohin denn verdammt noch mal, verdammt weggesackte, abgerutschte Ergiebigkeit innerhalb der westlichen Sprachen, dahin.“
Das „Gehege“, in dem sie sich befindet, reicht ihr nach gewissen Ermüdungserscheinungen durch die immense Produktivität nicht mehr aus. Erstmals strebt sie eine Aussöhnung an mit dem zuvor stets als unlösbar empfundenen Konflikt zwischen Sein und Anspruch, Wahrheit und Schein.
So lässt sie im Roman „Schönes Gehege“ (1975) ihren Protagonisten, den Schriftsteller Robert Plath, die Überlegung anstellen: „Ich habe wirklich vor, ständig an der Ermöglichung von irgendetwas Gutem, Richtigen, Schönem zu arbeiten, an diesen winzigen Anstiftungen zum Glück.“
Mit dieser Schreibabsicht muss sich die Schriftstellerin Gabriele Wohmann im Jahre 1973 an die Arbeit zum Roman „Schönes Gehege“ begeben haben. Im Rückblick sah sie ihr bisheriges Schreiben in einem anderen Licht. Der „böse Blick“, der ihr von der Kritik als Markenzeichen angeheftet worden war, erschien ihr mit einem Mal tatsächlich zu einseitig, die Erzählhaltung in ihrem Roman „Ernste Absicht“ als zu resignativ und die Erzählperson zu passiv. Die Protagonistin hat das Leben noch nicht lebenswert genug gefunden. Sie wehrt sich nicht gegen die Fremdbestimmungen und Fremdfestlegungen, sondern leidet nur darunter.
In „Gegenangriff“ startet Gabriele Wohmann tatsächlich zum Gegenangriff, zunächst dort auf der sprachlichen Ebene, in „Schönes Gehege“ auch in der Tat: Robert Plath hat sich durchgekämpft zu der Einsicht, nicht länger dem Bild, das in der Öffentlichkeit über ihn besteht, entsprechen zu müssen und das in einem Fernsehporträt über ihn festgeschrieben werden soll. Am Ende des Romans verweigert er seine Mitwirkung an dem Film. Dass diese Figur ihr wieder einmal sehr nahe steht, bestreitet Gabriele Wohmann nicht. Denn sie hat „die Erkenntnis und Erfahrung, dass ich eigentlich nur mir selber glauben kann beim Schreiben“.
Über diesen Robert Plath – ein alter ego der Gabriele Wohmann – hat sie im Autorengespräch mit Ekkehart Rudolph (1977) gesagt: „Sie wissen ja, wie leicht Schriftsteller festgelegt und zum Markenartikel gemacht werden. Dieser Robert Plath wurde gerade zum Markenartikel für Trübes, Negatives, Schwarzes, auch den ‚bösen Blick’ hat man ihm unterstellt. Und er wehrt sich nun gegen das Negativbild von sich, weil es ihm zu einäugig erscheint. – Er will keinen bösen Blick mehr haben, sondern einen Blick des Erbarmens.“ Und was sie selbst und ihre Schreibmotivation betrifft, gesteht sie: „Ohne Mitgefühl und ohne eine Art Erbarmen kann man gar keine Zeile schreiben und kann gar keine Person richtig beschreiben.“
Bereits 1970 hatte Gabriele Wohmann in ihrem fiktiven Nachruf geschrieben, dass sie eigentlich sehr vieles sehr schön fände. Das wollte sie nun auch in ihren Werken nicht mehr verheimlichen, indem sie ein oder sogar allgemeiner das „Schöne Gehege“ zum Thema eines Romans machte.
Doch noch während der Arbeit an diesem Roman verspürte sie plötzlich Lust auf einen anderen Stoff. Vielleicht war ihr diese Hinwendung zum Schönen selbst noch nicht ganz geheuer. Jedenfalls legte sie das Manuskript beiseite und begann mit einem völlig anderen Sujet: „Paulinchen war allein zu Haus“, einem Roman über moderne Erziehung und ihre Folgen bei einer sensiblen Achtjährigen, dem Waisenkind Paula, das nach dem Unfalltod seiner Eltern und Geschwister bei seinen Großeltern in altmodischer, aber glücklicher Geborgenheit aufwächst, bevor es durch das Journalistenehepaar Christa und Kurt adoptiert wird.
Bei unseren Gesprächen beantwortet Gabriele meine Frage, wie sie auf die Idee zu diesem Stoff gekommen sei: „Eines Sonntagmorgens schneite es, und mir war nach einem Kind zumute, das sich an dem Schnee freut. Das Kind ist ein bisschen melancholisch, lebt bei Adoptiveltern, bei denen es sich nicht richtig geborgen fühlt.“ Eigentlich sollte es nur eine Erzählung werden. „Aber dann hatte ich solche Lust an dem Kind und all den Situationen, auch noch mit den Großeltern, dass es sich zu einem Roman ausgewachsen hat.“
Dieser Roman erschien 1974 und wurde zu einem sehr großen Erfolg. Er erlebte viele Auflagen und noch nach 25 Jahren wiederholte Neuausgaben. Es ist der Roman, der am häufigsten in fremde Sprachen übersetzt wurde, unter anderem ins Russische, Rumänische, Slowakische. 1981 wurde er vom ZDF als Fernsehspiel bearbeitet und am 30. April 1981 gesendet.
Mit dieser Satire auf die vermeintlich fortschrittliche Erziehung mit dem für die Zeit typischen emanzipatorischen und freiheitlichen Vokabular zäumte Gabriele Wohmann den traditionellen Erziehungsroman gleichsam von hinten auf. Die frühen siebziger Jahre waren nach dem Aufbruch der 68er geprägt von einer etwas ruhigeren, dennoch nicht weniger radikalen Umsetzung derer Ideen. Stichworte waren: Selbstverwirklichung, Frauenemanzipation, antiautoritäre Erziehung. Das alles spielt Gabriele Wohmann in ihrem Roman in facettenreicher Sprache virtuos durch.
Hatte sie in einer ihrer bekanntesten und brillantesten Erzählungen „Die Bütows“ (1967) die brutal-autoritäre Mentalität einer Familienstruktur hinter dem scheinbaren Idyll einer ganz normalen Familie satirisch entlarvt, so behandelte sie im Paulinchenroman das andere Extrem einer Ideologie, nämlich das modisch missverstandene antiautoritäre Erziehungsprinzip.
In bewussten Zuspitzungen und Übertreibungen konnte Gabriele Wohmann hier wie dort eines ihrer großen Themen behandeln: die brutalen oder auch subtilen Unterdrückungsmechanismen innerhalb kleiner Einheiten wie Ehe und Familie und der gesamten Gesellschaft. Günter Häntzschel hebt in seiner Monografie über Gabriele Wohmann gerade in Bezug auf den Paulinchenroman ihr gesellschaftliches Engagement hervor: „Hier erweist sich die Autorin als engagiert: Sie übt mit ihren literarischen Möglichkeiten Kritik an einem konkreten, vieldiskutierten Phänomen der Öffentlichkeit im Gefolge der ideologischen Wende nach 1968, der antiautoritären Erziehung um jeden Preis, am Emanzipationsgehabe der Schickeria, an ihrer seelenlosen Wohnkultur, an bloßer Theoriegläubigkeit, am modernistischen Intellektuellenjargon.“
So erinnert sich Gabriele auch bei unserem Gespräch. „Das war eine Kritik an den so genannten fortschrittlichen Erziehungsmethoden. Aber das war nicht mein Ziel, das läuft da einfach mit rein, denn ich bin ja ein schreibender Zeitgenosse. Ich habe beim Schreiben nie ein gesellschaftspolitisches Problem als ZIEL. Ich interessiere mich für Politik, ich sehe alle Nachrichten, ich lese Zeitung.“ Und lachend fügt sie hinzu: „Manche denken, ich sei ganz abgehoben und verkrieche mich in meiner Bücherwelt. So ein Quatsch! Ich bin ein teilnehmender Zeitgenosse.“
Verwundern kann es nicht, dass das Echo auf den Roman zweigeteilt war. Neben ausgesprochen positiven Besprechungen gab es auch kritische Stimmen bis hin zur Ablehnung.
„Die Feministinnen haben mir übel genommen, meine Literatur sei nicht feministisch genug“, erzählt mir Gabriele. So beurteilt die Literaturwissenschaftlerin Mona Knapp in ihrer Studie „Zwischen den Fronten: Zur Entwicklung der Frauengestalten in Erzähltexten von Gabriele Wohmann“ (1980) die Darstellung der freien Journalistin Christa, der Adoptivmutter der Waisen Paula „als eine der gelungensten Darstellungen des verfehlten Feminismus in der Gegenwartsliteratur“ und den Roman als „maßgeblich für Gabriele Wohmanns Konzeption der Emanzipation“, was die Verärgerung aus dem feministischen Lager begreiflich macht.
Zum Thema Feminismus und auch zur Neuen Subjektivität hat Gabriele Wohmann keine Meinung, da sie sich stets unabhängig von Zeitgeist und literarischen Strömungen bewegt hat. Schon lange, bevor in den siebziger Jahren in der Literatur die „Neue Sensibilität“ oder „Neue Subjektivität“ – besonders im Schreiben von Frauen – aufkam (Vertreterinnen waren unter anderem Karin Struck, Brigitte Schwaiger, Verena Stefan, Christa Wolf), hatte Gabriele Wohmann das so genannte Private zum Inhalt ihrer Erzählungen und Romane gemacht, so dass sie sich in einem Gespräch mit Albert Röhl ironisch als „Urgroßmutter“ dieses neuen Trends bezeichnet. (Weltwoche vom 15. Juni 1977)
Das eben ist ihre Art, mit Strömungen des Zeitgeistes umzugehen: Sie stellt fest, sie beschreibt bis ins Detail. Sie schreibt nicht auf das Ziel hin, etwas zu kritisieren oder zu bewirken. „Ich bin ein Schreibender, ein Aufzeigender, ein Vorzeiger“, sagt sie und meint damit das Gegenteil eines Pädagogen oder Therapeuten. „Ich zeige Personen in der Hoffnung, dass dann anschließend über sie reflektiert wird. Manches Elend entsteht einfach dadurch, dass sich die Personen über sich selbst nicht im Klaren sind. Dass sie eben ihre Situation nicht durchdenken können“, antwortete Gabriele Wohmann in einem Gespräch mit Hella Schlumberger. (Publikation, 1972)
Im selben Interview gibt sie auch Auskunft zum Komplex, den ich in diesem Kapitel unter dem Überbegriff „Schönes Gehege“ für das Werk der Schaffensperiode 1971–1976 als kennzeichnend betrachte. „Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass der (Alltag) funktioniert und der kann besser funktionieren meiner Meinung nach, wenn man auf sein Nicht-Funktionieren sehr aufpasst. Ich würde auch immer ein Plädoyer für nötig halten für Liebe, das klingt auch wieder pathetisch und kitschig, aber das ist überhaupt das wichtigste Erziehungsinstrument, was man haben kann dem Kind gegenüber.“
Und genau darum geht es im Roman „Paulinchen war allein zu Haus“. Liebe hat Paula bei ihren Großeltern erfahren. Kurt und Christa, die „Erklärungsprofis“, die die ganze Adoptionsgeschichte mehr wie ein Experiment betrachten, wollen ihre kindlichen Sehnsüchte nicht wirklich verstehen, sondern versuchen mit Paula, ganz so wie sie es in der einschlägigen Fachliteratur gelesen haben, partnerschaftlich umzugehen, zu diskutieren, Sachverhalte transparent zu machen. Besonders Christa möchte mit ihr auf der Vernunftebene kommunizieren, sie zu einem vernünftigen Menschen machen. Gefühle kommen dabei entschieden zu kurz, nur ansatzweise sind sie im Zusammenleben mit dem Adoptivvater Kurt möglich, den Paula deshalb auch lieber mag. „Er ist immer so nah dran, unheimlich in Ordnung zu sein, dachte das Kind, immer fast lieber Kurt. Oft richtig lieber Kurt. Er kriegt nur von Christa dauernd wieder was vermurkst und dann langweilt ihn alles wieder und nichts kommt vom Fleck.“
Dennoch wird ihr im Grunde kein eigenes Leben zugestanden, was sich besonders im fehlenden eigenen Zimmer äußert. (Hier denkt man sofort an Virginia Woolf’s Essay „A Room of One’s Own“, der die Wichtigkeit eines eigenen Zimmers für die Entwicklung, insbesondere der Kreativität, betont.) Christa verweigert Paula diesen Wunsch mit dem Argument: „Ein eigenes Zimmer für dich zerstört die Schönheit der Raumaufteilung.“ So schläft Paula in einem offenen Verschlag des Wohnateliers, das zudem äußerst kapriziös eingerichtet ist. Das Wohnatelier – übrigens eine Nachbildung des Wohmannschen Hauses auf der Rosenhöhe – ist in seiner Raumaufteilung bewusst offen und türelos. Paula vermisst die gemütliche Atmosphäre bei den Großeltern und zieht sich in ihre kleine Koje zurück mit ihren Schreibheften, die sie nicht einmal richtig verstecken kann vor den neugierigen Blicken der Erwachsenen. Die sitzen tagsüber immer an ihren Schreibmaschinen, und nachts wollen sie auf keinen Fall durch Paula gestört werden in ihrem wertvollen Schlaf. Abends kann sie dafür in ihrer Schlafkoje hinter dem Vorhang die Gespräche der Erwachsenen belauschen. Das hört sich dann so an: „Warum nur, warum bildet sie sich das ein und das und das und das – Aufzählen der Einbildungen und Erfindungen ohne Ende, warum nur, warum ist Paula so wie sie ist, warum ist Paula so, wie sie zu sein vorgibt und demnach sein möchte, warum nur, warum. Gedanke für Gedanke, Beobachtung auf Beobachtung ein Warum. Selbstverständlich, das ist nicht ohne Spannung für uns, klar. Aber gelegentlich kommt man doch nicht recht weiter.“
Und im „Geselligkeitskreis der Adoptierer“, wie Paula das abendliche Beisammensein mit Freunden oder Kollegen im mit Antiquitäten garnierten Wohnatelier nennt, werden eifrig das Befinden und die Absonderlichkeiten von Paula diskutiert, was wiederum von dem nur scheinbar schlafenden Kind belauscht wird. „Da flüchtet sie, als das Paulinchen, halt einfach gelegentlich in ihre frühkindliche Welt, nach der hat sie wohl ein wenn auch ebenfalls nicht gerade gesundes Heimweh oder so was. Das Paulinchen, das kann man allenfalls noch verstehen. Obschon: abgeschafft werden muss es auch, eigentlich vor allem es, das Paulinchen, der Zeitpunkt ist eigentlich längst da, besser: überschritten, nun denn, bei unserer Toleranz und eingedenk der Schwierigkeiten als Vollwaise lassen wir ihr eben noch ein bisschen Zeit.“
Gabriele Wohmann hat das Kind Paula, das zu Beginn der Romanhandlung acht Jahre, am Ende dreizehn Jahre alt ist, bewusst als Kunstfigur geschaffen und sie nicht mit kindlicher Sprache und altersgemäßen Gedanken ausgestattet. Was manche Kritiker dazu veranlasste, das Kind als altklug oder als „Zwergriesen“ zu bezeichnen. Gabriele Wohmann selbst findet das Kind nicht besonders schwierig. Aber natürlich ist es auch ihre Figur. Hans Wagener sieht darin gerade den Vorzug des Romans: „Paula ist keine realistische Person, sondern die Schriftstellerin Gabriele Wohmann ist in ihre Haut geschlüpft, hat in ihr eine Kunstfigur geschaffen, die in ihrer, von der Autorin geborgten Sprache ihre Erfahrungen mit der modernen Erwachsenenwelt in Worte fasst. Gabriele Wohmann hat sich nicht verstellt, sondern nur ein Kind (…) sprechen lassen.“
Der Entwicklung dieses Kindes im Roman folgt man als Leser gern und mit innerer Anteilnahme, manches hat man auch selbst so oder ähnlich erlebt oder gedacht. In dieses Kind Paulinchen hat Gabriele Wohmann auch ganz viel von sich selber hineingesteckt, aus ihrer eigenen Kindheit, in der es diese Geborgenheit, diese Verlässlichkeit und ein absolutes Vertrauen gab innerhalb der Familie, eben ein „schönes Gehege“, das Paulinchen bei den Großeltern hatte, aber bei den neuen Eltern vermisst. Indem Gabriele Wohmann sich in dieses Kind hineinfühlt, kann sie sich umso lebhafter noch mal an ihre eigene Kindheit zurückerinnern.
Es sind die Jahre, von denen sie sagt, sie sei drei Jahre lang wie verkrampft gewesen in der Sorge um den Vater und der Angst vor seinem Tod. Dass er herzkrank war, aber darüber nicht viel sprach, vielmehr seine Sorge umgekehrt stets seiner Familie galt, verringerte Gabrieles Unruhe überhaupt nicht. Ihren geliebten Vater zu verlieren, war für sie ein Schreckensgedanke sondergleichen. Sich in dieser Zeit beim Schreiben eines Romans so intensiv in die eigene glückliche Kindheit hine...