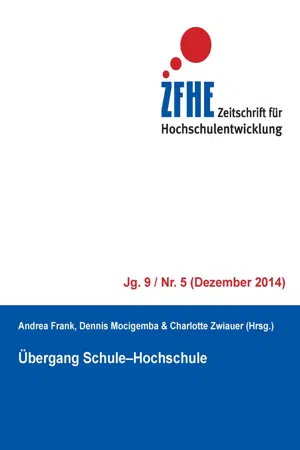![]()
Roland HAPP2, Manuel FÖRSTER, Olga ZLATKINTROITSCHANSKAIA (Mainz), Michael-Jörg OESTERLE & Stefan DOETSCH (Stuttgart)
Die Signalwirkung von Hochschulrankings – eine empirische Studie unter Studienanfängerinnen/-anfängern der Wirtschaftswissenschaften
Zusammenfassung
Hochschulrankings sind in den letzten Jahren auch in Deutschland gerade in den Wirtschaftswissenschaften sehr populär und damit zunehmend zum Gegenstand der Forschung geworden. Allerdings erweisen sich die Erkenntnisse sowohl zur generellen Bedeutung von Rankings bei der Hochschulwahl als auch zur Wirkung der Rankings in Abhängigkeit bestimmter personenbezogener Eigenschaften der Studieninteressierten bislang als begrenzt. An diesem Forschungsdefizit setzt der vorliegende Beitrag an, indem zunächst die Wirkungsweise von Rankings theoretisch betrachtet wird, bevor Befragungsergebnisse von 1.314 Studienanfängerinnen und -anfängern der Wirtschaftswissenschaften präsentiert werden.
Schlüsselwörter
Hochschulrankings, Hochschulwahl, Wirtschaftswissenschaften
Signaling effect of university rankings – An empirical study among first-year students of business and economics
Abstract
In recent years, university rankings have become very popular in Germany, specifically in the fields of business and economics, and have attracted increasing research interest. However, there has been little research on the general influence of rankings on students’ choices of institutions of higher education or on how certain personality characteristics of university applicants may affect that influence. In this paper, we examine the theoretical perspectives of the effects of rankings and then present results from an empirical survey of 1,314 freshmen students of business and economics.
Keywords
university rankings, choice of university, business and economics
1 Relevanz und Fragestellungen
Bei dem Übergang in die Hochschule stehen Studieninteressierte nach der Wahl des Studienfaches vor der Herausforderung, sich für eine Hochschule zu entscheiden (KRAWIETZ & HEINE, 2007). Diese Phase ist von Unsicherheit geprägt, da neben den Informationsmaterialien von Hochschulen – die jedoch u. a. aufgrund des steigenden Hochschulwettbewerbs zunehmend eher reine „Werbebroschüren“ darstellen (EGLIN-CHAPPUIS, 2007) – kaum zuverlässige Informationen über die Qualität der verschiedenen Hochschulen zur Verfügung stehen (HEINE, SPANGENBERG & WILLICH, 2007). So hatten Studienanfänger/innen, die sich für das unter Studierenden sehr beliebte Fach Wirtschaftswissenschaften (WiWi) entschieden haben, allein für die wirtschaftswissenschaftlichen Bachelor-Studiengänge im WS 2013/2014 die Wahl zwischen 1.273 Studienangeboten deutschlandweit (HRK, 2013, S. 10).
Als Orientierungsmöglichkeit für die Studieninteressierten treten – u. a. durch die Medien stark verbreitet – zunehmend Hochschulrankings (HR) in den Vordergrund (SABIR, AHMAD, ASHRAF & AHMAD, 2013). HR kommen ursprünglich aus den USA (z. B. MUELLER & ROCKERBIE, 2005) und haben international mittlerweile eine starke Verbreitung gefunden.3 So erscheint inzwischen nahezu jährlich eine Vielzahl von internationalen Hochschulrankings (bspw. Times Higher Education World University Ranking, „Shanghai Ranking“ s. DEHON, MCCATHIE & VERARDI, 2010). Auch für Deutschland lässt sich seit Anfang der 2000er Jahre ein Trend hin zu einem breiteren öffentlichen Interesse an HR beobachten (FEDERKEIL, 2013; BAYER, 2004). Das bekannteste derzeit deutschlandweit verbreitete HR stellt das durch das Centrum für Hochschulentwicklung (CHE) veröffentlichte CHE-Ranking dar (HACHMEISTER, 2013). Daneben existiert gerade für das Studienfach WiWi eine Reihe von weiteren HR, die mehr oder weniger regelmäßig veröffentlicht werden (z. B. Handelsblatt-Ranking, 2014).
In den letzten Jahren wird gerade aus erziehungswissenschaftlicher Perspektive das Vorgehen der „Evaluation“ bei den genannten Ranking-Verfahren des Öfteren äußerst kritisch diskutiert (BORGWARDT, 2011). So bemängelt z. B. LENZEN (2012) die fehlende Zugrundelegung von objektiven, reliablen und validen Messinstrumenten, um die Ergebnisse der Rankings aus dieser Perspektive zu verbessern. Vor dem Hintergrund dieser Kritik ist es erforderlich, der Frage nachzugehen, welche Bedeutung HR für Studieninteressierte der WiWi einnehmen. Sollte sich bei den diesbezüglichen empirischen Analysen herausstellen, dass HR kaum eine Signalwirkung entfalten, so dürfte die kritische Hinterfragung angebracht sein, ob die zahlreichen Bemühungen zur Verbesserung der „Ranking-Praxis“ dem eigentlichen Ertrag hieraus angemessen sind bzw. ob die Erarbeitung von Rankings so verbessert werden kann, dass sie von Studieninteressierten als Entscheidungshilfe bei der Studienortwahl verstärkt berücksichtigt werden. Bei einer geringen Signalwirkung von HR müsste ebenso analysiert werden, ob bei der Hochschulwahl vielmehr andere Faktoren wie die „örtliche Lage“ oder der „Theorie-Praxisbezug“ eine wesentlich höhere Rolle spielen. Insbesondere in der letzten Dekade werden in den Medien auch Ergebnisse aus der sogenannten Exzellenzinitiative verstärkt publik gemacht (GLÄSER & WEINGART, 2010). Dabei stellt sich die Frage, ob z. B. aus der Studierendensicht das Abschneiden in der Exzellenzinitiative an die Stelle von HR tritt. Auf diesen Überlegungen aufbauend lässt sich die erste Forschungsfrage für diesen Beitrag wie folgt spezifizieren:
Frage 1:
Welche Bedeutung haben HR für Studieninteressierte der WiWi bei der Wahl des Studienortes?
Neben der Analyse der generellen Bedeutung von HR ist in diesem Kontext weiterhin zu untersuchen, ob die Signalwirkung von HR in Abhängigkeit von bestimmten Persönlichkeitseigenschaften bei den Studieninteressierten variiert. Aus der Signaling-Theory (SPENCE, 1973) ist bekannt, dass Signale je nach Empfänger/in eine unterschiedliche Wirkung entfalten (z. B. AMELANG, BARTUSSEK, STEMMLER & HAGEMANN, 2006). Folglich lässt sich die zweite Forschungsfrage wie folgt formulieren:
Frage 2:
Unterscheiden sich Studieninteressierte der WiWi hinsichtlich verschiedener individueller Kriterien bei ihrer Rezeption von HR?
Nach einer Skizzierung der theoretischen Grundlagen zur Wirkung von HR bei den Studieninteressierten sowie einer Präzisierung der zu untersuchenden Hypothesen (Kap. 2) erfolgt die Darstellung der Studie zur Befragung von 1.314 Erstsemesterstudierenden der WiWi im SS 2014 (Kap. 3). Die zentralen Ergebnisse werden in Kap. 4 beschrieben und in Kap. 5 diskutiert; in Kap. 6 erfolgt ein kurzer Ausblick.
2 Theoretische Hintergründe
Einen zentralen theoretischen Erklärungsansatz zur Wirkung von HR liefert die Signaling-Theory. Der wesentliche Grundgedanke des auf der Arbeit von SPENCE (1973) basierenden Ansatzes besteht darin, dass Nachfrager/innen zur Reduktion von Unsicherheiten (Informationsasymmetrien) bei Markttransaktionen auf Indikatoren (Signale) zurückgreifen, die ihnen helfen, vor einem „Vertragsabschluss“ die nicht beobachtbaren und somit zur Unsicherheit führenden Leistungseigenschaften besser abzuschätzen.
In Deutschland (sowie auch in anderen Ländern wie den USA) hat die quantitative Ausdehnung wirtschaftswissenschaftlicher Studienangebote (HRK, 2013) zu einem enormen Wettbewerb unter den Hochschulinstitutionen und somit zu einer zunehmenden Etablierung marktlicher Verhältnisse geführt (IVY, 2008). Folglich können die Grundgedanken der Signaling-Theory auch auf diesen Kontext übertragen werden. Dabei zeigt sich die Marktsituation insofern, als die Hochschulen und die Studieninteressierten zwei potentielle Transaktionspartner/innen auf dem „Hochschulmarkt“ darstellen. Die Hochschulen bieten ihre Leistungen, d. h. die Ausbildung, den Studieninteressierten als Nachfragerinnen und Nachfragern an. Da jedoch von Nachfragerseite, also den Studieninter...