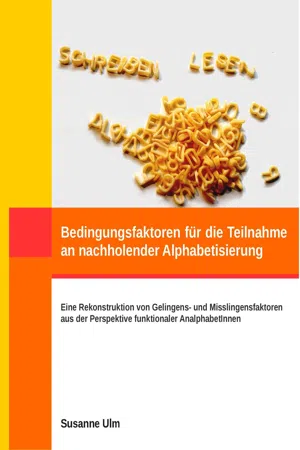![]()
1 Einleitung
1.1 Problemstellung
Im Zeitalter der Wissensgesellschaften, welches nicht nur einen sich ständig beschleunigenden Wandel an Technologien und Informationen mit sich bringt, sondern auch parallel dazu steigende Bildungs- und Ausbildungsniveaus sowie in der Folge wachsende soziale und berufliche Ansprüche an die Gesellschaftsmitglieder, ist die Bereitschaft zum Lebenslangen Lernen zu einer unabdingbaren Notwendigkeit geworden. So müssen immer mehr Wissen und Kompetenzen in immer kürzeren Abständen angeeignet und adäquat angewendet werden, andernfalls drohen beruflicher Abstieg und im schlimmsten Fall soziale Exklusion. Die Bedeutsamkeit von Lernen im Lebenslauf wurde bereits im Jahr 2008 im Innovationskreis Weiterbildung des BMBF thematisiert:
„Die Globalisierung und die Wissensgesellschaft stellen die Menschen vor große Herausforderungen, die durch den demographischen Wandel noch erheblich verstärkt werden: Wissen sowie die Fähigkeit, das erworbene Wissen anzuwenden, müssen durch Lernen im Lebenslauf ständig angepasst und erweitert werden. Nur so können persönliche Orientierung, gesellschaftliche Teilhabe und Beschäftigungsfähigkeit erhalten und verbessert werden.“1
Diese wachsenden gesellschaftlichen Anforderungen stellen vor allem bildungsferne Gruppen vor kaum lösbare Probleme – insbesondere jene, die Schwierigkeiten im Bereich der grundlegenden Kulturtechniken wie dem Lesen und Schreiben oder auch dem Rechnen haben, sind davon betroffen. Damit steht das Individuum
„im Spannungsfeld zwischen gesellschaftlichen Anforderungen (Bildung, Qualifikation, Verwertbarkeit im Berufssystem) und den subjektiven Aneignungs- und Lernprozessen in der es umgebenden Lebenswelt“2.
Eine unzureichende Grundbildung, welche die gesellschaftliche Teilhabe bedrohen oder zumindest einschränken kann, wurde von den modernen Industrienationen aufgrund der Einführung der allgemeinen Schulpflicht lange Zeit ausschließlich als ein Problem der Entwicklungsländer betrachtet. In Deutschland begann die zunehmende Beschäftigung mit dieser Thematik erst in den späten 1970er Jahren, als sich vermehrt MuttersprachlerInnen zu Lese- und Rechtschreibkursen anmeldeten, welche von verschiedenen Erwachsenenbildungseinrichtungen insbesondere für MigrantInnen angeboten wurden. Nach einer Welle von Forschungsarbeiten, überwiegend aus dem Kreis engagierter PraktikerInnen, geriet das Analphabetismus-Phänomen jedoch zunehmend in Vergessenheit und rückte erst wieder mit der Ausrufung der UNESCO Weltalphabetisierungsdekade im Jahr 2000 verstärkt in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Neuere Untersuchungen zum Thema Analphabetismus, wie z.B. die Leo.-Level One Studie3, konnten aufzeigen, dass in Deutschland trotz allgemeiner Schulpflicht schätzungsweise 7,5 Millionen Menschen zu den sogenannten „funktionalen AnalphabetInnen“4 zählen, ein Anteil von über 14% an der erwerbsfähigen Bevölkerung. Die Betroffenen sind besonders stark von sozialem Ausschluss, Arbeitslosigkeit und Armut bedroht. Tatsächlich verlassen in Deutschland pro Jahr immer noch durchschnittlich 80.000 SchülerInnen ohne Abschluss die Schule – nicht wenige mit gravierenden Schwächen im schriftsprachlichen Bereich. Diejenigen von ihnen, die überhaupt die Chance einer beruflichen Ausbildung erhalten, stehen vor der kaum bewältigbaren Herausforderung, diese auch erfolgreich abschließen zu können. Zudem bleibt ihnen zumeist ebenso im weiteren Lebensverlauf der Zutritt zu vielfältigen (Fort)Bildungsmöglichkeiten verwehrt. Ihre schlechten Zukunftsaussichten geben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit an die nachfolgende Generation weiter. Um diesen Betroffenen eine aktive soziale und berufliche Teilhabe zu ermöglichen, ist die Bereitstellung von vielfältigen Möglichkeiten einer nachholenden Alphabetisierung unerlässlich. Die Erwachsenenbildungslandschaft in Deutschland versucht dies in den letzten Jahren verstärkt durch den Ausbau zielgruppengerechter Grundbildungsangebote und die Professionalisierung des erwachsenenpädagogischen Personals zu ermöglichen. Doch trotz der beschriebenen Problematik bei den Betroffenen und der verbesserten erwachsenenpädagogischen Angebotslage ist die Nachfrage nach Grundbildungsangeboten noch immer recht gering. So zeigt sich z.B. in der VHS-Statistik aus dem Arbeitsjahr 2011 lediglich eine deutschlandweite Belegungszahl von weniger als 30.000 Teilnehmenden im Bereich Alphabetisierung/Elementarbildung – gegenüber ca. 7,5 Mio. geschätzter funktionaler AnalphabetInnen eine verschwindend geringe Zahl.5 Welche Faktoren das nachholende Lernen dieser Zielgruppe letztendlich entscheidend beeinflussen, liegt bislang noch weitgehend im Dunkeln. Die Alphabetisierungsforschung widmete sich bisher kaum den Bedingungen und Einflussfaktoren von Lernprozessen funktionaler AnalphabetInnen. Eine Vernachlässigung der Lernforschung ist jedoch ebenso in der Erwachsenenbildung allgemein zu beobachten. Auch dort lassen sich bisher nur wenige Arbeiten zum Lernen Erwachsener finden.
1.2 Fragestellung und Zielsetzung
Vor dem Hintergrund der oben skizzierten Problemstellung widmet sich diese Arbeit der wissenschaftlichen Ergründung von Einflussfaktoren für die Aufnahme und Weiterführung nachholender Lernprozesse bei der Gruppe der funktionalen AnalphabetInnen. Die zentralen Ziele sind (1) einen Beitrag zur Theoriebildung auf dem Gebiet der Lernforschung sowie der Alphabetisierungsforschung zu leisten und (2) aus den Untersuchungsergebnissen Handlungsempfehlungen für die Alphabetisierungspraxis abzuleiten.
Rückgebunden an die biographieorientierte Theorie des transitorischen Lernens nach Alheit und den systemisch-konstruktivistischen Ansatz des Emotionslernens nach Arnold soll daher der Versuch unternommen werden, Einflussfaktoren auf individuelle Lernprozesse aus der Perspektive des Lernsubjekts zu rekonstruieren. Dazu sollen Prozesse und Bedingungen beleuchtet werden, die für die Aufnahme von nachholender Alphabetisierung von Bedeutung sein können, wie z.B. biographische Erfahrungen oder aktuelle Lebenslagen Betroffener. Zudem sollen beeinflussende Faktoren identifiziert werden, welche für das Gelingen bzw. die Aufrechterhaltung von nachholender Alphabetisierung förderlich sind. Zu dieser Frage soll in Bezug auf die Theorie des Emotionslernens nach Arnold ermittelt werden, ob und inwiefern vor bzw. innerhalb von Nachlernprozessen individuelle Reflexions- und Transformationsprozesse in Bezug auf Deutungs- und Emotionsmuster stattfinden. Auch geht es um lernbegünstigende und lernhinderliche Einflussfaktoren innerhalb der Lebenswelt der Betroffenen sowie im Alphabetisierungskurs als Nachlernkontext.
Besonders für die Praxis der Alphabetisierung und Grundbildung muss unbedingt eingehender erforscht werden, wie Betroffene bei der Aufnahme von nachholenden Lernprozessen unterstützt und positive Lernerlebnisse ermöglicht werden können, um eine nachhaltige Entwicklung in Richtung Lebenslanges Lernen sicherzustellen.
Letztlich soll durch diese Arbeit die Gesellschaft für das Phänomen Analphabetismus stärker sensibilisiert werden und eine größere Toleranz und Akzeptanz sowie mehr Entgegenkommen gegenüber den Betroffenen erreicht werden.
1.3 Aufbau der Arbeit
Nachdem in diesem Kapitel ein erster Einstieg in die Thematik gegeben werden sollte, werden im nachfolgenden Kapitel grundlegende lerntheoretische Zugänge der Erwachsenenpädagogik vorgestellt und für die Untersuchung überprüfbar gemacht. Als besonders fruchtbar erweisen sich hierbei zwei Theorierichtungen: biographie- und lebensweltorientierte Konzepte, welche Lernprozesse in Abhängigkeit von biographischen Erfahrungen und Lebenslagen betrachten sowie systemisch-konstruktivistische und subjektwissenschaftliche Lerntheorien, die nachhaltiges Lernen als einen subjektgesteuerten, reflexiven und transformativen Prozess definieren. Für die vorliegende Untersuchung soll insbesondere Bezug zu den Theorien des transitorischen Lernens nach Alheit und des Emotionslernen nach Arnold hergestellt werden.
Zur weiteren theoretischen Fundierung der vorliegenden Arbeit sowie zur Erhaltung der Anschlussfähigkeit der Untersuchungsergebnisse soll im dritten Kapitel der Forschungsstand der Alphabetisierung und Grundbildung insbesondere in Bezug auf das Lernen funktionaler AnalphabetInnen dargestellt werden, nachdem zuvor die wichtigsten theoretischen Begrifflichkeiten sowie die geschichtliche Entwicklung der Alphabetisierungsforschung in Deutschland näher beleuchtet wurden. Es zeigt sich, dass bislang nur wenige differenzierte Befunde zu den Lernprozessen funktionaler AnalphabetInnen vorliegen. Zwar lässt sich ein fruchtbarer Erkenntnisfortschritt innerhalb der Teilnehmendenforschung verzeichnen, welche die Aufschichtung negativer biographischer Erfahrungen in den Sozialisationsfeldern Familie und Schule als Verursachungsfaktoren von funktionalem Analphabetismus identifizierte, jedoch gibt es bis zum jetzigen Zeitpunkt nur wenige lerntheoretische Studien sowohl auf dem Gebiet der Alphabetisierungsforschung als auch innerhalb der Erwachsenenbildungsforschung allgemein. Erste Untersuchungen zu diesem Thema stellten spezifische Teihabeorientierungen der Betroffenen als bedeutsam für die Aufnahme von Lernprozessen heraus.
Im vierten Kapitel wird die empirische Untersuchung der vorliegenden Arbeit vorgestellt. Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurden problemzentrierte Leitfadeninterviews mit 22 Alphabetisierungskursteilnehmenden geführt und nach dem Verfah-Verfahren der Grounded Theory nach Strauss und Corbin6 ausgewertet. Es zeigt sich, dass die Aufnahme und Aufrechterhaltung von Nachlernprozessen bei funktionalen AnalphabetInnen von vielfältigen biographischen, aber auch innerpsychischen Faktoren und Prozessen beeinflusst ist. So erweisen sich insbesondere „emotionale Einspurungen“ als besonders handlungseinschränkend und damit auch als lernhinderlich. Als lernförderlich sind dagegen reflexive und transformative Prozesse im Denken, Fühlen und Handeln der Betroffenen anzusehen. Auch aktuelle lebensweltliche Bedingungen, z.B. das Vorhandensein spezifischer Belastungsfaktoren oder die Unterstützung durch Vertrauenspersonen, wirken sich auf eine Wiederaufnahme und Weiterführung nachholender Alphabetisierung aus. Innerhalb von Alphabetisierungskursen sind für die Teilnehmenden vor allem vertrauensvolle Beziehungen innerhalb Lerngruppe und zu den Lehrenden bedeutsam.
Im letzten Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse vor dem Hintergrund der theoretischen Basis interpretiert und kritisch diskutiert. Außerdem sollen die Stärken und Schwächen der vorliegenden Arbeit erörtert werden. Zuletzt werden Anknüpfungspunkte für die weitere Forschung herausgestellt und Handlungsempfehlungen für die Alphabetisierungspraxis gegeben.
1 BMBF (2008), S. 7.
2 Mikula (2009), S. 3.
3 Grotlüschen, Anke/Riekmann, Wibke (2011): leo. – Level-One Studie. Literalität von Erwachsenen auf den unteren Kompetenzniveaus. Presseheft. URL: http://blogs.epb.uni-hamburg.de/leo/files/2011/12/leo-Presseheft_15_12_2011.pdf (Stand: 07.06.2015).
4 Ein funktionaler Analphabet bzw. Analphabetin ist eine Person, die „zwar einzelne Sätze lesen oder schreiben kann, nicht jedoch, zusammenhängende – auch kürzere – Texte. Betroffene Personen sind aufgrund ihrer begrenzten schriftsprachlichen Kompetenzen nicht in der Lage, am gesellschaftlichen Leben in angemessener Form teilzuhaben. So misslingt etwa auch bei einfachen Beschäftigungen das Lesen schriftlicher Arbeitsanweisungen“ (Grotlüschen/Riekmann 2011, S. 2).
5 Huntemann, Hella/Reichart, Elisabeth (2012): Volkshochschul-Statistik. 50. Folge, Arbeitsjahr 2011, S. 30. URL: www.die-bonn.de/doks/2012-volkshochschule-statistik-01.pdf (Stand: 07.06.2015).
6 Strauss, Anselm/Corbin, Juliet (1996): Grounded Theory: Grundlagen qualitativer Sozialforschung. Weinheim.
![]()
2 Lerntheoretische Konzepte der Erwachsenenbildung
Die Praxis der Erwachsenenbildung ist seit ihren Anfängen darum bemüht, Erwachsene in ihrem Lernprozess bestmöglich zu unterstützen. Entsprechend sollte auch die empirische Erforschung des Lernens Erwachsener das „Herzstück einer Erwachsenen- und Weiterbildungsforschung“7 sein. Tatsächlich spielt dieses Forschungsgebiet jedoch bislang noch immer eine eher untergeordnete Rolle. Dies kann nach Ludwig und Müller vier Bedingungen zugeschrieben werden8: Zum einen ist der „Planungsgedanke“ innerhalb der Didaktik der Erwachsenenbildung vorherrschend, daher werden bislang überwiegend Untersuchungen zur Lehr- und Teilnehmendenforschung durchgeführt. Zum anderen gelten Lernprozesse in einigen theoretischen Ansätzen (z.B. im Konstruktivismus) als nicht direkt, sondern nur indirekt „über die Inputleistungen der Pädagogen und die Outputleistungen der Lernenden“9 beobachtbar, was deren Betrachtung demzufolge unmöglich machen würde. Desweiteren ist die Lernforschung noch immer durch die pädagogische Psychologie und in den letzten Jahren au...