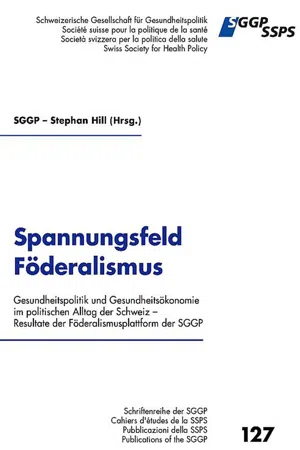
eBook - ePub
Spannungsfeld Föderalismus
Gesundheitspolitik und Gesundheitsökonomie im politischen Alltag der Schweiz - Resultate der Förderalismusplattform der SGGP
- 170 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Spannungsfeld Föderalismus
Gesundheitspolitik und Gesundheitsökonomie im politischen Alltag der Schweiz - Resultate der Förderalismusplattform der SGGP
Über dieses Buch
Experten des schweizerischen Gesundheitswesens analysieren in diesem Sammelband die Chancen und Risiken des Föderalismus im Spannungsfeld zwischen Bund und Kantonen. Die Beiträge sind vor dem Hintergrund einer von der SGGP-Diskussionsplattform zu diesem Thema entstanden, an der die wichtigsten Akteure des Gesundheitswesens teilnahmen. Gesundheitspolitik ist Sache der Kantone. Der Bund aber mischt kräftig mit. Er erlässt Ge-setze und Vorgaben, die von den Kantonen ausgeführt und finanziert werden müssen. Diese fühlen sich in ihrer Hoheit gefährdet. Die Kleinräumigkeit der Schweiz mit ihren 26 Kantonen bietet Vorteile wie Bürgernähe, kurze Wege, Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten. Es gibt aber auch grosse Qualitätsunterschiede, Doppelspurigkeiten, Verschwendung von knappen Ressourcen und Protektionismus. Die SGGP befragte die Teilnehmer, wie ein neues Steuerungsmodell für das Gesundheits-wesen gestaltet sein sollte: Zentralgesteuert, harmonisiert, kantonal gesteuert, multipartner-schaftlich entwickelt? Die Akteure bewerten aus ihrer Sicht Schwächen und Stärken des Fö-deralismus im schweizerischen Gesundheitswesen und fordern gezielte Reformen sowie verbindliche und messbare nationale Ziele. Lösungen aus dem Dilemma zwischen regionaler und lokaler Beharrlichkeit einerseits und überregionaler oder zentraler Steuerung und Koordination andererseits müssen in der Schnittmenge zwischen Bund und Kantonen gefunden werden. Ein Ansatz dazu besteht be-reits im seit 2003 geführten "Dialog nationale Gesundheitspolitik". Eine Stärkung der Ge-sundheitsdirektorenkonferenz (GDK) wäre ein weiterer Ansatz zur Vermittlung unterschiedli-cher Positionen zwischen Bund und Kantonen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Spannungsfeld Föderalismus von Stephan Hill (Hrsg.) im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Sozialpolitik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Einleitung
Stephan Hill, Geschäftsführer SGGP
Die SGGP, die sich in ihren Statuten dafür einsetzt, dass „grundsätzliche, übergeordnete sowie mittel- und langfristige Ziele der Gesundheitspolitik vermehrt untersucht und berücksichtigt werden“, will auch den Austausch unter den Akteuren im schweizerischen Gesundheitswesen fördern. 2009 hat die SGGP deshalb erstmals eine Stakeholder-Plattform durchgeführt zum Thema „Gesundheits- und Präventionsziele für die Schweiz“. Die Ergebnisse sind in Band 97 der Schriftenreihe zusammengefasst.
2011 hat die SGGP erneut die wichtigsten Organisationen und Institutionen des schweizerischen Gesundheitswesens zu einer Plattform eingeladen, um Fragen des Föderalismus im Gesundheitswesen zu diskutieren.
Die Diskussion um Chancen und Risiken des Föderalismus im Schweizer Gesundheitswesen ist ein aktuelles Thema. Der Bund erlässt immer mehr Gesetze, die von den Kantonen ausgeführt und durchgesetzt werden. Beispiele dafür sind das Humanmedizingesetz, das Fortpflanzungsmedizingesetz, die Spitalfinanzierung und die Spitalplanung. Die Kantone beklagen, sie müssten zahlen, ohne mitbestimmen zu können, und sie sehen ihre Hoheit gefährdet. Die Kleinräumigkeit der Schweiz mit ihren 26 Gesundheitssystemen hat zwar Vorteile: Bürgernähe, kurze Wege, Berücksichtigung lokaler Gegebenheiten etc. Sie kann aber auch Entwicklungen behindern. So gibt es grosse Qualitätsunterschiede (z.B. in der Brustkrebsfrüherkennung und -behandlung), Doppelspurigkeiten (z.B. in der Spitzenmedizin), Verschwendung von Ressourcen durch den Protektionismus.
Wie könnte ein neues Steuerungsmodell für das Gesundheitswesen in der Schweiz aussehen? Zentralgesteuert, harmonisiert, kantonal gesteuert, multipartnerschaftlich entwickelt? Auf diese Fragen sollten die Akteure in der Schweizer Gesundheitspolitik Antworten finden.
Das Echo auf die Einladung zur Plattform war gross: Teilgenommen haben Vertreterinnen und Vertreter von Verbänden öffentlicher und privater Spitäler, der Pharmaindustrie, der Ärzte und Apotheker, des Roten Kreuzes, der Krankenversicherungen, der Patientenorganisationen, des Bundesamtes für Gesundheit, der Gesundheitsdirektorenkonferenz, von Gesundheitsligen und Public Health sowie Gesundheitsökonomen. In einem ersten Treffen wurden unter den Teilnehmenden Inhalt, Ablauf, Fragebogen und Input-Referate abgestimmt. Es folgten drei Workshops mit Referaten und Diskussionen. Im vorliegenden Band legen Autorinnen und Autoren der wichtigsten Stakeholder ihre Sicht über Stärken und Schwächen, Chancen und Gefahren des Föderalismus im schweizerischen Gesundheitswesen dar. In einer Synthese werden die verschiedenen Ansichten, Anliegen und Vorschläge zusammen gebracht.
Da sich das Thema in keiner Weise entschärft hat, entschloss sich die SGGP, diesen Sammelband in einem zeitlichen Abstand zu veröffentlichen. Die Beiträge dieses Bandes wurden von Plattformteilnehmern nach Abschluss der Plattform erstellt und für die Veröffentlichung aktualisiert.
Es geht der SGGP dabei nicht darum, eigentliche Ziele zu setzen, sondern sich mit den Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen und Grundlagen für neue Steuerungsinstrumente zu erarbeiten. Weitere angeregte Diskussionen zum Thema stehen bevor. Diese sollten sich um die Frage drehen, wie die Vorteile des Föderalismus (Bürgernähe, Labor und Wettbewerb für neue Ideen und Konzepte) besser genutzt werden können, ohne seinen grossen Nachteilen (regionaler Protektionismus in der Spitalversorgung, unheilsame Mehrfachrolle der Kantone als Regulator und Betreiber/Eigner von Spitälern und als Regulator derer Konkurrenz, teilweise technische Inkompetenz, teilweise Qualitätsdefizite, fehlende Datenlage, etc.) ausgesetzt zu sein?
Ohne die aktive Eliminierung der bestehenden Nachteile des Föderalismus riskieren seine Befürworter zu Recht, dass er durch zunehmende Bundeskompetenzen weiter ausgehöhlt wird. Dabei liegen die Chancen für einen neuen und aktiven Föderalismus auf der Hand: Durch Koordination von und Austausch über die kantonalen Initiativen und Tätigkeiten könnten die Kantone ein Knowledge-Management aufbauen und nutzen, in welchem gerade die vielen kantonalen Bestrebungen allen interessierten Kreisen – auch dem Bund – nutzbar gemacht würden: eine willkommene Quelle für Erneuerungen und Innovation in unserem Gesundheitswesen! Worauf warten wir?
2 Synthese der Herausgeber
Eleonore und Jürg Baumberger, Herausgeber der Schriftenreihe der SGGP
Im Zusammenhang mit dem Entwurf des Bundesrates zum Präventionsgesetz (2009) und der folgenden Parlamentarischen Debatte wurden verschiedene Steuerungsinstrumente einer Präventionsstrategie diskutiert. So sollten erstens Nationale Ziele (für acht Jahre) aufgestellt werden, die von Bund und Kantonen unter Mitwirkung von Fachkreisen verabschiedet werden sollen. Zweitens erarbeitet der Bundesrat eine Strategie für vier Jahre, die Anliegen und Meinungen von Kantonen und Fachkreisen berücksichtigt. Drittens sollen nationale Programme von Bund, Kantonen und Fachkreisen erarbeitet und umgesetzt werden. Viertens soll ein Kompetenzzentrum für Qualität, Evaluation, Support usw. eingesetzt werden.
An die Teilnehmer der Gesundheitsplattform der SGGP 2011 (s. Anhang) wurden grundsätzlich zwei Fragen gestellt:
- Sollte ein gleiches Steuerungsmodell im kurativen Bereich eingeführt werden? Und wie wäre es möglich, diese Bestimmungen auf Gesetzesbasis zu verankern? Gibt es dazu überhaupt seitens Bund und Kantonen sowie der weiteren Akteure einen politischen Willen?
- Wie sollte eine neue Kompetenzordnung in der Gesundheitspolitik aussehen und welche Chancen bestehen, dass sie realisiert wird?
Präziser wurde sodann gefragt:
Welche Themen, Bereiche, Verantwortungen in der Gesundheitspolitik sollten sinnvollerweise
- zentralisiert, d.h. national gesteuert werden?
- harmonisiert/standardisiert, aber nicht zentralisiert werden, d.h. national einheitlich, aber kantonal bzw. interkantonal gesteuert werden?
- regionalisiert, aber nicht zentralisiert werden, d.h. auf der Ebene von Regionen von ein bis zwei Millionen Einwohnern gesteuert werden?
- in Form einer Mischung von public-privat multipartnerschaftlich entwickelt werden?
Der Föderalismus im Gesundheitswesen steht in der Schweiz zur Diskussion (viel mehr als in anderen föderalen Ländern wie Deutschland, Österreich, Belgien, USA, Kanada, Australien usw. oder in dezentralisierten Ländern wie Italien und Spanien). Auf dieser Basis wurde auch bei der Gesundheitsplattform der SGGP fundiert debattiert. Zusammenfassend kann aus den Antworten und Vorschlägen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer folgendes Fazit gezogen werden:
Stärken und Schwächen des Föderalismus im Gesundheitswesen
Der Föderalismus im Gesundheitswesen, der in der Schweiz sehr stark ausgeprägt ist, wird von den Teilnehmenden im grossen und ganzen positiv bewertet, bei durchaus unterschiedlichen Standpunkten in Teilaspekten.
Positiv hervorgehoben werden der Wettbewerb unter 26 Kantonen, die Möglichkeit der staatlichen Steuerung, verbunden mit demokratischer Aufsicht. Örtliche Gegebenheiten fänden Berücksichtigung. Die Steuerung medizinischtechnischer Innovationen, die Investitionssteuerung sowie die Steuerung der Ressourcen (Ausbildung, Forschung, Innnovationen) führten zu gutem Einsatz des Knowhows sowie zu guter Handhabung der Belastungen, der Ausgaben und der Finanzierung. Bürger- und patientennahe massgeschneiderte Versorgung, Partizipation und Diversität ermöglichten hohe Qualität und Dienstleistung am Patienten. Diesen – nicht unumstrittenen – positiven Aspekten stehen die Probleme gegenüber, die die Teilnehmer im Föderalismus des Gesundheitswesens ausmachten, und die sich auch in den Beiträgen dieses Sammelbandes widerspiegeln.
Die Schwächen des Föderalismus im Gesundheitswesen, die von den Teilnehmenden aufgelistet werden, sind eine Spiegelung dieser Stärken. Der Wettbewerb führe zu Konkurrenz und regionalem Protektionismus. Der Preiswettbewerb und Qualitätswettbewerb, die Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten führten zu mangelnder Planung vor allem in der Spitzenmedizin und zur Bevorzugung des Einheimischen. Hervorgehoben werden auch Doppelspurigkeiten, Überversorgung, die kleinräumige, zersplitterte Spitallandschaft sowie die Reproduktion der Strukturen in Organisationen.
Der Diversität des schweizerischen Gesundheitssystems stehen nach Ansicht der Teilnehmenden an der Plattform auch technische Inkompetenz, Qualitätsdefizite (uneinheitliche bzw. fehlende Qualitätsstandards), fehlende Daten über Ergebnisqualität sowie ein grosses regionales Qualitätsgefälle (Beispiel Brustkrebs) gegenüber. Die Zersplitterung und die Kleinheit der 26 Systeme führten zu Ineffizienz, sowie zu ungenügenden intellektuellen und personellen Ressourcen für die Steuerung der Gesundheitspolitik. Sie verteuerten die Leistungen. Verwiesen wird auch auf den Widerstand der Kantone bei der Umsetzung von übergeordnetem Recht wie etwa bei der freien Arzt- und Spitalwahl sowie des vom eidgenössischen Parlament gewollten regulierten Wettbewerbs. Es gebe häufig Widerstand gegen die Empfehlungen der Gesundheitsdirektorenkonferenz GDK bzw. gegen gemeinsame Entwicklungen in Nachbarkantonen. Die Entscheidungsträger in den Kantonen wichen häufig dem lokalen Druck. Gleichlange Spiesse für Privatspitäler würden verhindert. Der Föderalismus im Gesundheitswesen sei ungeeignet zur Lösung nationaler Probleme sowie für den Umgang mit den Folgen des demographischen Wandels.
Chancen und Gefahren des Föderalismus im Gesundheitswesen
Dennoch sehen die Teilnehmenden an der Gesundheitsplattform SGGP 2011 auch Chancen des Föderalismus im Schweizer Gesundheitswesen. Der Föderalismus sei ein Labor für Innovationen, denn es sei leicht möglich, die richtigen Partner zu finden. Eine schnelle Reaktion auf Bedarf und Lücken sei möglich. Der Föderalismus könne ein Katalysator für kleine Reformen im Gesundheitswesen sein. Das bestehende Knowhow könne optimal genutzt werden, massgeschneiderte Lösungen, ausgerichtet an lokalen und regionalen Bedürfnissen seien möglich. Bürger- und Patientennähe führten zu Legitimation und häufig zu Akzeptanz – ausser bei Spitalschliessungen.
Diesen Chancen stehen viele Unzulänglichkeiten gegenüber. Die Vervielfachung der Institutionen und Kosten, die Zersiedelung des Gesundheitswesens führen nach Ansicht der Teilnehmenden an der Gesundheitsplattform zu Ineffizienz und zur Verhinderung von Synergien. Die Kantone seien zu kleine Einheiten für sinnvolle medizinische und ökonomische Versorgungsregionen. Die Kantone nähmen zu viele, zum Teil widersprüchliche Rollen ein. Die Komplexität der Systeme behindere die Bewältigung der anstehenden Probleme. Die Kantone seien sehr oft Reform unwillig, was beispielsweise auch die klinische Forschung gefährde.
Reformanliegen an den Föderalismus im schweizerischen Gesundheitswesen
Aus dieser Analyse der Stärken und Schwächen, der Chancen und Gefahren des Föderalismus im Gesundheitswesen ergeben sich Anliegen nach gezielten Reformen unter Verwendung verbindlicher und messbarer nationaler Ziele
Es gilt dabei in erster Linie die Rolle der Kantone zu klären. So könnten die Kantone entweder auf die Rolle des Mitspielers verzichten und nur noch behördliche Aufgaben übernehmen, oder Mitspieler bleiben und auf die Rolle als massgebende Behörde verzichten. Die vertikale und horizontale Kooperation zwischen Bund und Kantonen und unter den Kantonen müsse gestärkt werden. Nationale Rahmenbedingungen, erarbeitet in einem nationalen Dialog, sollten vorgegeben werden, um einheitliche Gesundheitsziele zu erreichen und durchzusetzen. Der Ausbau nationaler Programme (zurzeit – seit 1986 – mehr als zwanzig und oft in harter Konkurrenz untereinander stehend, darunter: HIV-Aids, eHealth, palliative care, Krebsprogramme) könnte dabei helfen, soweit sie von der Mehrheit der Kantone umgesetzt werden, wie es heute in den Bereichen Tabakprävention und Bewegung/Ernährung der Fall ist. Die Evaluation von Leistungen durch Einführung eines Health Technology Assessments würde zu mehr einheitlicher Qualität und Effizienz führen. Planungsmechanismen für grössere Regionen über die Kantonsgrenzen hinweg könnten dazu beitragen, die Nachteile der Kleinräumigkeit und des „Kantönligeistes“ zu überwinden.
Lösungen aus dem Dilemma zwischen regionaler und lokaler Beharrlichkeit einerseits und überregionaler oder zentraler Steuerung und Koordination andererseits muss quasi in der Schnittmenge von Bund und Kantonen gefunden werden. Aus dieser Position des gleichsam top-down-bottom-up heraus können die Vorteile des Föderalismus genutzt und die Nachteile in den Griff bekommen werden. Nur hier kann der notwendige Konsens entstehen.
Positive Ansätze dazu gibt es im Bereich des seit 2003 geführten „Dialog nationale Gesundheitspolitik“. Ein mögliches Vorgehen wird in der Forderung nach Stärkung der GDK deutlich, die verbindlichere Beschlüsse zur Verpflichtung der Mitgliederkantone fassen können und mehr fachliche Ressourcen haben sollte.
Das Beharrungsvermögen der auf föderaler Autonomie und Selbstbestimmung beharrenden Kräfte ist jedoch gross: dessen Überwindung erfordert Kraft und Ausdauer. Die Plattform Föderalismus der SGGP war ein Beitrag dazu.
3 Gesundheitspolitik im föderalen System
Reformansätze von Bund und Kantonen
Dr.rer.pol. Stefan Spycher
Dr. med. MPH Margreet Duetz Schmucki
Dr. med. MPH Margreet Duetz Schmucki
In der Schweiz wird die Politik vom Föderalismus geprägt. Dieser Umstand wird sowohl breit getragen wie auch konstant diskutiert und in Frage gestellt. Die Gesundheitspolitik ist diesbezüglich keine Ausnahme, auch hier zeichnet sich kein stabiler Konsens bezüglich der „richtigen“ föderalen Organisation ab.
Das föderalistische System weist Stärken und Schwächen auf – auch in der Gesundheitspolitik. Positiv ist beispielsweise, dass die regionsspezifischen Bedürfnisse Berücksichtigung finden und dass „bottom-up“ innovative Projekte entstehen können. Zudem ist – wo notwendig – eine differenzierte, kantonsspezifische Optimierung möglich. Die Akzeptanz des föderalistischen Systems ist in der Bevölkerung und bei vielen Akteuren entsprechend hoch. Dennoch wird oft auch auf Schwächen hingewiesen. Genannt werden etwa die Ineffizienzen, die durch die Kleinräumigkeit entstehen können, die mangelnde Steuerbarkeit des Gesamtsystems sowie die grossen Unterschiede zwischen den Kantonen, welche die Rechtsgleichheit in Frage stellen könnte. Die OECD und WHO haben in ihren Berichten 2006 und 2011 pointiert auf diese Punkte hingewiesen.
Die Rollen von Bund und Kantonen1
Die Prinzipien des Föderalismus – Subsidiarität und Liberalismus – prägen die Aufgabenteilung in der schweizerischen Gesundheitspolitik. (Achtermann/Berset, 2006, 29 ff.). Gemäss der Verfassungsordnung (Art. 3 BV) übt der Bund lediglich diejenigen Aufgaben aus, die ihm explizit übertragen wurden. Die übrigen Aufgaben kommen entweder den Kantonen und Gemeinden oder nichtstaatlichen Akteuren zu. Im Gesundheitssystem nehmen sowohl der Bund als auch die Kantone zentrale Aufgaben wahr.
Der Bund hat im Gesundheitsbereich namentlich folgende Kompetenzen:
- Prävention und Schutz der Bevölkerung vor Gesundheitsrisiken
- Regulierung der Reproduktions- und Transplantationsmedizin, der medizinischen Forschung und der Gentechnologie
- Regulierung der akademischen Ausbildung von Ärzten und Apothekern sowie der Aus- und Weiterbildung aller nicht universitären Gesundheitsberufe
- Regulierung und Aufsicht der Sozialversicherungen (Krankenversicherung, Unfallversicherung usw.) und der Zusatzversicherungen
- Stärkung der medizinischen Grundversorgung (in Zusammenarbeit mit den Kantonen)
Die gesundheitspolitischen Zuständigkeiten des Bundes wurden während der vergangenen 30 Jahre ausgebaut. Zum einen wurden dem Bund ausdrücklich neue Kompetenzen zugeteilt, sei es durch die Verschiebung von den Kantonen an den Bund (z.B. die Heilmittelkontrolle), sei es durch die Definition ganz neuer Aufgaben (z. B. die Regulierung der Fortpflanzungsmedizin). Zum anderen übernahm der Bund aus eigenem Antrieb Aufgaben im Rahmen verschiedener nationaler Programme in den Bereichen Gesundheitsförderung und Prävention (Achtermann/Ber...
Inhaltsverzeichnis
- Spannungsfeld Föderalismus
- Inhalt
- 1 Einleitung
- 2 Synthese der Herausgeber
- 3 Gesundheitspolitik im föderalen System
- 4 Un parcours de quarante ans
- 5 Public Health zwischen Föderalismus und Chancengleichheit
- 6 Stärken bewahren, Chancen nutzen
- 7 Kompetenzen neu verteilen
- 8 Zwischen gesundem Wettbewerb und kranker Versorgung
- 9 Ergebnisse messen, Versorgungsregionen optimieren, Ziele definieren
- 10 Handlungsbedarf
- 11 Politische Steuerung im schweizerischen Föderalismus am Beispiel der stationären Gesundheitsversorgung
- 12 Anhang