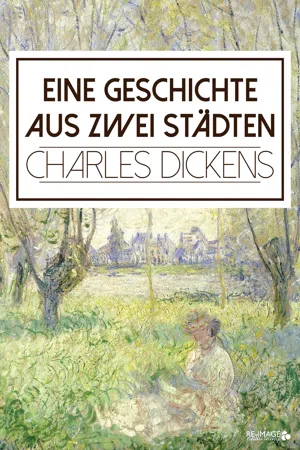![]() Zweites Buch. Der goldene Faden
Zweites Buch. Der goldene Faden
![]()
Erstes Kapitel: Fünf Jahre später
Tellsons Bank bei Temple Bar war schon im Jahr eintausendsiebenhundertundachtzig ein altmodisches Haus, sehr klein, sehr dunkel, sehr häßlich und sehr unbequem. Man konnte sie aber auch ein altmodisches Haus mit Beziehung auf die moralische Eigentümlichkeit nennen, daß jeder der Geschäftsteilhaber stolz war auf das kleine Gebäude, stolz auf seine Dunkelheit, stolz auf sein garstiges Aussehen und stolz auf seine Unbequemlichkeit. Diese Eigenschaften schienen ihnen sogar hohe Vorzüge zu sein, denn sie lebten der zuversichtlichen Überzeugung, daß die Bank, wenn man weniger an ihr zu tadeln wüßte, auch weniger achtbar wäre. Dies war indes nicht nur ein passiver Glaube, sondern eine aktive Waffe, die sie gern gegen bequemer eingerichtete Geschäftsräumlichkeiten schleuderten. Tellsons – sagten sie – brauchen keinen überflüssigen Raum, kein Licht, keine Verschönerung. Noakes & Co. oder Gebrüder Snooks werden es nötig haben; aber Tellsons? Dem Himmel sei Dank, nein!
Jeder von den Geschäftsteilhabern würde seinen Sohn enterbt haben, wenn dieser an einen Umbau von Tellsons gedacht hätte. In dieser Beziehung erging es dem Hause gerade wie England, das sehr oft seine Söhne enterbte, weil sie Verbesserungen an Gesetzen und Bräuchen beantragten, die nichts weniger als löblich, aber eben deshalb um so achtbarer waren.
So hatte sich's denn gemacht, daß Tellsons die Unbequemlichkeit in höchster Vervollkommnung darstellten. Nachdem man eine blödsinnig hartnäckige Tür aufgedrückt hatte, die abscheulich knarrte, fiel man bei Tellsons ein paar Stufen hinab und kam in einem erbärmlichen Lädchen mit zwei kleinen Zahltischen wieder zur Besinnung, wo in den Händen der ältesten Männer der Wechsel eines Kunden wie im Winde zitterte, solange sie die Unterschrift an den schmutzigsten von allen Fenstern prüften, die von der Fleetstraße aus unter dem Einfluß eines ständigen Schlammregenbades standen und vor den eigenen eisernen Gittern und in dem tiefen Schatten von Temple Bar sich nur um so schmutziger ausnahmen. War jemand genötigt, Geschäfte halber mit dem ›Haus‹ zu verkehren, so wurde er an der Hinterseite in eine Art Verbrecherzelle gesteckt, wo er über ein übel zugebrachtes Leben nachdenken konnte, bis das ›Haus‹, die Hände in den Taschen, erschien, in dem unheimlichen Zwielicht aber sich kaum erkennen ließ. Die Geldbehälter, die der Ein- oder Auszahlung dienten, bestanden aus alten hölzernen Schubladen, aus denen beim Herausziehen oder Zurückschieben das Wurmmehl einem in Nase und Kehle flog. Die Banknoten hatten einen modrigen Geruch, als seien sie im Begriff, sich rasch wieder zu Lumpen zu zersetzen. Das anvertraute Silbergerät wurde in der Nachbarschaft von Senkgruben deponiert, deren üble Dünste seinen Glanz in wenigen Tagen verdarben. Die Urkunden fanden ein Unterkommen in aus Küchen und Spülräumen improvisierten Archiven, und ihre Pergamente verloren in der Bankhausluft vor Ärger all ihr Fett. Leichtere Faszikel mit Familienpapieren gingen die Treppe hinauf nach einem Saal, in dem stets ein großer Speisetisch stand, aber nie etwas verspeist wurde; und es war in dem Jahre eintausendsiebenhundertundachtzig noch nicht lange her, daß man die Familienbriefe, die der Engländer statt dem Notar dem Bankier zu übergeben pflegt, vor dem Schrecken befreit hatte, durch die Fenster von Köpfen angestarrt zu werden, die man mit der eines wilden Negers würdigen Roheit auf Temple Bar zur Schau zu stellen pflegte.
Doch damals war das Zu-Tode-Bringen ein bei allen Geschäftszweigen und Berufsarten sehr beliebter Prozeß, und so auch bei Tellsons. Der Tod ist das Heilmittel gegen alles; warum sollte ihn nicht die Gesetzgebung im gleichen Lichte betrachten? Demgemäß traf den Fälscher Todesstrafe, den unrechtmäßigen Eröffner von Briefen Todesstrafe, den armen Schelm, der vierzig Schillinge und sechs Pence stahl, Todesstrafe, den Burschen, der an Tellsons Tür ein Pferd hielt und sich damit davonmachte, Todesstrafe, den Münzer eines falschen Schillings Todesstrafe; kurz, auf drei Vierteilen der Noten in der Tonleiter des Verbrechens stand der Tod. Nicht daß dadurch auch nur im mindesten vorbeugend gewirkt worden wäre – man könnte fast eher das Gegenteil behaupten –, sondern das summarische Verfahren räumte für diese Welt mit den Angelegenheiten jedes einzelnen Falles auf, und es wurde später nicht nötig, sich weiter damit zu befassen. So waren auch in ihrer Zeit Tellsons gleich anderen größeren Geschäftshäusern jener Periode schuld an so viel zerstörtem Leben, daß das bißchen Licht des Erdgeschosses wahrscheinlich in einer ziemlich bedeutsamen Weise beeinträchtigt worden wäre, wenn man, statt sie im stillen zu bestatten, auch die Köpfe ihrer Opfer insgesamt über Temple Bar aufgepflanzt hätte.
In alle Arten von dunklen Kästen und Verschlägen eingeengt, führten bei Tellsons die ältesten Männer gravitätisch das Geschäft. Nahmen sie je einmal einen jungen Menschen in Tellsons Londoner Haus, so versteckten sie ihn irgendwo, bis er alt war. Sie verwahrten ihn, gleich dem Käse, an einem dunklen Platz, bis er den vollkommenen Duft und Schimmel von Tellsons angenommen hatte. Dann erst wurde es ihm gestattet, in Hosen und Gamaschen, über großen Büchern brütend, sich von jederman anstaunen zu lassen und so der Würde des Hauses zu dienen.
Außen vor Tellsons – aber ja nie innen ohne besonderen Auftrag – sah man regelmäßig einen Aushelfer, der als Bote und Träger beschäftigt wurde und als lebendiges Hausschild diente. Er fehlte nie während der Bürostunden, wenn er nicht etwa einen Auftrag zu besorgen hatte, und in diesem Falle wurde er durch seinen Sohn, einen abscheulichen Knirps von zwölf Jahren, der sein getreues Ebenbild war, vertreten. Die Leute waren der Meinung, Tellsons duldeten dieses Anhängsel um der Ehre des Hauses willen, weil man immer eine Person in dieser Eigenschaft geduldet hatte und im Laufe der Zeit die gegenwärtige auf den Posten geraten war. Der Mann hieß Cruncher mit seinem Familiennamen und hatte bei der Taufe, als er durch einen Stellvertreter den Werken der Finsternis entsagte, in der öffentlichen Pfarrkirche von Houndsditch die weitere Benennung Jerry erhalten.
Schauplatz: Mr. Crunchers Privatwohnung in Haning Sword Alley, Whitefriars. Zeit: halb acht Uhr an einem windigen Märzmorgen Anno Domini siebzehnhundertundachtzig. (Mr. Cruncher selbst nannte das Jahr unseres Herrn Anna Domino, augenscheinlich unter dem Eindruck, daß die christliche Zeitrechnung sich von der Erfindung eines beliebten Volksspiels durch eine Dame herschreibe, die dem Spiel ihren Namen beigelegt habe.)
Mr. Crunchers Wohngelasse lagen in keiner durch gesunde Luft sich empfehlenden Gegend und waren nur zwei an der Zahl, selbst wenn man den mit einer einzigen Glasscheibe versehenen Alkoven mitrechnete. Doch sah es darin sehr anständig aus; denn trotz dem windigen frühen Märzmorgen war die Stube, in der er noch zu Bette lag, bereits sauber gefegt, und über den groben Fichtenholztisch, auf dem die Frühstückstassen standen, lag ein reinliches Tischtuch gebreitet.
Mr. Cruncher ruhte unter einer aus verschiedenfarbigen Fleckchen zusammengesetzten Decke wie ein Harlekin in seinem Heimwesen. Anfangs schlief er tief; aber allmählich begann er im Bette hin und her zu wogen, bis er mit seinem Stachelhaar, das die Überzüge in Fetzen zu reißen drohte, an der Oberfläche auftauchte. Nachdem er so weit gekommen war, rief er in einem Tone, der grimmige Gereiztheit verriet:
»Alle Hagel, macht sie das schon wieder!«
Eine Frauensperson von ordentlichem und emsigem Aussehen erhob sich in einer Ecke von ihren Knien, und zwar mit einer Hast und Ängstlichkeit, die andeutete, daß sie die gemeinte Person sei.
»Wie!« rief Mr. Cruncher, aus dem Bett heraus sich nach seinen Stiefeln umsehend, »machst du das schon wieder, he?«
Nachdem er den Morgen mit diesem zweiten Gruß bewillkommnet hatte, warf er als dritten der Frau einen Stiefel nach. Es war ein sehr schmutziger Stiefel, und wir können hier eine sonderbare Eigentümlichkeit aus Mr. Crunchers häuslicher Ordnung berühren, daß er nämlich, während er oft nach den Bürostunden mit sauberen Stiefeln nach Hause kam, nicht selten beim Aufstehen dieselben Stiefel beschmutzt fand.
»Nun«, rief Mr. Cruncher, nachdem er sein Ziel verfehlt hatte, mit einer Abwandlung seines Anrufes, »was tust du da, Widerwart?«
»Ich habe nur mein Gebet gesprochen.«
»Gebet gesprochen – du bist mir ein sauberes Weibsstück! Was soll das heißen, daß du dich hinschmeißt und gegen mich betest?«
»Ich habe nicht gegen dich gebetet, sondern für dich.«
»Ist nicht wahr. Und wenn's auch wahr wäre, so soll man sich doch mit mir keine solche Freiheit erlauben. Hörst du, Jerry, deine Mutter ist eine feine Person und geht hin, um gegen deines Vaters Wohlfahrt zu beten. Ja, mein Sohn, du hast eine pflichtgetreue Mutter, du hast eine fromme Mutter, Junge – sie geht hin, plumpst auf den Boden und betet, daß ihrem einzigen Kinde das Butterbrot aus dem Munde genommen werden möge!«
Der junge Herr Cruncher, der im Hemde dastand, nahm dies sehr übel und verbat sich, gegen seine Mutter gewandt, alles auf seine persönliche Verköstigung sich beziehende Gebet. »Und was meinst du, du eingebildetes Weib«, fuhr Mr. Cruncher in nicht geahntem Widerspruch fort, »was wohl dein Gebet wert sein mag? Sag, wie hoch schlägst du dein Gebet an?«
»Es kommt nur aus dem Herzen, Jerry, und ist nicht mehr wert als das.«
»Nicht mehr wert als das?« wiederholte Mr. Cruncher. »Dann ist's mit seinem Werte nicht weit her. Wie dem übrigens sei, ich erkläre dir, daß nicht gegen mich gebetet werden soll. Ich kann das nicht brauchen für meine Haushaltung und will mich nicht durch deine Schleicherei unglücklich machen lassen. Wenn du dich schon hinschmeißen willst, so tue es für deinen Mann und dein Kind und nicht gegen sie. Hätte ich nicht ein so unnatürliches Weib und dieser arme Knabe eine unnatürliche Mutter, so wär mir sicherlich in der letzten Woche einiges Geld zugeflossen, statt dessen aber muß ich gegen mich beten, mich unterminieren und auf die schlimmste religiöse Weise zugrunde richten lassen. Hol mich der Henker«, sagte Mr. Cruncher, der diese ganze Zeit über damit beschäftigt gewesen war, sich anzuziehen, »wenn ich n...