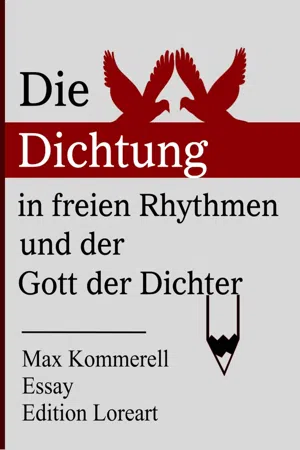
- 55 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Max Kommerells Deutung dichterischer Werke trug wesentlich zur Entwicklung der modernen Textinterpretation bei. "Die Dichtung in freien Rhythmen und der Gott der Dichter" ist ein Essay über Goethes freie Rhythmen, die Hymnen an die Nacht von Novalis, Hölderlins Hymnen in freien Rhythmen, Nietzsches Dionysosdithyramben und Rilkes Duineser Elegien. Max Kommerell ist der bedeutendste Literaturwissenschaftler, der aus dem George-Kreis hervorging, und er gilt als Begründer der Komparatistik.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Dichtung in freien Rhythmen und der Gott der Dichter von Max Kommerell im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literatur & Literaturkritik in der Dichtkunst. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Hölderlins Hymnen in freien Rhythmen
Hölderlins Hymnen in freien Rhythmen, die seit dem Sommer 1800 seine vorwiegende Form sind und die letzte Schicht seines Werkes bilden, überraschen uns mit Tonfällen und Wendungen, die, auch im Werke Hölderlins neu, in der deutschen Sprache und vielleicht überhaupt zum ersten Male erklingen. »Vom Äther aber fällt Das treue Bild«, »Die Natur ist jetzt mit Waffenklang erwacht«, das sind einzelne Zeilen, die wie Orakelsprüche lauten; die Ganzheit der Gebilde aber, für deren durchgängigen Stil sie nur ein Beispiel sind, ist schwer zu beschreiben. Lesend hält man immer wieder inne und fragt: Von welchem Standort, mit welchem Fug und auf welche Wirklichkeit sich beziehend spricht eigentlich der hier Sprechende? Die Frage verstummt angesichts einer kaum für möglich gehaltenen Pracht und Monumentalität der Landschaft, der so fremdartigen und doch zwingend einfachen Darstellung heiliger Vorgänge und einer sprachlichen Kunst, die das Letzte an Wohllaut mit dem Letzten an Architektur vereinigt; doch da in der grenzenlos fordernden Aussage die Dichtung, die uns bannt, immer wieder über sich hinausschreitet, erhebt sich die Frage neu, und wird um so verwirrender, als der Grundton einer hohen Kindlichkeit sich nirgends verkennen läßt, das Bewußtsein also, nach dessen Ort und Grund wir suchen, selbstverständlich sicher und weder gesucht noch erzwungen ist.
Eine Dichtart, die sich durchaus in heiligen Zusammenhängen bewegt! Die Vorbilder Pindar und Horaz, die Griechenverehrung des 18. Jahrhunderts erklären ihn nicht. Zu einem pindarischen Siegesgesang können wir die Götter und ihre Kulte und sogar auch das Zeremoniell angeben, das den Beruf des Dichters und seinen Anteil an der Feier festlegt; der heilige Zusammenhang aber, aus dem Hölderlin spricht, ist für uns nur aus seiner Dichtung ablesbar, in nichts anderem gegeben.
Diese Hymnen, umfänglicher und gegliederter als deutsche Lyrik sonst, lehnen sich in der Form an Pindar an, sofern ihre Strophen nach der Dreizahl geordnet sind und, in sich von großem Umfang, sich in den Elementen ihres Baus stark differenzieren, sofern endlich höchst gegliederte Perioden auf ein nicht minder gegliedertes rhythmisches Gefüge verteilt sind. Wie verschieden können freie Rhythmen sein! Wenn sie wie bei Goethe aus wesentlich gleichartigen Elementen bestehen, strömen sie schneller. Hölderlin hat das langsamste Tempo, die feierlichste Gangart, freilich auch den am weitesten reichenden Atem und Wurf und die größten Spannungen innerhalb derselben Hymne. Er bewegt sich zwischen drei Tonarten, einer berichtenden (in dem Sinne, daß ein Geschehenes berichtet wird, das der Deutung bedarf), einer reflektierenden (welche die Deutung aus jenem heiligen Zusammenhang heraus vorträgt) und einer eigentlich lyrischen (welche die in diesem Zusammenhang schicklichen Affekte zum Ausdruck bringt).
Vielleicht darf man, wenn man für die Oden, die Elegien und die Hymnen Hölderlins nach einem sondernden Merkmal sucht, soviel behaupten: die Oden sind Stimmungen, die Elegien Feiern, die Hymnen Deutungen. An der hölderlinschen Stimmung läßt sich zeigen, wie sehr seine Oden von sonstiger Lyrik verschieden sind und wie sie jenen bereits ausgesprochenen, heiligen Zusammenhang, der durch Hölderlins ganze Dichtung reicht, mit dem persönlichen inneren Leben Hölderlins verbinden, das zwar nur der Anfang dieses Zusammenhangs ist, aber als Anfang entscheidet und durch keinen Versuch, Hölderlin dogmatisch auszulegen, in seiner Würde geschmälert werden kann. Stimmungen nämlich sind bei Hölderlin nicht bloß der jeweilige Zustand der Seele und nicht bloß aus einem jeweiligen Anstoß erregt; und mag man auch bei andern Dichtern die Stimmungen zusammenfassen zu einer fest bestehenden Eigenheit des Fühlens, so enthalten Hölderlins Oden, dem genau Lesenden auch jede für sich, ein Gestimmtsein auf etwas als natürliche Anlage. Dies Etwas ist die freudige Einheit des Lebens in allen seinen Scheidungen, die in der Natur von Anfang und mühelos ergriffen wird, so daß der Naturgesang als ein Vermitteln, als ein Herstellen des Einen im Geteilten, die eigentliche Seligkeit dieser Dichtungen ist. Der Akt, durch den das Leben des Menschen von dieser Einheit zeugen kann, ist ihre Begegnung mit sich selber im menschlichen Geist, der sich freiwillig dadurch begrenzt, daß er diese Einheit darstellt, und schließlich in sie zurückkehrt. Je nach dem Grade, in dem sich die menschliche Kultur von diesem ihrem ersten Sinn entfernt hat, erwachsen dem Dichter, sofern er Mensch unter Menschen ist und eine Epoche hat, seine Leiden und Beleidigungen. Als ein auf sie Gestimmter weiß Hölderlin von Anfang an seine Götter und ist ihnen eigen; sein Leiden ist, daß sie nur in ihm sind, und ihm durch die Verwirrung des Lebensgefühls, die dieser nur inwendige Kult ihm selber bringen muß, auch sein Anteil an den Göttern zur Frage wird. Von den beiden Hauptthemen der Ode, dem Naturgesang und der Klage um das menschliche Leben, schreitet die Dichtung zum Innewerden des Momentes fort: einem zunächst tragischen Innewerden. Dem Dichter wird offenbar, daß er seine Art, die Götter zu kennen, und die ihnen entfremdete Zeit nicht völlig scheiden kann, als ob seine Götterverehrung unbewegt in den Zeitbewegungen verharren würde, sondern daß auch er auf eine doppelte Weise ein Bewegtes in diesen Bewegungen ist: sein Verehren der Götter hat, gewaltsam-innig, einzeln und zeichenlos, wie es in Umkehrung und Ausgleich des Zeitalters ist, dessen Merkmal an sich, ist seiner Form nach Schicksal, und diese Götter selbst sind scheidende, sich verweigernde Götter.
Die Elegien, die sich nach und neben den Oden befestigen und noch eine Weile die Hymnen begleiten, gründen nun den heiligen Zusammenhang unabhängig vom Dichter, indem sie aus bestimmten Sphären - Griechenland, Liebe, Heimat, Zeitalter - das Göttliche dieser Sphäre hervorrufen und das Tun des Dichters in ihr zeigen. Dabei ist aber die Trauer jenes von Hölderlin erkannten Augenblicks, die Trauer um den zwar seienden und gefühlten, aber in den Beziehungen der Menschen nicht anwesenden Gott, der Feier beigemischt, so daß sie etwas Vergebliches, am Ende sich Bescheidendes hat. Die Elegie ›Brot und Wein‹ leitet über zu den Hymnen. Das Überleitende ist: die gewonnene Deutung eines Wendepunktes in der Vergangenheit, nämlich der Erscheinung von Christus als letztem Gott - ein Abschied, in dem sich die Gottheit für immer aus dem Leben zurücknimmt - und das Begreifen der Epoche seither, und noch des gegenwärtigen Momentes, in dem der Dichter sein Schicksal hat, aus diesem Wendepunkt. Damit werden Formen des geschichtlichen Bewußtseins in Hölderlins Dichtung mächtig und eröffnen jenen heiligen Zusammenhang auf neue Art. Es sind nun vor allem zwei Vorgänge in Hölderlins Geist zu begreifen: Der Zeitgeist, der für Hölderlin auch zur Sphäre wird, über der ein Gott, nämlich der Zeitengott waltet, ist nicht ein Wahrgenommenes unter anderen, für sich bestehenden Wahrnehmungen Hölderlins, sondern der ganze heilige Zusammenhang, von dem ich sprach, das Naturleben und die Götterwelt Hölderlins, erschließen sich jetzt neu. Vorher waren sie ein Sein, jetzt sind sie ein Werden, genauer: ein Geschehen, das Zeichen ankündigen; die Götter kommen oder gehen, wenden sich zu oder ab, winken und drohen, und der Gang des Lichts, die Tageszeiten, die Jahreszeiten, das Gewitter und alles, worin Hölderlin sonst die Gebärden des gegen ihn aufgeschlossenen Allebens vernahm, wird ihm nun Orakel, Wahrzeichen und Wink, meint ein bevorstehendes, sich vollziehendes oder vollendetes Geschehen, dessen Enträtselung dem Dichter obliegt. So ist das Gedicht des Dichters jetzt durchweg das zweite Wort, die Antwort auf das Wort, das der Gott gesprochen hat. Dies ist der eine Vorgang. Der andere ist dies: der tragische Augenblick, als welchen Hölderlins Zeitbewußtsein die Gegenwart erfuhr, wird umfänglicher begriffen als ein Aufgang im Untergang; denn das Gefühl der leeren, im Sinn jenes Zusammenhangs müßigen Zeit, jene Langeweile sublimerer Art war nicht möglich, ohne eine geheime Vorweg- nahme des gegenteiligen Zustands, die nicht auf einen scheidenden, sondern auf einen sich nähernden Gott weist. Jetzt also (und das ist das neue Wissen der die Reihe eröffnenden Hymne ›Wie wenn am Feiertage‹) sind die Götter nicht, sie geschehen. Aber wie vorher das Göttliche Sein nur im Gedicht des Dichters sich selber feierte, so ist dies Geschehen gleichfalls verborgen und verständigt nur den Dichter durch Zeichen. Zeichen und Zeichendeutung häuft sich in Hölderlins Dichtung, mehr noch: das Zeichen wird schlechthin die Wahrnehmungsform. Aus Zeichen bestimmt Hölderlin den Gang jenes Geschehens und die Reife, bis zu welcher es gedieh ; er sieht, er deutet und er befolgt. Die Sicherheit wird so unbedingt, daß er nicht mehr wie in den Elegien jeweils eine Sphäre erst zu gründen braucht, sondern in pindarischer Weise zum Konkreten einer positiven Mythenbildung übergehen kann. Mythisch ist der Umriß dieser Hymnen also nicht sowohl von einem göttlichen Sinn, als von einem göttlichen Geschehen aus, und zwar so, daß ein Zusammenhang des Wissens in jeder Einzelheit vorausgesetzt und gegenwärtig ist, die etwas über den Lauf eines Stroms, über Christus und seine Jünger, über eine deutsche Landschaft oder über die Schwere eines vielverkündenden Himmels aussagt. In diesem Sinne sind Hölderlins Hymnen Deutungen.
Es ist einer der merkwürdigen Fortschritte der Geistesgeschichte, daß der Inhalt dieser Hymnen, deren Unentwirrbar keit noch gestern der Umnachtung Hölderlins zur Last gelegt wurde, durch mehr oder weniger tiefsinnige Exegesen popularisiert heute in aller Mund ist. Es sei also hier die Rede von etwas weniger Beredetem: von dem jeweiligen Vor wand! Dieser Vorwand, unter welchem eine Deutung vorgebracht wird, hieße nach älterer Sitte etwa die Einkleidung und behandelt die Art und Weise, wie dem Dichter eine Einsicht zukommt. Er wird in berichtendem Ton vorgetragen und hat selten den feierlichen Ernst der eigentlichen Kunde. Nach Hölderlins Gegensatzlehre, die das Zentrum seiner Ästhetik ist, wäre vielleicht in diesem scheinbar weniger verbindlichen, im eigentlichen Sinn poetischen Vorwand das den Dichter betreffende Schicksal, sein notwendiges Stehen und Standhalten unter einer Eingebung zu suchen.
Er grüßt in der Hymne ›Am Quell der Donau‹ Asien, die Mutter: sie sandte den Völkern die große Begeisterung, die zuletzt ihn selber erreicht - er grüßt Asien mit »Donauwoge«, d. h.: Umgekehrt zu der Bahn, die diese Begeisterung vom Orient nach Griechenland und Italien genommen hat, und so, daß sein Gesang ihr letztes Echo wird, den Wellen des Stromes folgend. Nun erst sagt er das geschichtliche Geschehen selber an unter dem Bilde der Orgel und des ihr antwortenden Chores. Es ist das Geschehen schlechthin, wie es die großen, zur Gotterfahrung berufenen Völker nacheinander formt. Die Menschen bildende Stimme, die zu ihnen kommt, und die Antwort, die sie darauf finden und die nun in neuer Weise zu finden sein wird.
Am Quell eines andern Stromes sitzend, des Rheins, denkt der Dichter anderes. In wenigen Zeilen der Rheinhymne wird Umgebung und Tageszeit zu dem auf ihn sich beziehenden, ihn suchenden Zeichen: »Der goldene Mittag«, nicht minder wesentlich, nicht minder erfahren als der »entzückende Sonnenjüngling« jener Ode, die ›Sonnenuntergang‹ hieß, kommt die Treppe des Alpengebirges herunter, das ihm »Burg der Himmlischen« heißt. Nichts wird genannt, wie die Menschen es nennen, sondern so, wie es innerhalb jenes heiligen Zusammenhangs sich selber nennt. »Nach alter Meinung« »geheim« und »entschieden« - diese Worte sagen, daß der Dichter im Einklang mit mythischer Denkart...
Inhaltsverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- Titelseite
- Die Dichtung in freien Rhythmen und der Gott der Dichter
- Goethes freie Rhythmen
- Novalis: Hymnen an die Nacht
- Hölderlins Hymnen in freien Rhythmen
- Nietzsches Dionysosdithyramben
- Rilkes Duineser Elegien
- Über den Autor
- Impressum
- Hinweise und Rechtliches
- E-Books Edition Loreart: