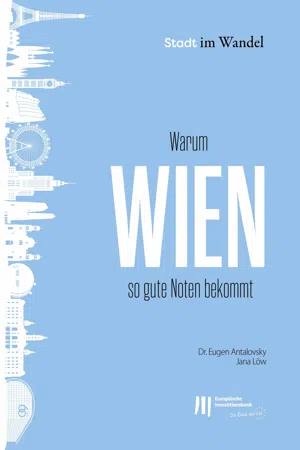
- 26 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Warum Wien so gute Noten bekommt
Über dieses Buch
Dieser Essay beleuchtet das politische Umfeld und die strategischen Zielsetzungen der Wiener Stadtentwicklungspolitik. Er zeigt, wie die Mittel der EIB zentrale Projekte ermöglicht und die Modernisierung Wiens gefördert haben. Wiens Stadtentwicklung lässt sich in vier Zyklen einteilen, geprägt durch besondere interne und externe Bedingungen und Chancen. In jedem Zyklus stand die EIB Wien auf unterschiedliche Weise zur Seite.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Warum Wien so gute Noten bekommt von Eugen Antalovsky,Jana Löw, Europäische Investitionsbank im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Volkswirtschaftslehre & Öffentliche Finanzen. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Zyklus 1: 1989 bis 1995 Wien am Scheideweg
Der Fall des Eisernen Vorhangs war nicht nur für Europa und das geopolitische System von grundlegender Bedeutung, sondern markierte für Wien auch den Beginn einer ganz neuen Ära von Entwicklungschancen. Im Jahr 1989 war Wien eine schrumpfende Metropole. Die Stadt bewahrte zwar erfolgreich ihr außergewöhnliches kulturelles und architektonisches Erbe, hatte jedoch mit einer rasch alternden Bevölkerung, wirtschaftlichen Stagnation und gewissen „Fortschrittsfeindlichkeit“ zu kämpfen. Wien sah sich selbst als gefährdeter Außenposten des Westens in unmittelbarer Nähe der vom „Ostblock“ ausgehenden Bedrohung. Nach 1989 hatte sich die Lage komplett geändert: Die österreichische Hauptstadt wurde für zahlreiche internationale Unternehmen das logische „Tor zum Osten“ und für Menschen aus den östlichen und südöstlichen Transformationsländern zum ersten Zugangspunkt.
Obwohl der Eiserne Vorhang in den Köpfen der Menschen fest verwurzelt war – und heute wissen wir, dass die Überwindung dieser mentalen Barrieren sehr lange dauerte –, setzte sein Zusammenbruch unerwartete Kräfte und Ideen frei. Bereits im Sommer 1989 hatte die Stadt Wien eine Studie zu den Auswirkungen der offenen Grenzen in Auftrag gegeben. Auch das Thema einer „wachsenden Stadt“ wurde darin erstmals behandelt. Ein zentraler Begriff in den politischen und planerischen Debatten der nächsten Jahrzehnte war von da an „Wachstum“. Dies markierte einen grundlegenden Paradigmenwechsel.
Der Stadtentwicklungsplan 1984 (STEP 1984) ging noch von einer weiter abnehmenden Bevölkerung und sehr schwachen Wirtschaftsleistung aus. Knapperen öffentlichen Mitteln stünde eine steigende Nachfrage nach staatlichen Leistungen gegenüber. Der Plan war auf eine schrumpfende Stadt, infrastrukturelle und ökologische Verbesserungen und eine „sanfte Stadterneuerung“ für mehr Lebensqualität ausgerichtet. Ebenfalls vorgesehen war ein öffentlich finanziertes Sanierungsprogramm zum Erhalt des historisch wertvollen Baubestands der Stadt.
Stadtentwicklungsplan 1994: Antwort auf grundlegenden Wandel
Bei sämtlichen späteren Strategiedokumenten, insbesondere den Leitlinien für die Stadtentwicklung 1991 und dem Stadtentwicklungsplan 1994 (STEP 1994), standen folgende Kernfragen im Mittelpunkt:
- Wie lässt sich das Bevölkerungswachstum bewältigen?
- Wie kann es genutzt werden, um Wien zu einer offenen und wirtschaftlich wettbewerbsfähigen Großstadt im Zentrum Europas zu machen?
- Wie lässt sich die Stadt nachhaltig und umweltfreundlich auf das 21. Jahrhundert vorbereiten?
Der STEP 1994 bezog erstmals mehrere wichtige Konzepte und Ideen in die Entwicklungspläne ein: das Konzept des internationalen Städtewettbewerbs, die Bedeutung der Wirtschaft für die Stadtentwicklung, die Vision eines „zweiten Stadtzentrums“ sowie die Zusammenarbeit in der Metropolregion und im grenzüberschreitenden Bereich. Der STEP 1994 sah auch neue Instrumente der partizipativen Stadtplanung vor, führte den Grundsatz einer umweltfreundlichen Mobilität sowie eine Parkraumbewirtschaftung ein, legte den Schwerpunkt weiter auf soziales Wohnen und Integration und analysierte den funktionalen Vorteil von Hochhäusern für Wien. Dieses verbindliche strategische Dokument eröffnete neue Dimensionen der Stadtplanung, machte räumliche und inhaltliche Brennpunkte aus und prägte die grundsätzliche Entwicklung Wiens in den kommenden Dekaden.
Flankierend wurden zwei Entscheidungen getroffen, die für die zukünftige Entwicklung bezahlbaren Wohnraums ausgesprochen relevant waren: Die Stadt führte 1995 sogenannte „Bauträgerwettbewerbe“ ein und schuf einen „Grundstücksbeirat“, der die Regeln für die Evaluierung aller subventionierten Projekte anhand der Kriterien Ökologie, Qualität und Ökonomie aufstellt. Für beides ist der Wohnfonds Wien zuständig, eine gemeinnützige Organisation der Stadt. Der vom amtsführenden Stadtrat für Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung vertretene Wohnfonds Wien ist ein zentraler Akteur in der sozialen Wohnungspolitik Wiens.
Zentrale Akteure bei der Umsetzung der sozialen Wohnungspolitik in Wien

Zusätzlich zu den Leitlinien der Stadtentwicklung von 1994 gab der Gemeinderat 1995 eine Erklärung zum Grün-gürtel ab, in der er sich für die Erhaltung und Ausweitung der Wiener Grünräume („1 000-Hektar-Plan“) aussprach. Diese Vorschrift garantiert zwar eine hohe Lebensqualität in Wien, fordert die Stadt in Zeiten von Expansion jedoch auch heraus.
Die durch den Mauerfall entstandenen Umwälzungen waren vielschichtig und eröffneten einige Jahre (1990 bis 1995) einzigartige Möglichkeiten. Wien nahm die Herausforderungen an: Die Stadt steckte Eckpunkte ab und traf Entscheidungen, die ihr Gesicht bis heute prägen. Drei entscheidende Faktoren haben Wien und seine urbane Entwicklung (bis in die Gegenwart) wesentlich beeinflusst:
- Zuwanderung nach Österreich und Wien
Der Zusammenbruch des Ostblocks und Jugoslawiens sowie die früheren Krisen in diesen Ländern waren der Hauptgrund für die Einwanderung nach Wien ab 1989. Die Zuwanderung aus Ungarn, der Slowakei und der Tschechischen Republik war zwar nicht so hoch wie damals erwartet. Dennoch war der Flüchtlingsstrom, hervorgerufen durch den Zusammenbruch Jugoslawiens (Kriege in Slowenien 1991, Kroatien und Bosnien 1992), erheblich. Die Nettozuwanderung nach Wien lag 1989 bei 19 000 Personen. 1991 stieg sie dann auf 31 000 Personen an und blieb in den Folgejahren hoch.1 Der Ausländeranteil der Wiener Bevölkerung nahm rasch von 12 Prozent auf 18 Prozent zu.2 Vor diesem Hintergrund bekam Österreichs rechtsgerichtete Freiheitspartei zunehmendes politisches Gewicht und initiierte 1993 – unter Ausnutzung der wachsenden Ambivalenz der Bevölkerung gegenüber Migranten – das Volksbegehren „Österreich zuerst“. - Österreichs EU-Beitritt
Ab den 1980er-Jahren wurde in Österreich ernsthaft über eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union diskutiert. Die Debatte war stark vom geopolitischen Umbruch, der Krise in Jugoslawien und dem Wunsch der Bevölkerung nach einem sicheren Hafen geprägt. Die Volksabstimmung im Juni 1994, die ein klares Votum für einen Beitritt ergab, eröffnete Politikern und Bürgern eine neue politische Perspektive und erweiterte in vielen Bereichen wie Wirtschaft, Bildung oder Reisen das Spektrum der Möglichkeiten. Anfang 1995 wurde Österreich dann offiziell Mitglied der Europäischen Union. Der EU-Beitritt half, die Herausforderungen zu bewältigen, die mit der ereignisreichen Zeit des Wandels in den frühen 1990er-Jahren einhergingen. - Das Aus für die EXPO 1995
Im Kalten Krieg hatten sich Österreich und Wien stets um gute Beziehungen zu den östlichen Nachbarn bemüht. Deshalb beschlossen Österreich und Ungarn 1987, sich gemeinsam um die Ausrichtung einer Weltausstellung in Wien und Budapest („Twin-City“-EXPO) im Jahr 1995 zu bewerben. Sie wollten zeigen, wie sich eine grenzüberschreitende Kooperation bei einem in...
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zyklus 1: 1989 bis 1995 Wien am Scheideweg
- Zyklus 2: 1996 bis 2005 Positionierung der Stadt in einem sich wandelnden Europa
- Zyklus 3: 2006 bis 2010 Großinvestitionen beflügeln Wiens Wettbewerbsfähigkeit
- Zyklus 4: 2011 bis heute Wachstum, Flüchtlingsunterbringung und intelligente Stadtentwicklung
- Anlage EIB-Darlehen in Wien und der Metropolregion
- Quellenangaben