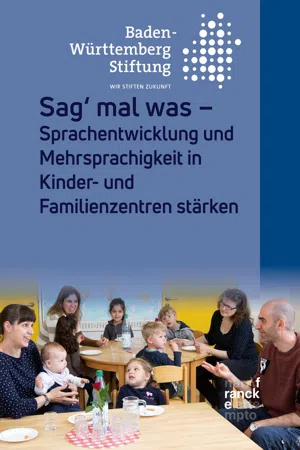Die Sprachentwicklung von Kindern zu stärken ist eine der zentralen Aufgaben von Kindertageseinrichtungen. In den Blick zu nehmen ist dabei nicht nur die Unterstützung des Erwerbs der deutschen Sprache, sondern auch der pädagogische Umgang mit den verschiedenen Familiensprachen in einer Einrichtung und die Förderung frühkindlicher Mehrsprachigkeit im Gesamtkontext der Sprachentwicklung. Dieser Aufgabe gerecht zu werden ist eine Herausforderung für die Einrichtungen und die dort tätigen Pädagoginnen und Pädagogen.
Ziel der vorliegenden Publikation ist es, ihnen Orientierung und Unterstützung zu bieten, Impulse zu setzen und generell zu einer Weiterentwicklung in diesem wichtigen Bereich beizutragen. Hierzu widmet sich die Publikation dem Thema „Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit“ sowohl aus wissenschaftlicher als auch aus praxisorientierter Perspektive. Aus dem Projekt Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit in Kinder- und Familienzentren stärken (SuMi-KiFaZ) der Baden-Württemberg Stiftung werden wissenschaftliche Erkenntnisse und konkrete Praxisbeispiele vorgestellt, und auch die beteiligten Kinder- und Familienzentren (KiFaZe) kommen dabei zu Wort. Außerdem werden wissenschaftliche Grundlagen dargelegt. Die Fragen, die im Mittelpunkt stehen, sind:
Mit dem Blick auf die Weiterentwicklung von Kindertageseinrichtungen (Kitas) zu Kinder- und Familienzentren (KiFaZe) wird eine weitere Perspektive integriert, die aktuell von hoher Bedeutung ist und viele Potenziale bietet. Als wohnbereichsnahe niederschwellige Kontakt- und Kommunikationsstätten können KiFaZe spezifisch angepasste Bildungs- und Beratungsgelegenheiten bieten und damit nicht nur einen entscheidenden Beitrag im Bereich Sprachentwicklung leisten, sondern auch allgemein der Marginalisierung von Familien mit Migrationsgeschichte entgegenwirken (Geisen, 2019, S. 83) und die Familie sowie den erweiterten Sozialraum als Bildungsorte stärken.
Dieses Kapitel bietet Einblicke in die Themen Sprache, Mehrsprachigkeit und alltagsintegrierte Sprachförderung (Kap. 1.1.1), Zusammenarbeit mit Familien (Kap. 1.1.2) sowie Kinder- und Familienzentren (Kap. 1.1.3) und liefert damit den fachlichen Kontext. Des Weiteren beinhaltet es Informationen zum Programm Sag’ mal was der Baden-Württemberg Stiftung (Kap. 1.1.4) und zu dem in diesem Programm verorteten Projekt Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit in Kinder- und Familienzentren stärken (SuMi-KiFaz) (Kap. 1.1.5), auf dem die vorliegende Publikation basiert. Abschließend werden der Aufbau und die einzelnen Kapitel der Publikation vorgestellt (Kap. 1.1.6).
1.1.1 Sprache, Mehrsprachigkeit und alltagsintegrierte Sprachförderung
Sprache gilt als die zentrale Schlüsselkompetenz und Voraussetzung eines Menschen für gelingenden Wissenserwerb, Bildungserfolg und -gerechtigkeit sowie für die Möglichkeit zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben (Clegg, Hollis, Mawhood & Rutter, 2005; Deutsches PISA-Konsortium, 2011; Hasselhorn & Sallat, 2004). Schon für Kinder in der Kita ist Sprache ein wichtiges Medium, mit dessen Hilfe sie bspw. Bedürfnisse und Wünsche kommunizieren und Beziehungen mit Kindern und Erwachsenen gestalten. Sprachkompetenzen sind daher bereits für die Teilhabe von Kindern an Interaktionen in der Kita von Bedeutung (Albers et al., 2017). Auch für die spätere Schullaufbahn scheinen sprachliche Kompetenzen relevant zu sein. So ergaben Studien z. B. einen Zusammenhang von (in unserem Fall deutschen) Sprachkompetenzen mehrsprachig aufwachsender Kinder zum Zeitpunkt der Einschulung mit Lernzuwächsen in Sachfächern und dem Übergang zwischen Primar- und Sekundarstufe (Übersicht bei Kempert et al., 2016). Von Bedeutung sind auch frühe Erfahrungen mit mündlich vermittelter, aber „schriftförmiger“ („konzeptionell schriftlicher“) Sprache, wie sie Kita-Kinder z. B. beim Erzählen sammeln können, sowie erste Erfahrungen mit Büchern und mit Schrift. Derartige Erfahrungen werden auch als „Literacy“ bezeichnet.
In verschiedenen Untersuchungen zeigten sich zwischen ein- und mehrsprachig aufwachsenden Kindern bei Schulbeginn große Unterschiede in den deutschen Sprachkompetenzen (vgl. z. B. Simon & Sachse, 2011). Bei differenzierterer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass die Unterschiede in vielen Fällen weniger mit der Mehrsprachigkeit als mit der sozialen Herkunft der Kinder zusammenhängen (zusammenfassend bei Kempert et al., 2016). Hierzu zählen z. B. der sozioökonomische Status der Herkunftsfamilie, der Bildungsstand der Eltern sowie ihre Kenntnis über das Bildungssystem und/oder zeitlich (zu) spät einsetzender Erwerb der deutschen Bildungssprache (Gogolin, 2012).
Eine aktuelle Studie (Hippmann et al., 2019) konnte darüber hinaus zeigen, dass zwischen der Mehrsprachigkeit eines Kindes und seinen Leseleistungen in den ersten beiden Schulklassen kein signifikanter Zusammenhang besteht. Mehrsprachig aufzuwachsen ist daher per se kein „Risikofaktor“.
Von Bedeutung ist auch die Art und Weise, wie die Sprachkompetenz erhoben wird: Studien zu den deutschen Sprachkompetenzen mehrsprachig aufwachsender Kinder beruhen in der Regel auf der Testung mit Verfahren, die an deutsch-einsprachigen Kindern normiert wurden. Verfahren wie der Test „LiSe-DaZ®“ (Linguistische Sprachstandserhebung – Deutsch als Zweitsprache, Schulz & Tracy, 2011) hingegen bieten je nach Kontaktzeit mit der deutschen Sprache unterschiedliche Normen an und geben ein differenziertes Bild über die Sprachfähigkeiten eines Kindes. Des Weiteren sollten bei der Erhebung des Sprachstandes auch die Kompetenzen in den weiteren Sprachen des Kindes berücksichtigt werden (Ronninger et al., 2019).
Vor diesem Hintergrund erscheinen eine bessere Anschlussfähigkeit der vielfach immer noch stark mittelschichtsorientiert und einsprachig ausgerichteten Bildungseinrichtungen Kita und Schule an familiäre Bedingungen sowie die Berücksichtigung familiärer Sprach(en)- und Literalitätserfahrungen in der Kita unabdingbar (vgl. Montanari & Panagiotopoulou, 2019).
Sprachliche Bildung und Förderung sowie die Unterstützung der Literacy-Entwicklung ein- oder mehrsprachig aufwachsender Kinder gehören daher zu den zentralen Aufgaben von Einrichtungen der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung (Baden-Württemberg Stiftung, 2014). Die Verankerung des Bildungsbereichs Sprache im Orientierungsplan für Bildung und Erziehung in Kindergärten und Kindertageseinrichtungen des Landes Baden-Württemberg verdeutlicht deren Relevanz und Stellenwert (Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, 2011). Bei der sprachlichen Bildung und Förderung haben sich alltagsintegrierte Ansätze als besonders effektiv erwiesen (Hofmann, Polotzek, Roos & Schöler, 2008; Lisker, 2011; siehe hierzu auch unten und den Beitrag von Jens Kratzmann in Kap. 2.1 des vorliegenden Bands).
In frühpädagogischen Einrichtungen muss jedoch nicht nur der Erwerb der Grundlagen der deutschen Sprache in den Blick genommen werden, sondern auch die Wertschätzung und Förderung von Mehrsprachigkeit.
Mehrsprachigkeit stärken
Im Jahr 2018 hatte in Deutschland jede vierte Person einen Migrationshintergrund (Statistisches Bundesamt, 2019). Viele Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund wachsen mehrsprachig auf, d.h. sie geraten „in ihren ersten Lebensjahren in Interaktionssituationen (…), in denen mehrere Sprachen in kommunikativ relevanter Weise Verwendung finden“ (Reich, 2010, S. 8). Diese Kinder sind in der Familie mit einer oder mehreren Familiensprachen konfrontiert, zu denen die Herkunftssprache(n) der Eltern und in vielen Fällen auch die deutsche Sprache gehören. Der pädagogische Umgang mit unterschiedlichen Familiensprachen und Mehrsprachigkeit zählt daher zu den Anforderungen des pädagogischen Alltags fast aller Kindertageseinrichtungen.
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Sichtweise auf Mehrsprachigkeit stark gewandelt, und es werden zunehmend Ansätze einer mehrsprachigen Bildung in Kindertageseinrichtungen diskutiert (Jahreiß, 2018). Forciert werden ein aktiver, integrativer Umgang mit der Sprachenvielfalt und die Wertschätzung und Förderung von Mehrsprachigkeit (Chilla & Niebuhr-Siebert, 2017). Es gibt Hinweise darauf, dass eine erfolgreiche mehrsprachige Entwicklung positive Effekte für den schulischen Erfolg von Kindern hat. Unabhängig davon wird Mehrsprachigkeit aber auch ein „Wert an sich“ zugeschrieben, der keiner weiteren Rechtfertigung bedarf (Kempert et al., 2016, S. 193). Ziel ist es daher – in Abkehr von einer ausschließlichen Förderung der deutschen Sprache – zu einer Weiterentwicklung der Gesamtsprachkompetenz der Kinder beizutragen. Diese beinhaltet auch „translinguale“ Praktiken, die alle dem Kind zur Verfügung stehenden Sprachen (und Dialekte) einbeziehen (García, 2009; Montanari & Panagiotopoulou, 2019).
Ein wichtiger Faktor für die Unterstützung der mehrsprachigen Entwicklung sind mehrsprachige Pädagoginnen und Pädagogen, die Kindern und Erwachsenen als Vorbild für eine „lebendige Mehrsprachigkeit“ dienen können (Cicero Catanese, 2020, S. 46; zum Thema Mehrsprachigkeit siehe auch den Beitrag von Jens Kratzmann in Kap. 2.1 des vorliegenden Bands).
Alltagsintegrierte Sprachförderung
Unter Sprachförderung werden in der vorliegenden Publikation bewusste pädagogische Maßnahmen verstanden, die Kindern in ihren verschiedenen Lebenskontexten differenzierte Spracherfahrungen ermöglichen und sie gezielt hinsichtlich ihrer Sprachentwicklung anregen und begleiten. Wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema Sprachförderung sind heute sehr weitgreifend. Wie die bisherige Forschung zeigt, scheint die reine angebotsorientierte Verwendung unterschiedlicher Arbeitsmaterialien zur Förderung der Sprachkompetenz weniger effektiv zu sein als andere Ansätze.
Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis sind Ansätze und Fördermaßnahmen in den Fokus gerückt, die einen gelingenden Spracherwerb durch die Wechselwirkung intrapersoneller Faktoren und Aspekte der Umwelt beschreiben und dem Prinzip der Alltagsintegration folgen (vgl. Lisker, 2011; Kratzmann, in diesem Band). Die Beeinflussung des Spracherwerbs durch die Umwelt und die Umgebung eines Kindes wird dabei vor allem in interaktionistischen Ansätzen berücksichtigt (Bruner, Watson & Aeschbacher, 1987). Sprachförderung wie sie im Kontext der elementarpädagogischen Bildung in Kitas/KiFaZen stattfindet, bezieht sich dabei auf eine universelle (primäre) Förderung, die eben jene Aspekte aufgreift (Ziegenhain, 2008). Diese universelle Sprachförderung richtet sich sowohl an die Kinder als auch an die Familien und verfolgt ein alltagsintegrierendes Handeln, d.h. Sprachförderung wird durch gezielte Strategien und Maßnahmen in Alltagssituationen betrieben. Dies hat sich im Förderkontext als effektiv erwiesen (Beckerle, 2017; Buschmann & Jooss, 2009; Simon & Sachse, 2011). Besonders mehrsprachig aufwachsende Kinder mit auffälligen Sprachmerkmalen konnten bspw. signifikant von einer alltagsintegrierten Förderung profitieren (Beckerle, 2017; Simon & Sachse, 2011; Jungmann, Koch & Etzien, 2008). Über alltagsintegrierte Ansätze lässt sich auch Mehrsprachigkeit fördern (Chilla & Niebuhr-Siebert, 2017).