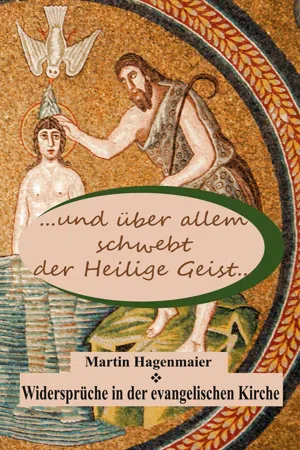![]()
Kapitel VII
Praxis und Theorie in der Seelsorge
Ratlosigkeit
Wer aktiv und praktisch täglich Seelsorge betreibt, kommt nicht umhin, sich mit den eigenen Quellen und Vorstellungen immer wieder auseinanderzusetzen. Dabei meine ich nicht die wissenschaftliche Auseinandersetzung im Sinne der Aufarbeitung von Texten, sondern das Messen von gängigen Leitvorstellungen an realen Begegnungen. Bei Gesprächen unter Seelsorgerinnen und Seelsorgern, aber auch bei Bewerbungssituationen kommen immer wieder die gleichen Gedanken zum Vorschein. Es handelt sich um eine Mischung der verschiedensten Ansätze aus dem fast unüberschaubaren Bereich der "Psychoszene", von der nicht beeinflusst zu sein, nicht möglich scheint. Die Auseinandersetzung damit kann aus meiner Sicht zunächst nur pauschal erfolgen, um dadurch die notwendige Distanz zu schaffen. Erst danach ist es sinnvoll, ins Detail zu gehen und auch zwischen den Richtungen zu differenzieren.
Seelsorge wurde in den fünfziger und sechziger Jahren sozusagen neu entdeckt und vorwiegend als Interaktion zwischen Menschen beschrieben, von denen der eine sich dem anderen zuwendet und ihn versteht. Dadurch kommt ein Prozess in Gang, in dem der andere sich bewusster sehen lernt, weniger verdrängt, seine Gefühlsebene wahrnimmt und am Ende bei geglücktem Ablauf seine Geschicke besser und selbständiger lenken kann.
Nicht nur in der psychotherapeutischen Behandlung wurden also die psychotherapeutischen Verfahren angewandt. Nach ihrem Vorbild und den Variationen in der Vorgehensweise, je nach therapeutischer Schule wechselt auch die Definition der Art des Zuhörens und der Dauer dieser Veranstaltung, wurden Beratungsstellen organisiert, Krankenhaus- und Telefonseelsorge gestaltet und so manches Gespräch mit Trauernden, Heiratswilligen und Taufeltern geführt. Mancher Seelsorger oder manche Seelsorgerin hat auch den eigenen Partner oder die eigene Partnerin auf ganz seelsorgerliche Weise vertrieben. Wer sich solcher Haltung oder Methodik bedienen wollte, musste selbstverständlich eine Ausbildung haben, die er bei anderen, die zu Beginn dieser Phase schnell auf den Zug gesprungen waren, absolvieren konnte. Seelsorger/in wurde niemand mehr automatisch mit den pastoralen oder anderen kirchlichen Weihen. Seelsorge wurde ja noch nicht in den offiziellen Ausbildungsstätten gelehrt. Nur lange berufsbegleitende Mühen konnten den Einstieg in die Kaste der Seelsorger/innen sichern. Das unsägliche Wort "Supervisor" stand fortan für die Tätigkeit, die man vorher schlicht mit Ausbilder bezeichnet hatte.123 Wahrscheinlich aber ist es ein bezeichnendes Wort.
Der Supervisor war tatsächlich der Aufseher. Er konnte die Menschen in ihrer Ausbildung manipulieren, wie er wollte, weil ja nur er in den Zweck der Übung eingeführt war, den die Auszubildenden in endlosen Selbsterfahrungsaktionen erst mühsam finden sollten. Das Suchen des Zieles wurde dann als der eigentliche Ausbildungszweck ausgegeben. Eine "Wahrheit" konnte es per definitionem nicht geben. Jeder fand allenfalls die Stelle, an der er nicht "echt" war und dadurch Kommunikation mit dem anderen störte.
Ergebnis der pastoralpsychologischen Ausbildungen waren entweder die Fähigkeit, mit bestimmten therapeutischen Modellen wenigstens einigermaßen kompetent umzugehen, oder eine niemals nachgewiesene, aber stets postulierte Änderung im persönlichen Verhalten: offener, freier, echt, mit weniger Projektion und mehr, ohne verkrümmende Eigeninteressen behindertes, Einfühlungsvermögen - so sollte der seelsorgerliche Kontakt nun zum besten des "Klienten" von statten gehen. Der Klient wurde (nur) begleitet auf dem Weg, den er selbst geht. In der Begleitung sollte schon das Heil liegen. Nur ja keine Bevormundung, "direktive" Verhaltensweise oder Identifikation mit dem anderen! Die eigenen Impulse und Übertragungen kontrollieren, bevor sie Schaden anrichten und die Kommunikation blockieren können! So lautete die Zielsetzung nicht nur im Bereich der klinischen Seelsorgeausbildung, die eine Mischung verschiedenster Methoden und Zielsetzungen darstellt. Echtheit als Leit - Begriff, wohl ursprünglich aus der Rogers-Schule übernommen, war Grundlage des Seelsorgerverhaltens in der Gesprächsseelsorge. Die tiefenpsychologischen Richtungen unterscheiden sich in der Zielsetzung nicht wesentlich von tiefenpsychologischen Psychotherapien, auch wenn die Seelsorger nicht die große Analyse anbieten, sondern ein tiefenpsychologisch orientiertes Gespräch. Ein Ergebnis der verschiedenen Ansätze zeigte sich in der Praxis bald als Rollendiffusion.
Bei einer Konventstagung: Thema "Stand der pastoralpsychologischen Richtungen" - kamen in kurzer Zeit folgende Stichworte für die Identität von Seelsorgern/innen vor:
Mahner, Beobachter, Therapeut, Liturg, Prediger, Würdenträger, Repräsentant der Institution Kirche, Gastarbeiter, Lückenbüßer, Totenvogel, Situationsanalytiker, Zuhörer, Berater, Theologe, Pastor,
Seelsorger, Menschensorger, Priester (Funktion), Vertreter der Menschlichkeit in der Institution Krankenhaus.
Wenn seelsorgerliche Identität so vielfältig beschrieben werden kann, muss eine starke Diffusion vermutet werden, die sich in Konfusion bei den Gesprächspartnern nieder schlagen könnte. Bei so vielen verschiedenen Paradigmen geht es nicht mehr um die persönliche Einfärbung einer beschreibbaren gemeinsamen Identität. Sollte vielleicht der Stand der Dinge erreicht sein, den Scharfenberg im Gefolge .-W. Dixons so beschrieben hat, "...dass einer Kultur, die ihre Mythologie verloren hat, auch ihre Methodologie verlorengeht (?) Übrig bleibt Verzweiflung, denn ohne Mythos und ohne Methode gibt es keinen Weg mehr, um den eigenen Platz in der Welt zu finden."124
Die Rollenkonfusion in der Seelsorge lässt kaum noch einen gemeinsamen "Mythos" ahnen, in dem diese Rollen zu einer Identität aufgehoben werden. Die wissenschaftliche Form dieser Seelsorge liest sich natürlich weniger aggressiv als die Erlernung in Kursen z.B. der „Klinischen Seelsorgeausbildung“ (KSA) oder der wissenschaftlichen Gesprächsführung verläuft. So hat Scharfenberg in einem mehrfach aufgelegten Buch von 1972 die "Seelsorge als Gespräch" sehr einleuchtend und mit dem damaligen Hintergrund an Theologie/Philosophie so formuliert: "...,dass das seelsorgerliche Element zunächst einmal in der Verleiblichung der Annahme des Menschen, der zu ihm (sc. dem Seelsorger) kommt, besteht. Damit wird auch wieder eine Versagung zugemutet, indem wir die Über-Ich-Rolle ablehnen, aber in Aussicht stellen können, dass wir unsere Hilfe dafür anbieten, den Raum der Freiheit zu bewältigen."125 Seelsorgerliche Betreuung muss Beschränkung darauf sein, "einen Menschen in sehr großen Schwierigkeiten ein Stück menschlicher Wegbegleitung anzubieten"126.
Und schließlich die für die Betreuung depressiver Menschen auch heute sicher noch gültige Maßregel: "...die Tatsache, dass ein anderer Mensch da ist, der keine Versuche macht, ihm aus der Depression herauszuhelfen, sondern in ihr durch sein Dasein zur Sinnfindung des eigenen Problems beiträgt, wird gewiß als hilfreich empfunden werden."127
Inzwischen wurde Seelsorge gerade auch von Scharfenberg entscheidend weiterentwickelt, vor allem unter den Stichworten „Symbol“128, „Geschichte“129, „Triangulierung“130 und unter der Verschränkung des Schicksals des Einzelnen mit dem der Strukturen um ihn131. Dennoch zeigt das ältere Beispiel eher idealtypisch den Ansatz des damaligen Selbstverständnisses vom „Raum der Freiheit“, in dem Wegbegleitung stattfinden kann. Wer aber die Grundlagen dieser Seelsorge nicht nur nachvollziehen kann, sondern sie auch gelernt hat, stößt häufig auf die „Grenzen des Helfens“132.
Mir z.B. geht es so, wenn ich den auf diese Weise - auch von mir selbst - seelsorgerlich begleiteten Menschen einige Zeit später wieder einmal, dann aber vielleicht ratlos, gegenüberstehe. Diese Grenzerfahrungen müssen auch mit einer neuen Gesamtsicht, wenn nicht gar mit einem neuen Lebensgefühl zusammenhängen. Anders wäre die Massivität der veränderten Eindrücke nicht zu erklären, die sich in Seelsorgebegegnungen zeigen. Weil sich dies nicht anders machen lässt, will ich mit vielen Beispielen auch eine Art eigene Ratlosigkeit zu formulieren versuchen. Die Beispiele stammen aus der Psychiatrie und dem sozialen Randbereich. Meines Erachtens zeigen sie aber gerade deshalb Typisches wie eine Lupe, zumal die Menschen, die mir begegnen, alle in irgendeiner Form auch nichtpsychiatrischen Betreuern begegnet sind. Alle geschilderten Begegnungen haben sich innerhalb eines kurzen Zeitraumes ergeben.
Austherapiert
Da ist Frau P. (Die Darstellung des Kontaktes mit ihr wirkt wahrscheinlich ziemlich banal und pauschal.) Sie muss unbedingt den Pastor sprechen, lässt sie eine Krankenschwester ausrichten. Sie selbst hat es gar nicht gewollt, sondern sie tut es, weil jemand anders es ihr geraten hat. Kleine Schritte in die Realität zurück solle ich mit ihr vorbereiten, so ist ihre erste „Anforderung“ an mich. Sie stellt sich als „Therapieleiche“ vor.
Einige Jahre einer wirklich fundierten Psychotherapie hat sie hinter sich. Und dann kam das, was ja eigentlich gar nicht hätte passieren dürfen - und weshalb sie denn auch aus der Therapie gefeuert wird: Sie stellt den Sinn der Therapie in Frage und das nach so vielen Sitzungen. Für sie ist das der Beweis, dass nun gar nichts mehr hilft und alle gegen sie sind. Jetzt hat sie auch noch einen gescheiterten Suizidversuch hinter sich. Wie soll sie das bloß all den Menschen erzählen, die sie kennt? Sie ist ja so einsam und allein, sagt sie bei mehreren Gelegenheiten. Ihre Freundin hat das gesagt, das befreundete Ehepaar etwas anderes, ihre Schwester, ihre Tochter, ihre Kollegen, ihre Seelsorgerin, eine andere Freundin.
Sicher, die reden mit ihr, aber sie wissen ja auch nichts. Sie sagen: da hilft nur noch der Therapeut. Der aber hilft nicht mehr, weil er narzisstisch gekränkt ist mitsamt der ganzen Gruppe, dass diese Narzisstin seine Therapie und den Erfolg aller anderen Mitglieder in Frage stellt, das jedenfalls signalisiert Frau P. Dabei ist das doch der klassische Fall für die Psychoanalyse: neurotische Störung aufgrund der frühkindlichen Lebensumstände mit narzisstischer Grundeinfärbung.
Nach mehreren Gesprächen scheint es so, dass Frau P. mit ihrem Leben nicht zurechtkommt, weil sie eine berufliche Position übernommen hat, die über ihre persönlichen Kräfte geht und weil sie zusätzlich als allein erziehende Mutter einer jugendlichen Tochter doch eigentlich lieber Tochter als Mutter wäre. Mit einer nicht direktiven Methode wäre wahrscheinlich schnell der äußerste Erschöpfungsgrad des/der Therapeuten erreicht. Darin sind sich in diesem Fall alle von Frau P. zum Gespräch aufgesuchten Menschen einig. „Normale Menschen“, z.B. Vorgesetzte, trauen sich kein Wort mehr zu, in der einer Frau P. durch klare Leitlinien ein Feld geboten würde, in dem sie arbeiten kann. Sie „wissen“, dass da nur der Psychotherapeut helfen kann. (Das ist belegt aus Kontakten mit Vorgesetzten u.a.). Psychiater retten sich auf eine bescheidene Dosis irgendeines aufhellenden Präparates.
Seelsorger bieten ihre „Selbsthilfegruppe“ an. Im Grunde handelt es sich bei den Hinweisen auf Therapeuten aus der „Nichttherapeuten – Szene“ wahrscheinlich um die Verschleierung der Ablehnung einer intensiveren persönlichen Beziehung oder einer eindeutigen sachlichen Leitung. Nun gibt es innerhalb der seelsorgerlichen Methodik sicherlich auch einen Weg, mit Frau P. umzugehen. Z.B. könnte der angesprochene Pastor sagen, wenn sie selbst das Gespräch suche, sei er gerne bereit. Wenn sie dagegen nur auf Geheiß von anderen komme, sei das doch kein Grund, längere Zeit miteinander zu reden.
Es muss geklärt werden, warum der Gesprächspartner Pastor sein soll, warum nicht der Arzt oder jemand anders aus dem therapeutischen Bereich. Falls es dann zu Gesprächen kommt, müssen diese genau begrenzt werden, die Motivation erhoben, Erwartungen und Ziele formuliert werden.
Das Therapiemodell also schien bis dato bei Frau P. gescheitert. Das Begleitungsmodell hatte schon stattgefunden. Wer wollte auch jemand begleiten, der gar nicht „geht“, sondern sich im intrapersonalen Kreisverkehr befindet? Bleibt das „Dasein“, wie es häufiger als seelsorgerliche Haltung beschrieben wurde. Das „Dasein“ aber ist doch eine merkwürdige Art der Illusion! Da ist Gott, der überall sein kann, aber doch kein Seelsorger. Der ist allenfalls sehr begrenzt da und dann besonders nicht, wenn er weg ist. Das aber ist er im Normalfall hundertfünfundsiebzig von hundertsechsundsiebzig Wochenstunden. Sollte das „Dasein“ eine Art Verschmelzungswunsch auf seelsorgerlicher Seite sein?133 Menschen fragen aber nach etwas, was sie leiten kann, was bei ihnen bleibt und was ihnen zur Stärkung dient. Sie suchen Übergangsobjekte, den Teddy, den sie mit herumschleppen können. In dieser Situation kommen nurmehr schwach die Erinnerungen an all die biblischen Grundgedanken, die von Hilfe und Halt, von Rettung und Befreiung berichten, die von Gott ausgehen soll. Nach vielen veröffentlichten Vorstellungen von Seelsorgerinnen und Seelsorgern wendet sich Gott dem Menschen im Seelsorger zu, so dass der „Klient“ in der Zuwendung des Seelsorgers die Liebe Gottes spürt.
Da muss Gott schon eine merkwürdig gebrochene Zuwendung zu den Menschen haben, die die großen Worte von der Gnade und Barmherzigkeit nicht gerade glaubhaft macht! Sollte der liebe Gott wie die „nette Frau Pastorin“ oder der „nette Herr Pastor“ sein? Wenn das das inhaltliche Angebot der Seelsorge bleibt, braucht der so beseelsorgte Mensch ein gerüttelt Maß an Abstraktionsfähigkeit, um daraus innere Stärkung zu ziehen.
Suche nach dem "Korsett"
Noch deutlicher gab mir ein Mann zu verstehen, was das Problem mit der neueren Seelsorge ist. Jahrelang hatte er...