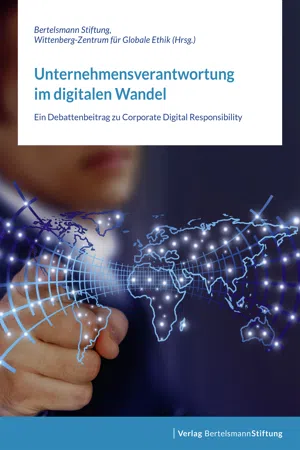![]()
CDR und betriebliche Transformation/Arbeitswelt
Ein neues Thema in eine Organisation einzubringen, erfordert Fingerspitzengefühl und einen Anlass. Alexander Brink, Frank Esselmann und Dominik Golle bieten sieben valide Zugänge an, mit denen Corporate Digital Responsibility den Weg in eine Organisation finden kann.
Hendrik Reese, Kentaro Ellert, Konstantinos Stavrakis und Antonio Bikić plädieren für die kontextsensible Anpassung bestehender Strukturen zur Gestaltung von KI-Anwendungen in ihrem Beitrag »Unternehmensverantwortung im Kontext Künstlicher Intelligenz«.
Betriebliche Mitbestimmung ist tief in der Unternehmenskultur in Deutschland verankert. Eva-Maria Spindler und Christoph Schank fragen nach den Herausforderungen, die Digitalisierung und digitale Transformation an die Arbeit und die Aufgaben von Betriebsräten stellt: »Betriebliche Mitbestimmung zwischen Digitalisierung und digtialer Transformation«.
Christian Schilcher und Carla Hustedt zeigen in ihrem Beitrag »›Würde ich gern so machen, doch der Computer sagt Nein.‹ Die Gestaltung von Mensch-Computer-Interaktion als ethische Herausforderung in Unternehmen«, warum Partizipation die Chancen eines erfolgreichen und verantwortlichen Zusammenspiels von Menschen und Maschinen in einer digitalisierten Arbeitsumgebung erhöht.
Menschen müssen an der Gestaltung der Prozesse, die sie später mit Leben befüllen (sollen), beteiligt werden. Dies gilt umso mehr bei digitalen Prozessen, die zur Nachhaltigkeit beitragen sollen, so die Meinung von Mathias Wrede, nachzulesen unter »Beteiligung schafft Nachhaltigkeit bei der Gestaltung von (digitalen) Prozessen«.
»Lean« und »agile« sollen die Prozesse der modernen Arbeitswelt sein. Anna Walter geht in ihrem Beitrag »Was haben ›Lean‹ und ›Agile‹ mit digitaler Ethik zu tun?« drei Irrtümern nach, die mit diesen Begriffen verbunden sind.
Digitalisierung führt dazu, dass sich Bereiche wie Beruf und Familie stärker als bisher gegenseitig durchdringen und überlagern. Praxisnah betrachten die Beiträge von Sigrun Fuchs, »Vertrauen ist keine betriebswirtschaftliche Kategorie – Verantwortung auch nicht«, sowie von Ramona Kiefer und Martina Koch, »Vereinbarkeit 4.0: Wie kann Digitalisierung bei Vereinbarkeitsfragen nutzen? Ein Erfahrungsbericht«, Chancen und Herausforderungen der Vereinbarkeit in der digitalen Transformation.
»Next Generation Corporate Digital Responsibility – ein Kommentar aus der Perspektive der jungen Generation« polarisiert. Leander Schneider, Paulina Albert, Jakob Ortmann und Vitus Rennert heben die Veränderungen in der Arbeitswelt durch neue Kommunikationstools und daraus entstehende Erwartungen einer neuen Generation von Arbeitskräften hervor. Siehe dazu auch den Beitrag von Christian Schilcher und Carla Hustedt.
Wie überstehen Organisationen Transformationsprozesse? Kommunikation ist ein Generalschlüssel, um gestärkt durch den digitalen Wandel zu gehen. Argumentative Untermauerung bietet Klaus Motoki Tonn mit »Narrative einer CDR-Kommunikation im Lichte von Veränderungsprozessen, Mindsets und Organisationskultur«. Siehe dazu auch den Beitrag von Oliver Kustner (Seite 331).
Judith Klaiber stellt in »Werte:bildende Führung im digitalen Arbeitskontext« grundlegende Überlegungen zu Werten und deren Bildung an. Dabei beantwortet sie die Frage, wie diese Werte:Bildung in Zeiten der digitalen Transformationsprozesse eine zeitgemäße Führungskultur stützen kann.
![]()
Sieben Zugänge zur Corporate Digital Responsibility
Alexander Brink, Frank Esselmann, Dominik Golle
CDR – die neue Unternehmensverantwortung
Das Zusammenspiel von Ethik und Digitalisierung wird in jüngsten Veröffentlichungen zu unterschiedlichsten Branchen rezipiert (Böhm 2019; Manzeschke und Brink 2020a–d). Auch liegen erste konkrete Ergebnisse zu der Frage vor, wie aus einer Corporate Digital Responsibility (CDR), also unter anderem einer stärkeren Verbraucherorientierung von Unternehmen in digitalen Fragen, ein Wettbewerbsvorteil für Deutschland und Europa entstehen kann (Brink und Esselmann 2019; Esselmann, Golle und Brink 2019, 2020). Als die US-Managementberatung Accenture im Jahr 2015 erstmals den Begriff »Corporate Digital Responsibility« einführte, ging es um die grundlegende Frage der Verantwortung von Unternehmen in der digitalen Ökonomie (Cooper, Siu und Wei 2015: 2). Accenture definierte seinerzeit fünf Anwendungsbereiche: verantwortungsvoller Umgang mit Daten durch Datenschutz und Datensicherheit (digital stewardship), Transparenz der Nutzung von Kundendaten (digital transparency), Unterstützung von Kunden durch Nudging (digital empowerment), faire Verteilung der Gewinne aus der Nutzung von Kundendaten (digital equity) und die Bereitstellung von Datensätzen für Forschungszwecke (digital inclusion).
Als wir den Begriff ein Jahr später erstmals in der deutschen Debatte in einem Magazin der Universität Bayreuth veröffentlichten, plädierten wir primär für eine Shared-Value-Strategie, die sowohl wirtschaftliche Interessen als auch gesellschaftliche Bedürfnisse vereint (Esselmann und Brink 2016). Das rechtzeitige Erkennen von Stakeholderansprüchen kann – so die Idee – bei verantwortlicher Berücksichtigung zu strategischen Wettbewerbsvorteilen führen. Diese liegen in einer grundlegenden Stabilisierung des Vertrauens, aus der heraus sich dann weitere positive Aspekte wie Mitarbeitergewinnung und -bindung, innovative Produkt- und Dienstleistungsentwicklung bis hin zu wertvollen gesellschaftlichen Beiträgen ableiten lassen. Damit übertrugen wir eine Idee, die der US-Wettbewerbsökonom Michael Porter eingeführt hatte, in die Zeiten der Digitalisierung (Porter und Kramer 2002, 2011). So sind Unternehmen in digitalen Bereichen nur dann erfolgreich, wenn sie einen Ausgleich zwischen informationeller Selbstbestimmung und datengetriebener Wertschöpfung sowohl für Kunden als auch für das Unternehmen selbst erreichen. Zusammenfassend prägt der Begriff CDR in seinem grundlegendsten Verständnis die verantwortliche Gestaltung der Digitalisierung im Kerngeschäft des Unternehmens. Wir haben für den deutschen Diskurs ebenfalls schon frühzeitig auf dieses Marktverständnis hingewiesen und sprechen in diesem Sinne von einem »vollständigen Verständnis der Wertschöpfungskette« (Esselmann und Brink 2016: 35) in einem »fairen Markt« (Esselmann, Golle und Brink 2020).
Für die deutsche und europäische Wirtschaft stellt CDR damit eine einzigartige Chance dar. So kann auf dem an die USA und China verloren geglaubten digitalen Endkundenmarkt eine wertebasierte Konkurrenz etabliert werden. Dieser Wettbewerbsvorteil ist nachhaltig, da er kaum nachahmbar ist, denn er beruht auf europäischen Werten, die über einen langen Zeitraum historisch gewachsen und entsprechend einzigartig sind. Das stellt insbesondere für die traditionell wertorientierte deutsche Wirtschaft mit ihrer sozialen Marktwirtschaft ein enormes Potenzial dar.
CDR ist ein Begriff im Werden, eine Wortneuschöpfung, deren Inhalt und Bedeutung verschiedenartig aufgeladen und interpretiert werden kann. In diesem Beitrag unterscheiden wir sieben Zugänge zur Corporate Digital Responsibility, deren bewusste Auswahl und Kombination bei der Annäherung an das Thema nach unseren Marktanalysen einen großen Mehrwert liefern (ebd.).
Die sieben Zugänge zur Corporate Digital Responsibility
1. Zugang über Disziplinen
Ein erster Zugang bezieht sich auf unterschiedliche wissenschaftliche Disziplinen. So ist etwa die Ökonomik die Wissenschaft der Wirtschaft, die Ethik die Wissenschaft der Moral. Im gegenwärtigen Digitalisierungsdiskurs werden insbesondere vier disziplinäre Zugänge diskutiert. Erstens werden technische Disziplinen herangezogen bei der Frage, wie weit zum Beispiel die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz oder die der Automation ist. Zweitens sind ökonomische Disziplinen relevant – hier vorrangig an der Frage orientiert, ob und wie man mit Digitalisierung Geld verdienen kann bzw. welche Zahlungsbereitschaft der Kunde bzw. die Kundin für digitale Produkte und Dienstleistungen hat. Drittens sind es juristische Disziplinen, die nach dem rechtlich Erlaubten fragen (hier wäre jüngst die DSGVO zu nennen). Viertens finden sich philosophische Disziplinen, aktuell vorrangig vertreten durch die Ethik, die der Frage auf den Grund geht, was man tun soll und was nicht.
In der Praxis werden derzeit unterschiedliche disziplinäre Wirkungen auf die Sustainable Development Goals aufgezeigt, die nach ökonomischen, ökologischen und sozialen Disziplinen sortiert sind. Auch die aktuelle Diskussion um die Digitalisierungswirkungen des autonomen Fahrens wird so geführt. Zukünftig werden sicherlich weitere Disziplinen in den Diskurs eingebunden, wie etwa die Neurologie, die Psychologie oder die Anthropologie.
2. Zugang über Materialitäten
Ein zweiter Zugang sortiert Digitalisierungsthemen rund um Materialitäten, also Themen und Handlungsfelder, die im Rahmen von Managementstrategien und der CR-Berichterstattung in einer Wesentlichkeits- oder Materialitätsmatrix abgetragen werden. Diese zeigt die Relevanz von Themen aus der (Binnen-)Perspektive des Unternehmens und aus der (Außen-)Perspektive der Anspruchsgruppen. Verantwortliche Digitalisierung definiert dabei neue Themen wie zum Beispiel Privatheit oder aber beeinflusst bestehende Themen wie transparente Wertschöpfungsketten, Gesundheit, Umweltschutz oder Compliance.
Die fünf Anwendungsbereiche von Accenture etwa folgen einer solchen Logik (Cooper, Siu und Wei 2015). Auch das Institut für Verbraucherpolitik ConPolicy und die Unternehmensberatung Systain wählen einen derartigen Zugang und definieren CDR-Themen (Systain und ConPolicy 2018), um ein weiteres Beispiel zu geben.
3. Zugang über Modalverben
Ein dritter Typ lässt sich unter grammatikalischer Sicht definieren. Unter einem Modalverb versteht man in der Sprachwissenschaft ein Verb, das sich mit der Notwendigkeit oder Möglichkeit befasst. Darunter fallen die sechs Verben »dürfen«, »können«, »mögen«, »müssen«, »sollen« und »wollen«. Während man sich beispielsweise bei technischen und finanziellen Fragestellungen eher auf ein »kann man das?« konzentriert, geht es bei den rechtlichen Aspekten um ein »darf bzw. muss man das?« und bei den ethischen Aspekten um ein »soll, will, mag oder kann man das?«. In diesem Zusammenhang gibt es in der Philosophie einen breiten Diskurs darüber, ob ein Sollen etwa ein Können impliziert (»ought implies can«). Ferner wird darüber verhandelt, welche Normen etwa durch den Staat juristisch festgelegt werden und welche sozusagen freiwillig bleiben und damit in der Verantwortung der Unternehmen liegen. Mit dem Wollen, Mögen, Sollen und Können werden eher Chancen angesprochen, mit dem Dürfen und Müssen eher Risiken. Der Zugang über Modalverben legt also das grundlegende handlungsanleitende Verständnis zur Corporate Digital Responsibility offen.
Die CDR-Initiative des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) ist hier klar positioniert: »CDR bezeichnet freiwillige unternehmerische Aktivitäten, die über das heute gesetzlich Vorgeschriebene hinausgehen und die digitale Welt aktiv zum Vorteil der Gesellschaft mitgestalten« (Punkt 5 der gemeinsamen CDR-Plattform). Insofern wird primär das Sollen adressiert, aber auch das Wollen und Mögen sowie – mit Blick auf die technischen Möglichkeiten – das Können. Die 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist eine Maßnahme, bei der Normen verrechtlicht werden, um die Privatsphäre der Kunden zu schützen (hier geht es um das Müssen und Dürfen).
4. Zugang über Werte
Ein vierter Zugang erfolgt über Werte, also subjektive Überzeugungen, Einstellungen und Neigungen von Menschen. Sie treiben Mitarbeiter an, ihren Job gut zu machen und damit stolz auf das Unternehmen zu sein. Die Qualität von Werten bestimmt die Wertepositionierung und damit das Verständnis der Corporate Responsibility des Unternehmens. Werten liegen oftmals Prinzipien zugrunde wie Privatheit, Teilhabe, Transparenz, Vertrauenswürdigkeit.
Die CDR-Initiative des BMJV zum Beispiel hat acht Prinzipien entwickelt. So sollten Unternehmen etwa die Selbstbestimmung der Verbraucherinnen und Verbraucher gewährleisten und fördern oder die digitale Transformation als Mittel sehen, um die gesellschaftliche Teilhabe zu erhöhen und in den Dienst der Nachhaltigkeit zu stellen. The Information Accountability Foundation definiert fünf »Values for an Ethical Frame«: beneficial, progressive, sustainable, respectful, fair (The Information Accountability Foundation 2015: 7 ff.).
5. Zugang über Fristigkeiten
Ein fünfter Zugang orientiert sich a...