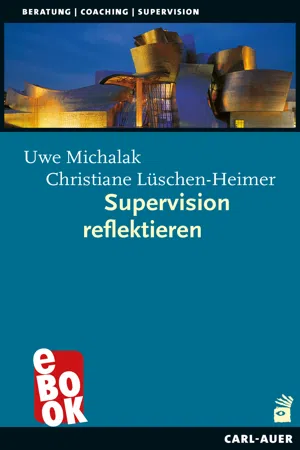![]()
1Einleitung
1.1 Vorüberlegungen zu Reflexivität und Reflexion
Beim Beratungsformat Supervision handelt es sich um eine Reflexionskommunikation. Dieses Verständnis erfordert, dass wir uns zunächst mit den Begriffen Reflexivität und Reflexion sowie ihrer sprachlichen Herkunft beschäftigen. Das Wort »reflektieren« stammt vom lateinischen Verb »reflectere« für »hinwenden« ab und bedeutet »widerspiegeln«. Schaue ich in einen Spiegel, so erhalte ich einen Außenblick auf mich, der mir ohne die Zuhilfenahme der Reflexionsfläche nicht möglich wäre. Aus dieser Außenperspektive gewinne ich neue Erkenntnisse über mich. Der Blick in den Spiegel liefert gleichzeitig eine Idee darüber, wie Selbstreflexion funktioniert. Auch besteht eine thematische Verwandtschaft mit dem Wort »Reflex«. Das Einüben von Angriffs- und Abwehrtechniken im Karate wird gelegentlich als Konditionierung von Bewegungsabläufen konzipiert. Ein kontinuierliches Training erlaubt dann, Angriffe des Gegenübers reflexhaft zu parieren.
Im Allgemeinen kann man Reflexivität als Kompetenz auffassen, Prozesse in der Supervision bewusst zu steuern. Denn Reflexivität ermöglicht gleichsam ein flexibles Einnehmen von Selbst- und Fremdbeobachtungspositionen. Nach intensiver Übung kann der Supervisor während der Supervision quasi automatisiert auf diese Perspektiven zurückgreifen. Mit Reflexion ist der Vorgang gemeint, Anliegen konstruktiv sowie kritisch zu untersuchen.
Was bedeuten diese Begriffsbestimmungen für die Praxis? Versteht sich der Supervisor als Reflexionsfläche für den Supervisanden, dann wird er dem Supervisanden seine Beobachtungen widerspiegeln. Allerdings müsste man dann im Hinblick auf seine Spiegelbilder von Bildern mit Unschärfen sprechen – und zwar deshalb, weil wir den Supervisor als einen Beobachter betrachten, der das wahrnimmt, was er wahrnimmt. Ein anderer Supervisor hätte in derselben Situation andere Beobachtungen; seine Prozess-Steuerung würde anders verlaufen. In jedem Fall entsprechen diese »Bilder« des Supervisors einer Art »Feedback«, das beim Supervisanden Prozesse der Beschäftigung mit sich selbst anregt.
Der Begriff Reflexion schließt Selbstreflexion ein. Selbstreflexion bezieht sich auf ein Nachdenken über das eigene Selbst. Sie findet in der Regel sowohl beim Supervisor als auch bei seinem Supervisanden statt und ermöglicht beiden eine Professionalisierung. Der Fokus liegt jedoch auf der Selbstreflexion des Supervisanden. Der Supervisand profitiert bei der Bearbeitung seiner Anliegen von der Reflexivität des Supervisors. Denn die Interventionen des Supervisors laden den Supervisanden zur Selbstreflexion ein. Zudem dient der Supervisor dem Supervisanden als Modell dafür, wie sich Szenen analysieren lassen.
»Nachdenken ist die Freiheit, die man im Verhältnis zu dem, was man tut, besitzt; es ist die Bewegung, durch welche man Abstand von sich gewinnt, sich selbst als Objekt konstituiert und über das Ganze dieser Bewegung als Problem nachdenkt« (Foucault, zitiert nach Forster 2014, S. 596).
Das Ereignis, in dem Reflexivität vollzogen wird, ist das der Reflexion. Reflexion beginnt, wenn man den Raum der Innenschau betritt. Hierin kann sich der Supervisand intensiv mit eigenen Handlungsweisen aus seiner Vergangenheit, Gegenwart oder im Hinblick auf seine Zukunft auseinandersetzen. Supervision bedarf der Reflexion im gleichen Maße, wie wir Menschen der Luft zum Atmen bedürfen. Die Reflexion kann sich auf verschiedenen Ebenen abspielen, die oft parallel existieren oder bewusst wie unbewusst im Hintergrund arbeiten. Unter Ebenen verstehen wir beispielsweise die Psychodynamik des Supervisanden, sein Rollenverständnis sowie Strukturen und Prozesse in Organisationen, mit denen er konfrontiert ist. Die Frage, welche Ebene ein Supervisor für die Reflexion fokussiert, hängt u. a. von seinem Handlungskonzept, seiner Praxiserfahrung, seiner psychischen Ausstattung als Person und von der aktuellen Interaktion in der Supervision ab.
Reflexivität
Im Speziellen bezeichnet man als Reflexivität die Fähigkeit, das eigene Handeln als Supervisor multiperspektivisch in den Blick zu nehmen. Damit verbinden wir das Ziel, das eigene professionelle Vorgehen zu verbessern. Weiterhin fassen wir Reflexivität als Bewusstseinsprozess und als Aktivität auf (vgl. Forster 2014, S. 590). Moldaschl (o. J.) definiert Reflexivität als die
»Fähigkeit eines sozialen Systems oder einer Person, sich zu sich selbst zu verhalten, d. h., sich von eigenen Prämissen und Handlungsprogrammen zu dezentrieren, eine kritische Sicht auf sich selbst einzunehmen, den Standpunkt eines anderen einzunehmen, sich durch die Perspektive eines anderen zu betrachten«.
Mit unserem Buch möchten wir Sie als Leser zur Selbstreflexivität anregen. Diese betrachten wir im Folgenden aus einer systemtheoretischen Perspektive. Bei der Selbstreflexivität bezieht sich das psychische System auf sich selbst. Sie lässt sich deshalb als Selbstreferenz verstehen. Psychische Systeme zeichnen sich durch eine spezielle Arbeitsweise aus: In psychischen Systemen schließen Gedanken an Gedanken an. Alle reflexiven Prozesse vollziehen sich in derselben Weise. Wie geht das psychische System dabei vor? Es orientiert sich bei diesen Prozessen an der Differenz zwischen vorher und nachher. Aus diesem Unterschied lassen sich Erkenntnisse gewinnen. Desgleichen erlaubt Reflexivität eine Steuerung von Prozessen durch das psychische System selbst. Hierbei ist zu beachten, dass das psychische System in der Selbstreferenz operativ für sich selbst nicht erreichbar ist, es bleibt für sich unbestimmt (vgl. Luhmann 1987, S. 599 ff.). Diese Grenze in der Selbsterkenntnis stellt gleichzeitig eine Grenze selbstreflexiver Prozesse dar.
In unseren Supervisionsweiterbildungen im WIST Münster 1 zielen wir darauf, die Reflexivität stetig zu fördern und auszubauen. Wir halten es für lohnenswert, diese Kompetenz im Sinne eines lebenslangen Lernens stets weiterzuentwickeln. Wir beleuchten sie nun aus sieben Positionen:
Position 1: Reflexivität erfüllt keinen Selbstzweck nach dem Motto: Solange ich reflexiv bin oder Reflexivität anrege, handele ich supervisionsgemäß. Prinzipiell dient Reflexivität dazu, Klärungsprozesse in Gang zu bringen oder Abläufe zur Zielerreichung zu unterstützen. Eine Kombination beider Zwecke liegt daher nahe. Anders formuliert: Meine Reflexivität als Supervisor ermöglicht eine genaue Untersuchung von Vorgängen während der Supervision – beispielsweise, die Anliegenentwicklung zu untersuchen, Entscheidungen zu finden, das Zusammenspiel von willkürlichen und unwillkürlichen Vorgängen zu betrachten, Handlungen zu initiieren oder Abläufe zu beenden, die für ein Vorhaben nicht mehr zieldienlich sind.
Position 2: Im Verbund mit Ziel- und/oder Klärungsprozessen können wir Reflexivität als Metakompetenz einstufen. Unter Metakompetenz verstehen wir eine Kompetenz, die für diverse Kontexte Gültigkeit hat und zugleich als Bindeglied für Einzelanalysen fungieren kann.
Position 3: Reflexivität erlaubt Betrachtungen in den drei Zeitdimensionen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Vorstellbar ist, dass ich als Supervisor vergangene Ereignisse zum Gegenstand meiner Überlegungen mache. Ich rufe mir Szenen in Erinnerung, die ich gerne erneut in ihrer Entwicklung oder in ihren Auswirkungen nachzeichnen will. Welche Motive, Absichten oder Anliegen haben mich beispielsweise dazu bewegt, so zu handeln, wie ich in der Supervisions-episode gehandelt habe? Reflexivität lässt sich zusätzlich als Vorschau auf zukünftiges Handeln richten. Wie will ich reagieren, wenn im Team erneut anliegenferne Themen angesprochen werden? Welche Handlungsalternativen stehen mir für meine Reaktion zur Verfügung? Überlege ich während eines laufenden Supervisionsprozesses, wie ich auf die Äußerungen des Supervisanden eingehe, kommt Reflexivität einem Selfmonitoring in der Gegenwart gleich.
Position 4: Reflexivität vollzieht sich stets in Interaktionen. Das sind z. B. innere Dialoge oder Gespräche zwischen zwei und mehreren Personen. Sie ist somit Bedingung wie Treibstoff für rekursive Prozesse. Als Supervisor bin ich zugleich Beobachter wie auch mein eigener Beobachtungsgegenstand: Ich beobachte, wie die Interaktion verläuft und wie ich selbst mit mir und mit dem Supervisanden interagiere. Dass sich diese Sichtweisen vermengen und gegenseitig beeinflussen (siehe oben), ist im Sinne der Rekursivität erwartbar (vgl. Forster 2014, S. 592).
Position 5: Reflexivität stufen wir als notwendige Bedingung dafür ein, Prozesse steuern zu können – beispielsweise, wenn es darum geht, situativ einen konstruktiven Umgang mit Unerwartetem im Gespräch, mit Krisen oder mit Ambivalenzen zu entwickeln. Hierin zeigt sich Reflexivität in ihrer Facette als Bewusstseinsprozess.
Position 6: Reflexivität verstehen wir ebenso als sinnvolle und nützliche Arbeitsweise. Mit ihrer Hilfe kann man a) das eigene supervisorische Vorgehen und dessen Qualität prüfen und bewerten (Monitoring) sowie b) die Reflexivität der Supervisanden beim Erreichen ihrer Supervisionsziele fördern. Denn Reflexivität verstehen wir als bedingende Kompetenz für Lern- und Veränderungsprozesse, die es in einer Supervision zu gestalten gilt.
Position 7: Angesichts diverser Lebensstile und Werthaltungen vermag uns unsere eigene Reflexivität dabei zu unterstützen, uns (begründet) zu verorten. Im Neben- und Miteinander dieser Vielfalt begeben wir uns bewusst an unseren Standpunkt und beziehen Stellung. Reflexivität verhilft uns dazu, verantwortungsbewusst eine moralische Haltung einzunehmen.
In diesen sieben Positionen scheint auf, dass wir Reflexivität als Kompetenz, Arbeitsweise, Bewusstseinsprozess und Beobachtungsvorgang schätzen. Zugleich sind wir mit einer kritischen Perspektive auf die Reflexivität selbst beschäftigt. Denn Studien deuten darauf hin, dass wir uns unsere Erklärungen ad hoc zurechtlegen, wenn wir nach unseren Motiven gefragt werden. Einige Stunden später nennen wir auf dieselbe Frage andere Beweggründe (vgl. Chater 2019, S. 47). Diese Konstruktionsleistungen gehören zur Reflexivität.
Wenn wir reflexiv sind, sprechen wir auch nach innen; wir führen dann einen inneren Dialog. Aufgrund von drei Überlegungen verfolgen wir diesen Dialog mit Humor und Neugierde:
•Wir wissen, dass wir stets nach Erklärungen suchen, um zu verstehen, weshalb wir so handeln, wie wir handeln.
•Wir wissen, dass wir uns mithilfe von zurechtgelegten Gründen Prozesse erklären.
•Wir wissen, dass wir darüber hinaus Plausibilitäten und Sinnhaftigkeit erzeugen.
Die naheliegende Schlussfolgerung, dass wir unsere Welt konstruieren, befreit uns davon, (zeit)intensiv nach dem wahren Motiv zu suchen. Getrost können wir auf unseren Plausibilitäten weiterführende Überlegungen aufbauen, um andere Perspektiven einzunehmen – wohlwissend, dass sie wahrscheinlich nur für eine kurze Strecke Orientierung verleihen. Mit Achtsamkeit für liebgewonnene Deutungsmuster und mit einer Neugier für Quergedanken plädieren wir für eine Offenheit im Hinblick auf die Beweggründe, die wir formulieren. Diese Offenheit kann die Grundlage für eine verantwortungsbewusste und respektvolle Kreativität sein. Die Selbstreflexion kann hiervon profitieren.
Selbstreflexion lohnt sich außerdem, weil sie ein lebenslanges ...