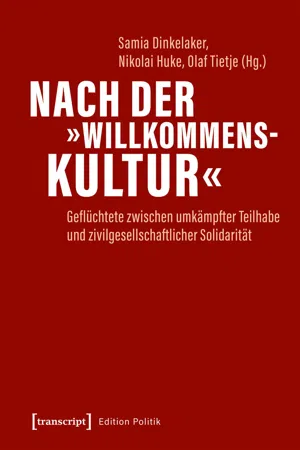
eBook - ePub
Nach der »Willkommenskultur«
Geflüchtete zwischen umkämpfter Teilhabe und zivilgesellschaftlicher Solidarität
- 250 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Nach der »Willkommenskultur«
Geflüchtete zwischen umkämpfter Teilhabe und zivilgesellschaftlicher Solidarität
Über dieses Buch
Die 2015 einsetzende »Willkommenskultur« in Deutschland wird vielen Aktiven als Sternstunde zivilgesellschaftlichen Engagements im Gedächtnis bleiben. Zugleich war und ist die Teilhabe von Geflüchteten umkämpft und es fallen viele rassistische Übergriffe und Anschläge in die Zeit nach dem »Sommer der Migration«. Die Beiträger*innen des Bandes liefern auf Grundlage von über 160 Interviews mit Geflüchteten, zivilgesellschaftlichen Organisationen und staatlichen Stellen eine reflektierte Bestandsaufnahme und Interpretation dieser Phase. Ihr empirisch differenzierter und vielschichtiger Überblick bietet theoretische Impulse zu Debatten um Mikropolitiken des Engagements, Solidarität und ein alltagszentriertes Demokratieverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Nach der »Willkommenskultur« von Samia Dinkelaker, Nikolai Huke, Olaf Tietje, Samia Dinkelaker,Nikolai Huke,Olaf Tietje im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Bildung Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Transversale und inklusive Solidaritäten im Kontext politischer Mobilisierungen für sichere Fluchtwege und gegen Abschiebungen
In Zeiten des wachsenden Rechtspopulismus und Autoritarismus haben zivilgesellschaftliche Initiativen, die in Solidarität mit denjenigen handeln, die als außerhalb der nationalstaatlich organisierten Solidargemeinschaft stehend betrachtet werden, eine entscheidende Funktion. Sie hinterfragen und verhandeln die dominante Ausgrenzung von Nicht-Staatsangehörigen neu, indem sie humanitäre Hilfe leisten, alternative Räume der Zugehörigkeit schaffen und Rechte sowie demokratische Prinzipien artikulieren. Dabei ist die Teilhabe von Nicht-Staatsangehörigen umkämpft, manchmal mehr, manchmal weniger. Der Grad des Umkämpftseins hängt bei Themen um Migration damit zusammen, wie sehr die Anliegen der Betroffenen in den hegemonialen Diskursen der Mehrheitsgesellschaft als legitim gelten. So ist es einfacher, die schulische Teilhabe von Kindern zu fordern als das Bleiberecht für abgelehnte Asylsuchende. Das, was als legitim gilt, ist auch eine Frage der jeweiligen Kräfteverhältnisse, der spezifischen historischen Situation und der diskursiven Rahmung durch die Akteur*innen. Zu Hochzeiten der Willkommenskultur, als selbst die BILD-Zeitung sich als deren Avantgarde darstellte (#refugeeswelcome, BILD 29.08.2015) und in Fußballstadien ›refugees welcome‹ skandiert wurde, verliefen die Diskurse anders als fünf Jahre später.
Während migrantische Selbsthilfe und Selbstorganisierungen bei der Unterstützung Geflüchteter eine wesentliche Rolle spielen (Ataç et al. 2015; Schwiertz 2019; Ataç/Steinhilper 2020), rücken wir in unserem Beitrag die Solidarität von Mitgliedern der sogenannten Mehrheitsgesellschaft in den Mittelpunkt: Welchen Beitrag leisten sie mit ihrer Unterstützung zur Überwindung von Ausschlüssen? (Wie) hinterfragen sie dominante Strukturen, die sich nicht direkt und negativ auf sie selbst auswirken? Formulieren sie Alternativen zu ethno-nationalen Staatsbürgerschaftsregimen, oder reproduzieren sie hegemoniale Grenz- und Migrationsregime, nationalistische und anti-migrantische Diskurse sowie Formen exklusiver Solidarität?
Diese Fragen stellen sich vor dem Hintergrund eines historischen Prozesses, in dem Solidarität im maskulin geprägten, nationalen Sozialstaat institutionalisiert wurde (Kreisky 1999; Oosterlynck et al. 2015). In letzter Zeit wird jedoch zunehmend eine Krise dieser nationalen Institutionalisierung von Solidarität diagnostiziert, wobei oftmals Migration als eine Ursache derselben dargestellt wird. So stellen einige Analysen einen ›multikulturellen‹ Modus der Integration und die wohlfahrtsstaatliche Teilhabe von Migrierten in einen Zusammenhang mit geringen ›Integrationserfolgen‹ und Segregation (Koopmans 2010) und suggerieren, sie seien eine Gefahr für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Die Anerkennung und Teilhabe von Migrierten werden also in einem Spannungsverhältnis zur Zugehörigkeit und Solidarität im nationalen Rahmen gesehen.
In diesem Beitrag arbeiten wir verschiedene Ansätze von Solidarität heraus, die sich gegen den methodologischen Nationalismus solcher Diagnosen richten. Hierbei analysieren wir gegenwärtige Auseinandersetzungen um Solidarität, die sich insbesondere in Bezug auf Migration ergeben: Einerseits werden Grenzen der Solidarität gezogen, indem Migrant*innen als Belastung beschrieben und von nationaler Solidarität ausgeschlossen werden; andererseits entstehen neue Formen inklusiver Solidarität durch pro-migrantisches Engagement.
Empirisch arbeiten wir mit Ergebnissen aus zwei Forschungsprojekten zum Zugang zu Schutz für Geflüchtete1 und zu Mobilisierungen gegen Abschiebungen in Deutschland2 sowie den Diskussionen aus dem Projekt »Willkommenskultur und Demokratie«.3 Verständnisse von Solidarität standen nicht dezidiert im Fokus der jeweiligen Forschung, dennoch lässt sich dieser Aspekt aus dem Material herausarbeiten. Solidarität hat sich zudem als eine Schlüsselkategorie erwiesen, um die Praktiken der untersuchten Initiativen in einem weiteren gesellschaftlichen Zusammenhang zu begreifen.
Im Folgenden entwickeln wir zunächst das konzeptionelle Verständnis transversaler und inklusiver Modi von Solidarität. Mittels dieser theoretischen Perspektive werden wir anschließend zwei Fälle pro-migrantischer Solidarität analysieren: Mobilisierungen gegen Abschiebungen und das Engagement für sichere Fluchtwege.
Transversale und inklusive Solidarität
Unterschiedliche Theorien zu Solidarität wie jene von Chandra Talpade Mohanty (2003), Nira Yuval-Davis (1999), Hauke Brunkhorst (1997) und anderen stimmen darin überein, dass Praktiken der Solidarität Differenzen nicht aufheben. Vielmehr nehmen sie Differenzen als Ausgangspunkt, um sie miteinander in Beziehung zu setzen. So können solidarische Praktiken neue Ebenen und Formen von Solidarität entwickeln, die über lang etablierte Vorstellungen von nationaler Zugehörigkeit und Zusammenhalt hinausgehen. Ebendiese Vorstellungen einer primär nationalen Solidargemeinschaft sind aber weiterhin vorherrschend.
In gegenwärtigen Debatten und Auseinandersetzungen um Migration wird um das Solidaritätsverständnis gerungen. Transversale und inklusive Verständnisse sowie Praktiken stehen exkludierenden und exklusiven gegenüber, wenngleich das Verhältnis von Inklusion/Exklusion sozialtheoretisch als wechselseitig aufeinander bezogen gedacht werden muss. In aktuellen Debatten bezeichnet ›exklusive Solidarität‹ Solidaritätsvorstellungen rechter und rechtspopulistischer Parteien und Bewegungen (Fischer 2019), die Solidarität dezidiert national verstanden wissen wollen – »Solidarität zuerst für uns und unter uns« (Bude 2019: 10). Aber auch in wohlfahrtsstaatlichen Diskussionen spielt die Idee der exklusiven Solidarität eine wichtige Rolle, da sie als eine Solidarität der Beitragszahlenden untereinander gedacht wird, die Risiken solidarisch abfedern und füreinander einstehen. Diese Vorstellung ist tief verankert in Entwicklungen des 19. Jahrhunderts, als das Kleinbürgertum und Arbeiter*innen auf Solidarbeiträgen beruhende Versicherungen etablierten (Demirović 2010). Dieses Versicherungsdenken impliziert ein exklusives Verständnis von Solidarität, da nicht alle von diesen Solidarbeiträgen profitieren. Gerade Personen, die den gesellschaftlichen Normen nicht entsprechen und/oder die Beiträge nicht zahlen können, fallen heraus, obwohl sie die Versicherungsleistungen eigentlich besonders nötig hätten. Für jene Herausgefallenen sind wohlfahrtsstaatliche Instrumente zuständig, die der Bedürftigkeitslogik folgen. Die meisten Solidarsysteme sind an den nationalstaatlichen Bezugsrahmen gekoppelt (Torp 2020), sowohl weil vorwiegend staatsbürgerlich Zugehörige von ihnen profitieren als auch weil sie selten über den nationalstaatlichen Rahmen hinaus gedacht werden. In aktuellen Debatten um Migration, die Öffnung oder Schließung von Fluchtrouten, die Aufnahme von Geflüchteten und im weiteren Sinne eine Idee offener Grenzen werden genau auf diese tiefsitzenden nationalstaatlich orientierten Solidaritätsvorstellungen rekurriert und Konkurrenzverhältnisse zwischen ›Einheimischen‹ und Migrant*innen als gesetzt verstanden (Streeck 2018; Deutschmann 2016; kritisch dazu u.a.: van Dyk/Gräfe 2019). Dieser Logik zufolge ist ein auf die Ausweitung auf Migrant*innen und Geflüchtete gerichtetes Verständnis von Solidarität automatisch gegen ›die Arbeiterklasse‹, Geringverdienende oder schon länger aufhältige Migrant*innen gerichtet und führe zwangsläufig zu Konflikten. Daher haben es transversale und inklusive Solidaritätsverständnisse paradoxerweise in ausgeprägten wohlfahrtsstaatlichen Kontexten schwer, wenn sie für Unterstützung werben.
Auch in der Europäischen Union gilt ein Verständnis von nationaler und nationalstaatlich beschränkter Solidarität. Der Begriff der Solidarität wird hauptsächlich als Solidarität zwischen den nationalen Mitgliedstaaten definiert. Dies wird deutlich in den Debatten über die Verteilung von ›Flüchtlingen‹, welche als ›Lastenteilung‹ (burden sharing) bezeichnet wird. Durch diese Logik wird zum einen die exklusive Solidarität der Nationalstaaten reproduziert, die Geflüchtete nicht dazu zählt, sondern als Last beschreibt. Zum anderen kann die Europäische Union insgesamt als eine Gemeinschaft der exklusiven Solidarität beschrieben werden, die durch Politiken der Abschottung gegenüber Migration zu einer weiteren Externalisierung sozialer Probleme beiträgt (Lessenich 2016). Diese wird u.a. realisiert durch eine verstärkte Grenzabschottung und push-backs von Geflüchteten im Mittelmeer in türkische Gewässer und nach Libyen. Dahinter steht ein zweifaches exklusives Solidaritätsverständnis: die Annahme unter Nationalstaaten und im Binnenverhältnis, dass es Konkurrenzverhältnisse zwischen ›Einheimischen‹ und ›Migrant*innen‹ gibt und folglich staatlich verantwortliches Handeln primär den Interessen der ›Einheimischen‹ gerecht werden müsse.
Dieser national eng gefassten, staatlich institutionalisierten Form exklusiver Solidarität stellen wir Konzepte transversaler und inklusiver Solidarität gegenüber. Transversale und inklusive Solidarität begreifen wir hierbei als zwei Facetten der Infragestellung exklusiver Solidaritäten: Während der Begriff der transversalen Solidarität verdeutlicht, wie solidarische Praktiken die Grenzen vermeintlich klar definierter sozialer Einheiten überschreiten, zeigt der Begriff der inklusiven Solidarität, wie neue Beziehungen und kollektive Subjektivitäten entstehen.
Als grundlegend für Praktiken einer transversalen Solidarität erachten wir die drei von Nira Yuval-Davis genannten Voraussetzungen für transversale Politiken: erstens eine standpunkttheoretische Epistemologie, in der die unterschiedlichen Situiertheiten der Akteur*innen als relevant erachtet werden; zweitens ein gelebtes Verständnis von Gleichheit in der Differenz; und drittens eine konzeptionelle wie auch politische Unterscheidung von Positionierung, Identität und Werten (Yuval-Davis 1999: 94f.). Darunter versteht sie, dass »[p]eople who identify themselves as belonging to the same collectivity or category can be positioned very differently in relation to a whole range of social divisions (e.g. class, gender, ability, sexuality, stage in the life cycle etc). At the same time, people with similar positioning and/or identity, can have very different social and political values« (Yuval-Davis 1999: 95). Unter diesen Voraussetzungen, so Yuval-Davis, können sich transversale politische Praxen entwickeln, die die Positionen in bestehenden Machtverhältnissen berücksichtigen, aber auch darüber hinausgehende solidarische Beziehungen ermöglichen (Yuval-Davis 1999: 98; vgl. Braun 2019). Anschließend an diese Überschreitung gesellschaftlich zugewiesener Positionen und Identitäten, die wir als Praxen transversaler Solidarität begreifen, können alternative Formen einer inklusiven Solidarität entwickelt werden, in denen sich zunächst lose geknüpfte Verbindungen zu neuen Beziehungsweisen, Kollektivitäten und Vorstellungen von Zugehörigkeit verdichten, die das Potenzial haben, bestehende Ungleichheiten abzumildern. Monika Mokre hat den dafür notwendigen Modus treffend als »Übersetzung« bezeichnet (Mokre 2015), denn das Entstehen von Solidarität zwischen Personen in prekären Lebenslagen und abgesicherten Personen erfordert vielfältige Übersetzungsleistungen, insbesondere wenn sie unter den Bedingungen globaler sozialer Ungleichheiten aus unterschiedlichen politischen Kulturen kommen. So ist beispielsweise nicht immer allen Beteiligten klar, ob an praktische Unterstützung vielleicht Erwartungen für Gegenleistungen geknüpft sind. Während eine vollständig inklusive Solidarität kaum vorstellbar ist, können wir Praktiken und Akte der inklusiven Solidarität identifizieren, die diese anstreben.
Mit einem nicht-essentialistischen Begriff inklusiver und transversaler Solidarität wollen wir in den Blick nehmen, wie solidarische Praxen und Beziehungsweisen die Strukturen exklusiver Solidarität herausfordern und umgehen: Wie sie Grenzen etablierter Gemeinschaften und Identitäten überschreiten, neue Verbindungen aufbauen und so potenziell zu neuem gesellschaftlichen Zusammenhalt auf breiterer Ebene beitragen. In den von uns analysierten Mobilisierungen im Feld von Fluchtwegen und Abschiebungen geht es ganz zentral um Auseinandersetzungen um in- und exklusive Formen der Solidarität sowie die Grenzen von Solidargemeinschaften. Aufgrund der Herausforderung der in weiten Teilen der Bevölkerung hegemonialen engen Kopplung von Migration und exklusiven Solidaritätsvorstellungen interessiert uns in diesem Beitrag, wie im Kontext der vorherrschenden exklusiven Solidaritäten inklusive und transversale Ideen und Praxen von Solidarität entworfen und gelebt werden. Wir haben Fälle gewählt, in denen Schutzsuchende und Migrant*innen besonders prekär situiert sind, weil sie sich entweder noch außerhalb des Nationalstaates auf gefährlichen Fluchtrouten, im Transit und in Geflüchtetenlagern befinden oder durch das Instrument der Abschiebung wieder außer Landes gebracht werden sollen. Wir begreifen Solidarität hierbei einerseits als ein analytisches Prisma zur Untersuchung von Praktiken, Beziehungen, Subjektivitäten und Institutionen und andererseits als ein Prinzip, das nicht erreicht werden kann, sondern immer wieder im Sinne einer »kommenden Demokratie« angestrebt werden muss (Derrida 2005). Dabei ist dies keine lineare Entwicklung in Richtung einer größeren Solidarität mit den Ausgegrenzten oder Migrant*innen.4 Da Solidarität ebenso wieder entzogen werden kann und diejenigen, die sich für Migrant*innen und Geflüchtete einsetzen, selbst ausgegrenzt werden können (Feischmidt 2020), bleiben transversale und inklusive Solidarität stets umkämpft und pro-migrantische Praktiken der Solidarität eine unendliche Aufgabe.
Verständnisse und Praktiken von Solidarität in pro-migrantischem Engagement
In diesem Teil des Beitrags betrachten wir solidarische Praktiken und deren Artikulation durch die Engagierten in zwei Fällen, erstens bei Mobilisierungen gegen Abschiebungen und zweitens dem Engagement für sichere Fluchtwege. Uns interessiert dabei, welche Formen die solidarischen Praxen annehmen und inwiefern sich in ihnen inklusive und transversale Elemente zeigen bzw. diese in den Bewegungen und Initiativen thematisiert werden.
Abschiebungen: Wer verdient Solidarität bei Mobilisierungen gegen Abschiebungen?
Welche Art von solidarischen Praktiken entwickeln sich im Fall von Abschiebungen5, wenn also der Staat entscheidet, dass jemand das Land verlassen muss und die Person sich weigert, dies freiwillig zu tun?6 Abschiebungen führen grundsätzlich und ganz konkret zu der Frage, wer zu einer Gesellschaft dazugehört und wer es verdient, dazuzugehören (Anderson et al. 2011: 548). Durch die Ausreisepflicht besteht die unterschwellige Annahme, dass die abzuschiebenden Personen kein Bleiberecht haben. Daher sind es gerade Abschiebeproteste, in denen unterschiedliche Argumentationen in Anschlag gebracht werden, warum jemand doch ein Anrecht auf Bleiben und gesellschaftliche Teilhabe haben soll.
Für ein differenziertes Verständnis von Protesten gegen Abschiebungen ist es nützlich, mit dem Konzept der ›Abschiebbarkeit‹ (deportability) zu arbeiten, mit dem weniger Abschiebungen selbst untersucht werden, sondern wie sich die drohende Möglichkeit einer Abschiebung auf Betroffene auswirkt (De Genova/Peutz 2010). Im Zusammenhang dieses erweiterten Verständnisses der Problematik der Abschiebun...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Einleitung: Umkämpfte Teilhabe
- Gesellschaftliche Teilhabe und politische Partizipation
- Grenzraum jenseits der Grenze?
- Schutz für geflüchtete Frauen* im Spannungsfeld von besonderer Schutzbedürftigkeit und restriktiven Migrationspolitiken
- Strategische Selektivitäten im kafkaesken Staat
- Queere Geflüchtete im Unterbringungssystem
- Die Erfahrung der ›Anderen‹
- Transversale und inklusive Solidaritäten im Kontext politischer Mobilisierungen für sichere Fluchtwege und gegen Abschiebungen
- Zwischen Funktionalismus und feministischer Systemkritik
- »So, jetzt sind wir hier.«
- Filmographie
- Autor*inneninformation