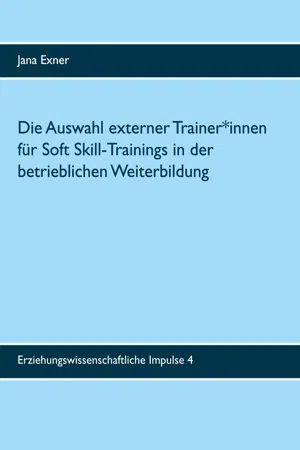![]()
1. Theoretische Grundlagen
1.1. Begriffsdefinition
Um das Verständnis der in dieser Arbeit verwendeten Begriffe zu klären, werden im Folgenden die für die Arbeit relevanten Fachbegriffe definiert. Zunächst wird die betriebliche Weiterbildung als Forschungsumgebung des in dieser Arbeit untersuchten Gegenstands näher erläutert. Anschließend wird auf die Spezifika von Soft Skills und den Maßnahmen zur Vermittlung ebendieser eingegangen. Abschließend wird die Rolle externer Trainer*innen in der betrieblichen Weiterbildung ins Auge gefasst.
1.1.1. Betriebliche Weiterbildung
„Um den wirtschaftlichen Erfolg zu sichern, entwickeln sich Unternehmen immer weiter zu dynamischen und vernetzten Organisationen mit permanenten Kommunikations-, Lern- und Veränderungsprozessen“ (Beyer-Stiepani und Scarbath 2012, S. 23).
In diesem Zusammenhang rückt die kontinuierliche Fort- und Weiterbildung der Mitarbeitenden in den Fokus. Sie dient dazu, die Mitarbeitenden eines Unternehmens so zu qualifizieren, dass sie das Wissen, die Fähig- und Fertigkeiten sowie die Kompetenzen erlangen, um ihre Ziele und die Ziele des Unternehmens optimal erreichen zu können (ebd.).
Weiterbildung wird nach der Bildungskommission/dem Deutschen Bildungsrat (1970) definiert als „Fortsetzung oder Wiederaufnahme organisierten Lernens nach Abschluß einer unterschiedliche ausgedehnten ersten Bildungsphase“ (ebd., S. 197). Weiterbildung umfasst nach dieser Definition, neben der Erweiterung der Grundbildung, sowohl berufliche und politische als auch allgemeine Weiterbildung, jedoch nicht das Anlernen oder Einarbeiten am Arbeitsplatz (Bildungskommission/Deutscher Bildungsrat 1970). Betriebliche Weiterbildung setzt sich aus allen Maßnahmen zusammen, die Unternehmen zur fortlaufenden (Weiter-)Qualifizierung ihrer Mitarbeitenden nach der Erstausbildung einsetzen (Personalwirtschaft 2018). Neben den klassischen Weiterbildungsformaten, wie Kursen, Seminaren und Präsenzveranstaltungen, werden zunehmend auch E-Learning-Angebote, Coaching oder arbeitsplatznahe Projekte wie z.B. Job Rotation eingesetzt (Busse und Heidemann 2012, S. 11).
„Allgemeines Ziel der betrieblichen WB [Weiterbildung] ist es, dem Unternehmen dasjenige Potenzial an Arbeitskräften zur Verfügung zu stellen, das zur Erreichung des Betriebsziels erforderlich ist“ (Arnold et al. 2010, S. 39). Zu diesem Zweck werden sowohl fachliches als auch überfachliches Wissen trainiert (Arnold et al. 2010, S. 39). Um das beschriebene Ziel zu erreichen, können u.a. folgende Arten der betrieblichen Weiterbildung eingesetzt werden:
- Anpassungsfortbildung dient dazu, den/die Mitarbeitende für die sich aktuell stellenden beruflichen Herausforderungen zu qualifizieren.
- Aufstiegsfortbildung dient dazu, dem/der Mitarbeitenden eine höhere Qualifikation (zertifiziert oder nichtzertifiziert) zu ermöglichen.
- Betriebliche Weiterbildung dient im Allgemeinen dazu, die vorhandenen beruflichen Qualifikationen der Mitarbeitenden zu sichern und sie laufend im Hinblick auf die neuen Herausforderungen im Arbeitsumfeld weiterzuentwickeln.
- Interne betriebliche Weiterbildung findet im Betrieb statt und wird für die Mitarbeitenden im Unternehmen angeboten. Sie kann sowohl Anpassungs- als auch Aufstiegsfortbildung sein.
- Externe betriebliche Weiterbildung findet außerhalb des Betriebs in einer Weiterbildungseinrichtung statt und kann ebenfalls Anpassungs- oder Aufstiegsfortbildung sein.
- Umschulungen dienen der zusätzlichen Qualifikation, wenn die aktuellen Qualifikationen den Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr gerecht werden (Arnold et al. 2010, S. 45).
Diese Arbeit bezieht sich sowohl auf die interne als auch die externe betriebliche Weiterbildung, die eine Anpassung an die beruflichen Gegebenheiten und/oder den beruflichen Aufstieg zum Ziel haben kann.
1.1.2. Soft Skills und Soft Skill-Trainings
In dieser Arbeit soll spezifisch auf den Auswahlprozess und die Kompetenzen von Trainer*innen für Weiterbildungsmaßnahmen zur Vermittlung von Soft Skills eingegangen werden, da diesen zunehmende Bedeutung im betrieblichen Alltag zugemessen wird (Moser 2018, S. 91). Der Begriff „Soft Skill“ bezeichnet außerfachliche oder fachübergreifende Kompetenzen, die sich auf die Persönlichkeit beziehen und, im Gegensatz zu „Hard Skills“, über die fachlichen bzw. berufstypischen Fähigkeiten hinausgehen. Während Hard Skills, die z.B. in Studium und Ausbildung vermittelt werden, objektiv sichtbar gemacht und mit Tests überprüft werden können, sind Soft Skills schwieriger zu erfassen. Soft Skills umfassen „Eigenschaften, Fähigkeiten und Qualifikationen, die neben den Hard Skills berufliche und private Erfolge bestimmen. Sie betreffen persönliche, soziale und methodische Kompetenzen“ (Hesse und Schrader 2015), darunter z.B. Teamfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, Einfühlungsvermögen und Konfliktfähigkeit (ebd.).
Trainings werden nach O'Connor und Seymour (1996) in drei Kategorien eingeteilt: Training als Lernen durch Wissensaneignung und -anwendung, Training als Erlernen von Fertigkeiten und Training auf der Ebene von Einstellungen und Werten (ebd., S. 38). Nach Rimser (2011) lassen sich in Anlehnung an diese Einteilung folgende Arten von Trainings unterscheiden:
- Fachtraining (zur Wissensvermittlung)
- Verhaltenstraining (zur Anleitung der Teilnehmenden, sich selbst Wissen und die Anwendung des Wissens anzueignen)
- Persönlichkeitstraining (zur Vermittlung von Werten und Einstellungen).
In Fachtrainings nimmt der/die Trainer*in die Rolle des/der Expert*in ein. Sein/Ihr Wissen wird im Rahmen von Vorträgen, Lehrgesprächen und/oder Praxisbeispielen an die Teilnehmenden weitergegeben. Die Lehrperson benötigt entsprechend umfassendes Fachwissen sowie Fachkompetenz in ihrem Bereich (ebd., S. 24).
Das Verhaltenstraining dient der Vermittlung von Fertigkeiten. Zu diesem Zweck werden realitätsnahe Übungen, z.B. Rollenspiele und Fallbeispiele, genutzt. Der/Die Trainer*in sollte hier neben fachlicher Kompetenz und Fachwissen auch methodischdidaktische und reflexive Kompetenz mitbringen, sodass er/sie sowohl Anteile des/der fachlichen Expert*in als auch einer reflektierenden Instanz innehat. Beispiele für diese Art von Trainings sind Verkaufs-, Bewerbungs- und Rhetoriktrainings (ebd.).
Persönlichkeitstrainings sind darauf ausgerichtet, dass die Teilnehmenden sich selbst, ihre Identität und ihr Werte- und Glaubenssystem hinterfragen. Trainer*innen dieser Trainings sollten neben der fachlichen Expertise insbesondere Einfühlsamkeit, pädagogische sowie psychologische Kenntnisse mitbringen. Beispiele für diesen Bereich sind alle Themen mit sozialem/personalem Bezug, wie Kommunikation, Konfliktmanagement und Mediation (ebd., S. 25).
Diese Arbeit bezieht sich auf Soft Skill-Trainings und damit in erster Linie auf die Ebene der Verhaltens- und Persönlichkeitstrainings.
1.1.3. Externe Trainer*innen in der betrieblichen Weiterbildung
In dieser Arbeit werden diejenigen Lehrenden in der betrieblichen Weiterbildung näher betrachtet, die nicht in Unternehmen festangestellt sind. Sie werden im Weiteren als (externe) Trainer*innen bezeichnet. Weitere Termini sind z.B. Dozent*in, Schulungs-, Seminar- und Kursleitende*r, Personalentwickler*in, Erwachsenenbildner*in oder Weiterbildner*in (Fuchs 2011, S. 52–53). Die Studie nach Fuchs (2011)2 bildet sehr unterschiedliche Bezeichnungen der Tätigkeiten der befragten Trainer*innen ab: so verstehen sich die Befragten zwar am stärksten als „Trainer“ (Mittelwert 3,76), nennen aber auch die Begriffe „Coach“, „Erwachsenenbildner“ und „Dozent“. Es wird außerdem deutlich, dass unterschiedliche Bezeichnungen u.a. in Abhängigkeit des aktuellen Kontexts genutzt werden – abhängig davon, mit welcher Bezeichnung sich die Tätigkeit am besten vermarkten lässt (ebd., S. 169–174). Die Vielfalt an Berufsbezeichnungen lässt vermuten, dass keine einheitlichen Kriterien für das Berufsbild des/der Trainer*in existieren. Niedermair (1997)3 führt das Fehlen eines einheitlichen Berufsbilds u.a. auf die kontextabhängige Variation von Rollen- und Selbstverständnis der Trainer*innen zurück: je nach Ansprüchen des Auftraggebenden, der Teilnehmenden oder des/der Trainer*in selbst charakterisiert er/sie sich als Fachexpert*in, Wissensvermittler*in, Moderator*in, Berater*in, Problemlöser*in, Motivator*in oder Begleiter*in (ebd., S. 219)4.
In der betrieblichen Weiterbildung werden sowohl interne als auch externe Trainer*innen eingesetzt. In der Untersuchung von Niedermair (1997) gaben 77,9% der teilnehmenden Personalentwickler*innen an, dass sie sowohl interne als auch externe Trainer*innen einsetzen, 16,8% engagieren ausschließlich externe Trainer*innen. Externe Trainer*innen sind oft bei einem Weiterbildungsinstitut selbständig oder auf Honorarbasis tätig (Kraft et al. 2009, S. 15).
In dieser Arbeit liegt das Augenmerk auf den externen Trainer*innen, da auf den Auswahlprozess von Trainer*innen und insbesondere die gewünschten Kompetenzen eingegangen werden soll. Diese stehen bei der Auswahl von externem Personal vermutlich stärker im Vordergrund als bei intern beschäftigten Personen. Im Vergleich zur Auswahl interner Mitarbeitender kommt Faktoren wie Teampassung, die keinen direkten erwachsenenbildnerischen Bezug haben, bei der Auswahl externer Mitarbeitender nur eine untergeordnete Rolle zu, sodass sich diese Gruppe besser zur Erfassung der erforderlichen erwachsenenpädagogischen Kompetenzen im Auswahlprozess eignet.
Externe Trainer*innen meint also in dieser Arbeit alle in der betrieblichen Weiterbildung tätigen Trainer*innen, die nicht bei dem Unternehmen, für das sie eine Weiterbildungsmaßnahme durchführen, festangestellt sind. Sie können jedoch durchaus bei einer Organisation beschäftigt sein, die Weiterbildungsmaßnahmen als Dienstleistung für Unternehmen anbietet.
Fuchs (2011) hält folgende Punkte als Aufgabenbereich eines/r Trainer*in in der betrieblichen Weiterbildung fest:
- „Bedarfsermittlung und Bildungsbedarfsanalyse […]
- Entwicklung von Designs und Konzepten/didaktischmethodische Planung/Modellentwicklung
- (Weiter-)Entwicklung von Übungen, Methoden, etc. […]
- Führung/Leitung
- Strukturierung
- Moderation von Diskussionsprozessen
- Präsentation und Vortrag
- Anleitung/Moderation von Präsentationen der TeilnehmerInnen bzw. von Kleingruppen
- Anleitung und Stellung von Übungsaufgaben
- Gestaltung bzw. Einteilung von Bewertungen/Feedback
- Einteilung, Anleitung und Betreuung von Kleingruppen
- Sicherstellung des Lerntransfer
- Evaluation/Erfolgskontrolle […]
- Anleitung von Reflexionen
- Umgang mit Technik, Medien, Material etc.
- Beratung
- Entwicklung von Lehr-/Lernmaterialien“ (Fuchs 2011, S. 54-55).
Die Durchführung der Veranstaltung wird von den von Fuchs (2011) befragten Trainer*innen in zeitlicher Hinsicht als Hauptaufgabe genannt (Fuchs 2011, S. 197). Neben der didaktischpädagogischen Gestaltung der Lernprozesse fließen auch ökonomische und administrative Tätigkeiten, wie Marketing, Akquise und Buchhaltung in den Aufgabenbereich von freiberuflichen und selbständigen Trainer*innen ein (Wißhak und Hochholdinger 2015, S. 114–115). Folgend soll der Fokus jedoch auf dem Auswahlprozess und den Auswahlkriterien seitens der Auftraggebenden liegen, da für diese die fachlichen und pädagogischdidaktischen Kompetenzen eher von Interesse sind, weil diese für den Erfolg einer Weiterbildungsmaßnahme relevant sind (ebd.). Zudem nehmen Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen am meisten Zeit in Anspruch, sodass dort der Schwerpunkt der Tätigkeit der Trainer*innen liegt (Fuchs 2011, S. 194–197; Kraft 2006, S. 18). Daher werden organisatorische Aufgaben in dieser Arbeit nicht berücksichtigt.
Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Hauptaufgabe der Trainer*innen, auf die sich diese Arbeit bezieht, in der Konzipierung und Durchführung von Trainings bzw. Seminaren und seminarähnlichen Veranstaltungen, die der Weiterbildung einer Gruppe dienen, liegt5. In den folgenden Kapiteln wird zunächst auf die Kriterien zur Auswahl von Trainer*innen und anschließend auf den Prozess der Auswahl eingegangen. Diese Reihenfolge wird gewählt, um zu Beginn die Kriterien zu beleuchten, die während des Auswahlprozesses eine Rolle spielen, sodass auf dieser Basis deutlich wird, weshalb ein bestimmtes Vorgehen zur Auswahl gewählt wird.
1.2. Kriterien in der Trainer*innenauswahl
Darüber, dass dem/der Trainer*in und seinen/ihren Kompetenzen in der betrieblichen Weiterbildung große Bedeutung zukommt, sind sich viele Expert*innen einig (Ambos et al. 2015, S. 16; Kraft et al. 2009, S. 9–10; Niedermair 1997, S. 219; Wißhak und Hochholdinger 2015, S. 113). Trotzdem gibt es bislang wenig Forschung zur Rolle der Lehrenden von Weiterbildungsmaßnahmen, während zum Trainingserfolg reichlich wissenschaftliche Literatur zur Verfügung steht. Diese bezieht sich zwar in Teilen auf die Kompetenzen der Lehrperson, jedoch nur hinsichtlich ihres Effekts auf den Trainingserfolg und den erfolgreichen Transfer der gelehrten Inhalte. Nach Burke und Hutchins (2007) sind für einen erfolgreichen Transfer in die Praxis vor allem die fachlichen Kenntnisse, die professionelle Erfahrung und die Kenntnis von Lehrprinzipien wichtig (ebd., S. 268). In der Delphi-Studie von Donovan und Darcy (2011) wird die Trainer*innenperformanz ebenfalls als bedeutender Faktor für den erfolgreichen Transfer des Gelernten genannt. Insbesondere der Enthusiasmus dem Thema gegenüber, der engagierte Einsatz für die Ziele des Trainings und die Fähigkeit des/der Trainer*in, Inhalt und Vorgehensweise an die individuellen (Job-)Anforderungen der Teilnehmenden anzupassen, seien von Bedeutung für den Trainingserfolg. Auch eine gute Vorbereitung des Trainings und die kompetente Art des/der Trainer*in, Feedback zu geben, scheinen relevante Faktoren zu sein (ebd., S. 129–132). In der Unterrichtsforschung finden sich ebenfalls Hinweise darauf, dass das Lehrpersonal eine bedeutende Rolle für die Qualität von Lernprozessen darstellt6. In diesem Bereich existieren bereits klare Anforderungen für Lehre...