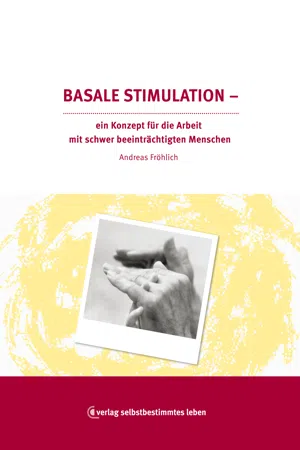
eBook - ePub
Basale Stimulation
Ein Konzept für die Arbeit mit schwer beeinträchtigten Menschen
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Basale Stimulation – Dieses Konzept ist zum bekanntesten in der Arbeit mit sehr schwer und mehrfach beeinträchtigten Menschen im deutschsprachigen Raum geworden. Schon lange wird es angewandt, bei Menschen mit Behinderungen, bei schwer erkrankten Personen, in Schulen, im Hospiz, in der Frühförderung, bei der Sterbebegleitung.
Das erfolgreiche Standardwerk will eine Orientierung ermöglichen und Anregung geben. Es war an der Zeit, die jahrelangen Erfahrungen mit dem Konzept einzuarbeiten: Manches hat sich im Laufe der Zeit erübrigt, neue Fragen sind aufgetaucht, der globale Ansatz der Inklusion muss einbezogen werden. Im Kern folgt das Buch seinem bisherigen Ansatz, der durch die aktuellen neurowissenschaftlichen Forschungen Bestätigung gefunden hat. Das Werk kann sich genau auf diesen Kern konzentrieren, weil viele Neuerscheinungen junger KollegInnen unterschiedliche Teilaspekte basaler Arbeit bestens abdecken (vgl. die Reihe "Leben pur"). Neben Kindern und Jugendlichen finden auch verstärkt erwachsene Menschen mit schwerer Behinderung Berücksichtigung.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Basale Stimulation von Andreas Fröhlich im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Soziologie. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
SozialwissenschaftenThema
SoziologieFRAGEN DER SPEZIELLEN FÖRDERUNG
Die grundlegende Förderung von Menschen mit schwersten Behinderungen steht im Mittelpunkt unserer Überlegungen in diesem Buch. Es geht darum, für diese Menschen Wege zu finden, auf denen sie aus ihrer behinderungsbedingten Isolation heraus gelangen können. Die häufig fast radikalen Einschränkungen der eigenen Aktivität, der Kommunikation und der Selbstbestimmung sollen zumindest im Ansatz überwunden werden. Dazu bedarf es gewisser systematischer Vorgehensweisen, die den besonderen Bedürfnissen und Möglichkeiten von Menschen mit schwersten Behinderungen angepasst sind.
Basale Stimulation ist die „Markenbezeichnung“ für ein Konzept systematischer individueller Anregung, Versorgung und Pflege, das Lernen und persönliche Entwicklung unterstützen soll. Basale Stimulation könnte auch als die „Systematisierung des Selbstverständlichen und Naheliegenden“ beschrieben werden.
Die Grundgedanken
Frühfördereinrichtungen, Kindergärten und Schulen bedienen sich basaler Anregungsmöglichkeiten für sehr schwer und mehrfach behinderte Kinder. Auch in der Frührehabilitation, in der Akutpflege, Intensivmedizin, Geriatrie und Palliativpflege sowie in vielen anderen Pflegebereichen bewährt sich die Grundkonzeption der Basalen Stimulation (aktuelle Informationen finden Sie unter www. basale-stimulation.de).
Basale Stimulation ist das Konzept einer intensiven und ganzheitlichen Förderung schwer und schwerst beeinträchtigter Menschen. Das Konzept orientiert sich an humanen Grundprinzipien, d. h. an Lebenszusammenhängen, die als für alle Menschen gültig angenommen werden. Durch einfachste, gewissermaßen „voraussetzungslose“ sensorische Angebote versucht man, dem betreffenden Menschen zu helfen, sich selbst und den eigenen Körper zu entdecken. Durch den eigenen Körper werden erste Beziehungen zur sozialen und materialen Umwelt aufgenommen. Damit entsteht ein primärer Wechselwirkungsprozess zwischen „Ich“ und „Welt“. Basale Stimulation hilft, die verwirrende Überfülle für den Menschen mit schwerster Beeinträchtigung strukturierter, verstehbarer und weniger ängstigend werden zu lassen. Damit können erste Ansätze von Aktivität, Neugier und auch Spielverhalten entstehen.
Basale Stimulation und die von ihr abgeleiteten Anregungsformen sind von ihrem Selbstverständnis her keine „Behandlungs-Methoden“. Damit ist ausgedrückt, dass nicht alle Aktivität beim Therapeuten/Pädagogen liegt und der Patient passiv einer Behandlung ausgesetzt ist. Es handelt sich vielmehr um gemeinsame Aktivitäten, die allerdings zu Beginn auf Seiten des Menschen mit Einschränkungen oder schwerster Behinderung „Mikroaktivitäten“ sein können, Aktivitäten, die u. U. vom ungeschulten Beobachter kaum wahrgenommen werden können. Durch Basale Stimulation wird versucht, die gesamte Wahrnehmung des betreffenden Menschen anzuregen und zu orientieren. Der eigene Körper mit all seinen unterschiedlichen Bewegungs- und Wahrnehmungsmöglichkeiten, die Haut als Kontaktstelle zur Welt, die Empfindung der eigenen Position im Raum, das Aufnehmen von Informationen aus der Umgebung – all dies erfordert Aktivität und Wachheit.
Um die Kombination aus diesen Bereichen geht es im Wesentlichen, wenn Therapeuten, Pädagogen und Pflegende versuchen, Angebote zu machen. Die Beteiligung des Subjektes, d. h. des Menschen mit schwerster Behinderung, ist immer erforderlich und nur die Anteile Basaler Stimulation können wirkungsvoll sein, die dem aktuellen Bedürfnisniveau des Adressaten entsprechen. Dabei kommt es erfahrungsgemäß zu intensiven Wechselbeziehungen zwischen Therapeuten, Pädagogen, Pflegenden und dem Menschen mit schwerster Behinderung. Denn nur bei einer ausgeprägten Sensibilität des Therapeuten/Pädagogen ist es möglich, die feinen Aktionen und Reaktionen des eingeschränkten Partners zu erspüren und auf diese einzugehen. Andererseits zeigt es sich, dass oft auch feinste Signale von Menschen mit schwersten Behinderungen aufgenommen werden können, die dann die Situation unmittelbar beeinflussen.
Der zentrale Ausgangspunkt Basaler Stimulation liegt darin, dass wir versuchen wollen, einem Menschen mit schwerster Behinderung dabei zu helfen, den eigenen Körper, d. h. sein Ich und dessen Möglichkeiten, (neu) zu entdecken. Vielfältige sensorische und motorische, emotionale und kognitive Einschränkungen haben es zusammen mit den Bedingungen der Umwelt oft unmöglich gemacht, primäre Erfahrungen zu sammeln. Der eigene Körper, das eigene Ich, die emotionale Befindlichkeit, die kognitiven Möglichkeiten – auch wenn wir sie als sehr eingeschränkt sehen – konnten oft nicht erlebt werden; sie werden nicht benutzt und nicht genutzt. Die von der Beeinträchtigung nicht unmittelbar betroffenen Anteile verkümmern zusehends, der Mensch mit schwerster Behinderung gerät in eine immer tiefere Isolation und damit in eine existenzielle Einsamkeit. Da wir aber nur über unseren Körper und seine Möglichkeiten mit uns selbst und der Außenwelt in Kontakt treten können, ist es unabdingbar, eben diesen Körper und seine Möglichkeiten zu aktivieren, ihm angemessene Angebote zu machen.
Es sei an dieser Stelle mit Bezug auf Heiner Hastedt (1988) darauf hingewiesen, dass sich die konsequente Leib-Seele-, Leib-Geist-Trennung in der abendländischen Tradition verhängnisvoll auf die pädagogische und therapeutische Förderung von Menschen mit Behinderungen auswirkt. Wir sind als Körper auf dieser Welt, belebt von Geist und Seele – eine Einheit, die nicht auseinanderfallen kann, es sei denn im Tod. Gerade deshalb sind Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen ganze Menschen! (Die schon lange währende Hirntod-Diskussion im Zusammenhang mit Transplantationsfragen zeigt, dass man immer wieder in Versuchung geraten kann, Fakten aus bestimmten Interessen heraus „neu zu interpretieren“.)
Die starke Orientierung an sensorischer Wahrnehmung und Bewegung respektiert den Körper des Menschen mit schwerster Behinderung als die Realisation seines Ichs. Er wird so angenommen, wie er ist und insbesondere auch so, wie er im Laufe seiner Biographie geworden ist. Es werden keine Anforderungen an ihn gestellt, wie er sein sollte, sondern der Therapeut und Pädagoge lässt sich mit ihm aktuell ein, er tauscht sich mit ihm aus über Bewegung, über Spüren, über Nähe und gemeinsame Aktivität. Nur so können Möglichkeiten zur eigenen Weiterentwicklung entstehen. Nach unserer Einschätzung ist es nicht möglich, jemanden zu erziehen, ihn zu fördern in dem Sinne, dass der Pädagoge oder Therapeut bestimmte Aktivitäten vorgibt. Wir können lediglich Bedingungen schaffen, die es dem Ich ermöglichen, sich selbst weiterzuentwickeln.
Der Ausgangspunkt
Nach diesen grundsätzlichen Vorbemerkungen soll im Folgenden versucht werden, die einzelnen Schritte und Aspekte Basaler Stimulation näher zu beschreiben. Dabei ist allerdings in Erinnerung zu rufen, dass solche Beschreibungen notwendigerweise größere Zusammenhänge immer wieder außer Acht lassen, dass sie Zusammenhängendes auseinander reißen und in ihrer Beschreibung dem Anspruch der Ganzheitlichkeit kaum entsprechen können.
Wie dargestellt, hat das ungeborene Kind im Austausch mit der mütterlichen Umwelt bereits Fähigkeiten entwickelt, wahrzunehmen, auf Wahrgenommenes zu reagieren und selbst Wahrnehmungen in Gang zu setzen. Wir haben gezeigt, dass es sich hierbei insbesondere um somatische (den ganzen Körper einbeziehende) Eindrücke, vestibuläre(das frühentwickelte Lage- und Gleichgewichtssystem anregende) und vibratorische (auf Schwingungsempfinden hinzielende) Informationen handelt.
Diese drei Bereiche stellen für uns die Grundlage der Förderung von Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen dar. Wir können davon ausgehen, dass hier elementarste und früheste Erfahrungen vorhanden sind, an die man als Primärerfahrung anknüpfen kann. Es zeigt sich allerdings, dass gerade für die Kinder, die frühgeboren ihre erste nachgeburtliche Lebenszeit im Inkubator verbringen müssen, aber auch für andere Kinder, die nach dem Eintritt der Schädigung weitgehend immobil bleiben müssen, ein tiefes Wahrnehmungsvakuum entsteht.
Von der Konzeption an befindet sich das werdende Leben in einer andauernden Anregungssituation vestibulärer, somatischer und vibratorischer Art. Dies bietet ihm der mütterliche Körper. Die zwar medizinisch lebenserhaltende neue Situation bietet dem Kind aber nur ein Minimum an konstanter sensorischer Anregung, die häufig genug durch die radikale Einschränkung der Bewegungsmöglichkeit, durch Monotonie ihre Anregungskraft verliert. So ist festzustellen, dass nach der Geburt nicht nur ein „Beziehungsabbruch“, sondern eine massive und erschreckende Isolierung von allen bisher gewohnten und notwendigen sensorischen Informationen erfolgt. Dies kann nicht ohne psychoemotionale Auswirkung bleiben. Allerdings sind kinderpsychologische und psychiatrische Untersuchungen bei schwerster Behinderung noch außerordentlich selten. Gesicherte Aussagen liegen nicht vor, sodass wir im Wesentlichen auf Vermutungen angewiesen sind.
Vom methodischen Ansatz her soll die Anregung im vestibulären, somatischen und vibratorischen Bereich versuchen, an die ersten Erfahrungen anzuknüpfen, die vielleicht die letzten stabilen und vertrauten Erfahrungen waren, die dieser Mensch hatte.
An dieser Stelle soll noch einmal auf den notwendigen ganzheitlichen Aspekt verwiesen werden. Dies gilt sowohl für die Versuche, die Situation eines Menschen mit schwerster Behinderung zu verstehen, als auch für die Förderung selbst. Die einzelnen Bereiche der menschlichen Persönlichkeit können nicht hierarchisch, d. h. in Überordnung und Unterordnung sortiert werden, es gibt keinen Bereich, der wichtiger bzw. gewichtiger als ein anderer wäre.
Die „Gleichwirklichkeit“ dieser Bereiche ist zu berücksichtigen, d. h., emotionale Anteile sind ebenso wirklich, sie wirken ebenso wie körperliche. Gefühl ist also kein „Luxus“, sondern ein wesentlicher Bestandteil menschlichen Lebens. Die Gleichzeitigkeit dieser Elemente gilt es wahrzunehmen. Jede Situation, jede Aktivität, jede Wahrnehmung beinhaltet zur gleichen Zeit alle Aspekte; auch dies ist ein Zeichen dafür, dass es nicht vorrangige bzw. nachrangige Anteile gibt.
Aus diesen Überlegungen resultiert eine besondere „Sorgfaltspflicht“ in der Planung des eigenen pädagogisch-therapeutischen Vorgehens. Es entsteht eine unmittelbare Verantwortung für alle Bereiche der menschlichen Persönlichkeit, der Rückzug auf den eigenen professionellen Zugriff wird fragwürdig. Die Zerlegung der menschlichen Persönlichkeit in berufstypische Anteile kann nicht akzeptiert werden. Dabei bleibt natürlich eine spezifische berufliche Kompetenz wünschenswert und für die praktische Arbeit auch erforderlich.
Grundlegung der Wahrnehmungsorganisation
Ausgehend von den vorangegangenen Überlegungen soll nun versucht werden, die praktische Förderung darzustellen. Dabei gehen wir in einer Systematik vor, die sich als „entwicklungsanalog“ beschreiben lässt. Die Darstellung bedingt ein Nacheinander, das aber die Leser nicht dazu verleiten sollte, exakt dieses Nacheinander in der Praxis zu suchen oder anzuwenden. Häufig werden parallel Angebote gemacht werden müssen. Dies ist aber in einer schriftlichen Darstellung nicht möglich.
Vestibuläre, somatische und vibratorische Informationsaufnahme wurde bereits mehrfach als die Grundlage aller menschlichen Wahrnehmungsprozesse beschrieben. Ihr Vorhandensein darf auch bei sehr schwer behinderten Menschen vorausgesetzt werden. Dieses Vorhandensein bedeutet allerdings nicht, dass alle Angebote in diesen Bereichen positiv akzeptiert werden. Aber auch eine Abwehr, z. B. einer Berührung, ist ein Zeichen dafür, dass diese Berührung überhaupt wahrgenommen wurde, ja, dass sie eine Bedeutung für das Kind angenommen hat. Im Fall einer Abwehr ist es vielleicht die Bedeutung einer Bedrohung.
Vestibuläre Anregung
Mit dieser Anregungsform knüpfen wir an frühe vertraute Bewegungserfahrung an. Raumlageveränderungen, rhythmisches Schwingen, Auf- und Abbewegungen sowie Drehungen gehören in diesen Bereich. Durch die sensorische Integrationstherapie (Ayres) hat sich vestibuläre Anregung in vielerlei Form durchgesetzt. Hierbei fallen vor allem Drehanregungen ins Auge, die allerdings auch von Vertretern der sensorischen Integrationstherapie immer kritisch betrachtet wurden. Für alle folgenden Beschreibungen, die speziell für Kinder mit schwersten Behinderungen entwickelt wurden, und die gewisse Analogien zur sensorischen Integrationstherapie haben, aber doch eigenständig sind, gilt: Eine Überstimulierung ist dringend zu vermeiden!
Sanfte Schaukelbewegungen um die Körperlängsachse scheinen am gewohntesten und einfachsten für Kinder zu sein. In der Regel wird man für eine angemessene Rückenlage sorgen, d. h. eine ausgestreckte Position, wenn dies ohne Überstreckung möglich ist. Eine Rückenlage mit gebeugter Hüfte und gebeugten Knien ist ebenfalls sinnvoll. Wie bei den meisten vestibulären Angeboten werden einfache Hilfsmittel benötigt. Die Position auf einem großen Schaukelbrett ist in diesem Fall nicht sehr günstig, weil der Drehpunkt sehr weit oben liegt und somit wenig Stabilitätsgefühl aufkommt. Vielmehr ist eine Tonne für diese Art von Bewegung am günstigsten, seitlicher Halt und ein maximal tiefer Schwerpunkt geben das notwendige Gefühl von Sicherheit und Stabilität in der Bewegung.
Diese Bewegungsrichtung kann intensiviert werden, indem man eine Stoffhängematte an den langen Seilen in den Ringen (Turnhalle) befestigt. Allerdings müssen dafür zwei Paare von Ringen zur Verfügung stehen, da man jeweils die am weitesten auseinanderliegenden als Anknüpfungspunkte für die Hängematte benötigt. In diese Hängematte kann man nun jemand legen und kommt so zu ruhigen, weiten Schwingbewegungen, die eine beruhigende, aber doch die Wachheit unterstützende Wirkung zu haben scheinen.
Es ist empfehlenswert, zunächst zusammen mit dem Kind in die Hängematte zu gehen, um ihm Sicherheit, Nähe und Halt anbieten zu können. Es zeigt sich, dass Menschen...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Basale Stimulation – Das Konzept
- Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen
- Grundbedürfnisse in der kindlichen Entwicklung und ihre sinnvolle Befriedigung
- Die Familie des schwerstbehinderten Kindes
- Kommunikative Fähigkeiten
- Die notwendige Grundversorgung
- Trinken und Essen
- Fragen der speziellen Förderung
- Der Somatische Dialog
- Pädagogik und Schmerzbegleitung
- Basale Therapie
- Erwachsen-Werden, Erwachsen-Sein mit schweren und mehrfachen Beeinträchtigungen
- Die Vielfalt der Förderung, die Vielfalt der Menschen und Orte
- Am Ende mein Dank
- Literatur
- Register
- Buchvorstellungen
- Über den bvkm
- Kurzbeschreibung des Buches
- Fußnote