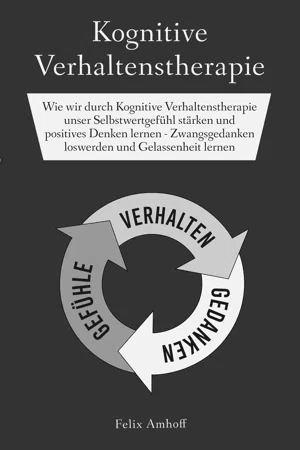
eBook - ePub
Kognitive Verhaltenstherapie
Wie wir durch Kognitive Verhaltenstherapie unser Selbstwertgefühl stärken und positives Denken lernen - Zwangsgedanken loswerden und Gelassenheit lernen
- 147 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Kognitive Verhaltenstherapie
Wie wir durch Kognitive Verhaltenstherapie unser Selbstwertgefühl stärken und positives Denken lernen - Zwangsgedanken loswerden und Gelassenheit lernen
Über dieses Buch
Gefühle - Gedanken - Verhalten: Ein manchmal teuflischer Kreislauf, in dem sich viele Menschen befinden und oftmals keinen Ausweg sehen.Der Betroffene soll erkennen, wie er sich durch seine Zwangsgedanken, seine Gefühle oder durch das Katastrophisieren von Situationen selbst im Weg steht und sein Leben durch negative Glaubenssätze nicht in der Form lebt, wie er es eigentlich möchte und könnte.Diese Gedankenmuster und diese Abwärtsspirale zu durchbrechen und das Leben aus eigener Kraft positiv und gelassen zu gestalten, ist eines der Ziele der Kognitiven Verhaltenstherapie. Neben negativen Gedankenspiralen im Alltag können jedoch auch andere Probleme wie beispielsweise Angststörungen im Mittelpunkt einer Kognitiven Verhaltenstherapie stehen.Dieses Buch lehrt Sie die Grundkenntnisse sowie verschiedene konkrete Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie. Von historischen Hintergründen über konkrete Anwendungsfälle bis hin zur Vorstellung verschiedener Techniken (Schematherapie, Rational-Emotive-Verhaltenstherapie, Problemlösetraining und mehr) führt Sie dieses Buch schrittweise und leicht verständlich durch den Prozess der Kognitiven Verhaltenstherapie, sodass Sie am Ende in der Lage sind zu beurteilen, ob ein derartiger Ansatz erfolgversprechend sein kann oder nicht.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Kognitive Verhaltenstherapie von Felix Amhoff im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychology & Cognitive Psychology & Cognition. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Psychotherapeutische Techniken und Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie
Auf der Basis der Grundideen und Prinzipien der modernen Kognitiven Verhaltenstherapie wurden seit deren Begründung in den 1960er Jahren verschiedenste psychotherapeutische Methoden und Techniken entwickelt und in die verhaltenstherapeutische Praxis integriert, um der ebenfalls stetig wachsenden Anzahl der behandlungsbedürftigen psychisch/emotionalen Störungen und (psychosomatisch bedingten) körperlichen Erkrankungen mit all ihren individuellen Ausprägungen gerecht zu werden. Je nach der Art und Qualität der jeweiligen Problematik können die verschiedenen Techniken und Verfahren im Rahmen einer verhaltenstherapeutischen Behandlung entweder einzeln oder in Kombination angewendet werden. In diesem Zusammenhang ist die Kognitive Verhaltenstherapie als eine Art Grundmodell im Sinne eines Baukastenprinzips zu verstehen, die - entsprechend ihrem multimodalen Behandlungsansatz - aus verschiedenen Modulen besteht. Aus diesen zur Verfügung stehenden Modulen werden vor jeder Behandlung von Therapeut und Patient gemeinsam die jeweils passenden und erfolgverprechendsten ausgewählt und individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst und kombiniert.
Im Folgenden soll auf einige der gängigsten und meistverwendeten Techniken und Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie konkreter eingegangen werden.
Schematherapie
Die Schematherapie ist eine Form der Psychotherapie und wurde in den 1990er Jahren vom US-amerikanischen Psychologen und Psychotherapeuten Jeffrey E. Young begründet. Sie wird zur sogenannten „Dritten Welle“ in der Entwicklung der Kognitiven Verhaltenstherapie gezählt und ergänzte deren methodisches Repertoire um zahlreiche Elemente der psychodynamischen Konzepte sowie anderer etablierter psychologischer Theorien und Therapieverfahren, darunter die Objektbeziehungstheorie, Hypnotherapie, Gestalttherapie und die Transaktionsanalyse. Im Vergleich zu den anderen kognitiv-verhaltenstherapeutischen Verfahren rückt die Schematherapie erlebnis- und handlungsorientierte Vorgehensweisen und Aspekte noch stärker in den Vordergrund sowie auch die bewusste Gestaltung der persönlichen Beziehung zwischen Therapeut und Patient. Die Schematherapie wurde konzipiert zur Behandlung chronischer und charakterologischer Aspekte und Symptome psychischer Störungen und wird heute primär zur Therapie chronischer (seelischer) Erkrankungen eingesetzt, darunter chronische Depressionen, lang anhaltende Angst- und Panikstörungen, Persönlichkeitsstörungen (insbesondere Borderline und narzisstische Persönlichkeitsstörungen), Essstörungen und Suchterkrankungen sowie auch bei Paarbehandlungen oder langjährigen Beziehungs- oder Bindungsstörungen.
Die Schematherapie wird also vor allem zur Behandlung von stark ausgeprägten und lang anhaltenden oder chronischen Störungen angewendet, die sich auf Charaktereigenschaften bzw. auf die Persönlichkeit oder deren Entwicklung beziehen.
Die besonders gute therapeutische Wirksamkeit und Effektivität der Schematherapie, auch langfristig nach Abschluss der Therapie, wurde anhand zahlreicher Untersuchungen nachgewiesen; damit gilt sie als eines der erfolgreichsten und nachhaltigsten psychotherapeutischen Verfahren überhaupt. Schematherapeutische Behandlungen werden sowohl im Rahmen ambulanter Psychotherapien als auch während stationärer Aufenthalte in (psychiatrischen oder psychosomatischen) Kliniken angewendet.
Die Schematherapie basiert auf einer Vielzahl verschiedener psychologischer Konzepte und psychotherapeutischer Ansätze, darunter:
- Kognitive Therapie
- Stressverarbeitung
- Verhaltenstherapie
- Gestalttherapie
- Bindungstheorie
- Abwehrmechanismen (Psychoanalyse)
- Transaktionsanalyse (vom US-amerikanischen Psychiater Eric Berne begründet)
- Individualpsychologie
- Klientenzentrierte Psychotherapie
Das meistverbreitete und populärste Konzept der Schematherapie ist vom Schweizer Biologen und Entwicklungspsychologen Jean Piaget entworfen worden, dessen konstruktivistische Erkenntnistheorie ebenfalls auf diesem Schemakonzept basiert (schème d’assimilation). Der theoretische und konzeptionelle Ursprung der modernen Schematherapie ist in der von Aaron T. Beck entwickelten "Kognitiven Therapie für Persönlichkeitsstörungen" zu finden. Die Grundannahme der Schematherapie besteht darin, dass jeder Mensch über bestimmte erlernte Grundschemata verfügt, die hauptsächlich dazu dienen, seine seelischen Grundbedürfnisse zu befriedigen und sein Verhalten in den jeweiligen konkreten Situationen entsprechend zu steuern, um dieses Ziel zu erreichen. Diese Grundschemata können sich sowohl auf den Betroffenen selbst (Selbstschemata) als auch auf seine Beziehungen zu anderen Menschen (Beziehungsschemata) beziehen. Sie werden im Laufe der Kindheit, Jugend und des weiteren Lebens erworben und enthalten eine Vielzahl weitgesteckter Muster bestehend aus Emotionen, Erinnerungen, Kognitionen und Körperempfindungen. In jedem Falle wirken sich Schemata und die daraus resultierenden Verhaltensweisen ungünstig auf das Leben des Betroffenen aus; noch problematischer wird es dann, wenn diese mit der "eigentlichen" Persönlichkeit eines Menschen unvereinbar sind und dieser gerne anders fühlen, denken, oder sich verhalten würde, als er es tatsächlich tut. Derartige problematische Schemata bzw. die mit ihnen einhergehenden Emotionen, Kognitionen etc. können der Persönlichkeit bzw. deren Entwicklung im Extremfall sogar so konträr entgegenstehen oder ihr hinderlich sein (also ich-dyston sein = nicht zum Ich gehörend), dass es zu schwersten inneren Persönlichkeitskonflikten bis hin zu Persönlichkeitsstörungen kommen kann. Häufig steckt der Betroffene jedoch fest in einer scheinbar endlosen Spirale aus vertrauten und routinierten Verhaltensweisen, mitunter sogar kurzfristigen Erfolgen und dafür aber langfristigen Misserfolgen, aus der er ohne verhaltenstherapeutische Hilfe kaum entkommen kann.
Der in der Schematherapie verwendete Schemabegriff muss jedoch abgegrenzt werden vom tiefenpsychologischen Begriff des "Konfliktschemas". „Konfliktschema“ ist in der Psychodynamischen Psychotherapie beheimatet, bei welcher im Gegensatz zum stabilen innerpsychischen Schema der Schematherapie kein stabiles inneres Konfliktmuster vorliegt, wie es typischerweise bei sogenannten strukturellen Störungen vorliegt.
Jeffrey Young bezeichnet diese in der Kindheit oder in jungen Jahren erworbenen hinderlichen und problematischen Schemata als "frühe maladaptive Schemata" (Early Maladaptive Schemas).
Bei einem frühen maladaptiven Schema handelt es sich demnach um:
- ein umfassendes weitgestecktes Muster oder Thema
- welches aus Kognitionen, Emotionen, Erinnerungen und Körperempfindungen besteht
- die sich sowohl auf die eigene Person als auch auf die Mitmenschen und zwischenmenschliche Kontakte beziehen
- ein bestimmtes Muster, das im Laufe der Kindheit und/oder Jugend entstanden ist
- welches im weiteren Verlauf des Lebens noch stärker ausgeprägt wurde und sich dabei zunehmend verfestigt hat
- und das stark dysfunktional ist und zu intrapsychischen Konflikten führt.
Weiterhin beschreibt Jeffrey Young insgesamt 18 maladaptive Schemata, die grob in fünf Gruppen ungterteilt werden können:
- Abgetrenntheit und Ablehnung: Hierzu zählen die Schemata "Verlassenheit/Instabilität", "Misstrauen, Missbrauch oder Misshandlung", "emotionale Entbehrung", "Unzulänglichkeit und Scham" sowie "soziale Isolierung und Entfremdung"
- Beeinträchtigung von Autonomie und Leistung: Dazu gehören die Schemata "Abhängigkeit/Inkompetenz", "Anfälligkeit für Verletzungen oder Krankheiten", "unterentwickeltes Selbst/Verstrickung" sowie "Versagen"
- Beeinträchtigung beim Umgang mit Begrenzungen: Zu diesem Bereich zählen die Schemata "Anspruchshaltung und Grandiosität" sowie "unzureichende Selbstkontrolle"
- Fremdbezogenheit und Angepasstheit: Hierbei handelt es sich um die Schemata "Unterwerfung", "Selbstaufopferung" sowie "Streben nach Zustimmung und Anerkennung"
- Übertriebene Wachsamkeit und Gehemmtheit: Dieser Bereich umfasst die Schemata "Negativität und Pessimismus", "emotionale Gehemmtheit", "übertriebene Standards und übertrieben kritische Haltung" sowie "Bestrafungsneigung"
Aus solchen dysfunktionalen Schemata resultieren früher oder später problematische und konfliktverursachende oder -verstärkende Verhaltensweisen, die jedoch als Folgen bzw. Reaktionen auf ein Schema zu verstehen sind, nicht etwa als ein Teil dessen.
Viele Schemata werden bereits in der frühen Kindheit erlernt und dienen, wie bereits erläutert, vor allem dazu, die wichtigsten seelischen und emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen bzw. durch andere Menschen befriedigen zu lassen wie etwa das (kindliche) Bedürfnis nach sicheren Bindungen, zugewandten und verlässlichen Bezugspersonen, das Bedürfnis nach einem harmonischen und stabilen Elternhaus, nach zufriedenstellenden zwischenmenschlichen Beziehungen und Freundschaften, später auch nach Liebesbeziehungen sowie die Bedürfnisse nach Autonomie, Kontrolle, Kompetenz und Unabhängigkeit, Spontanität und Spiel, oder auch nach Anerkennung und dem Gefühl, akzeptiert und gemocht zu werden und seine Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken zu können bzw. zu dürfen. Hierbei handelt es sich um menschliche Grundbedürfnisse, nach deren Befriedigung jeder Mensch (bewusst oder unbewusst) strebt. Um dies (nicht nur in der Kindheit, sondern auch im weiteren Verlauf des Lebens) zu erreichen, entwickelt jeder Mensch bestimmte Verhaltensweisen, die er fortan mehr oder weniger konsequent und routiniert einsetzt. Wurden diese seelischen und emotionalen (teilweise auch körperlichen) Grundbedürfnisse in der frühen Kindheit nur unzureichend oder gar nicht befriedigt, entstehen zumeist ungünstige Schemata (frühe maladaptive Schemata), die sich auf lange Sicht gesehen negativ auf das Leben des Betroffenen und dessen Beziehungen zu anderen Menschen auswirken können. Typisch für solch erlernte ungünstige Schemata ist auch, dass sie zumeist sehr starr und unflexibel sind und die damit einhergehenden Verhaltensweisen entsprechend kaum an die jeweiligen konkreten Situationen angepasst werden. Somit besteht die Gefahr, dass der Betroffene immer wieder "über das Ziel hinausschießt", was aber in der Regel sozial nicht erwünscht ist und zudem stagniert er innerlich, entwickelt sich seelisch und emotional nicht weiter und steckt schließlich (bei fehlender psychotherapeutischer Behandlung) sein gesamtes Erwachsenenleben hindurch immer in der Rolle des "inneren Kindes" fest, welches auf der Suche nach der Befriedigung seiner kindlichen Bedürfnisse ist und keine Verantwortung für sich selbst übernehmen kann. Ferner sind seine durch einschneidende und traumatische Erfahrungen und Erlebnisse entstandenen Schemata dem Betroffenen so vertraut und die entsprechenden Verhaltensmuster so routiniert, dass sie sich für ihn subjektiv "richtig" und alternativlos anfühlen und er diese deshalb gar nicht erst in Frage stellt, geschweige denn sie von sich aus zu ändern versucht. Eine psychotherapeutische Intervention ist in einem solchen Fall fast immer ratsam, was aber vom Betroffenen selbst auch erst einmal erkannt werden muss.
Da sich die meisten Betroffenen dieses Dilemmas aber nicht bewusst sind, es leugnen, verdrängen, nicht hinterfragen oder nicht wahrhaben wollen und sich zudem nicht in psychotherapeutische Behandlung begeben, werden trotz ihrer offensichtlichen und langfristigen Nachteile und Schwierigkeiten die jeweiligen Schemata im weiteren Verlauf des Lebens konsequent aufrechterhalten, weil die daraus folgenden Bewältigungsstrategien nicht immer nur Nachteile mit sich bringen, sondern häufig auch kurzfristige Vorteile, etwa im Sinne einer schnellen, wenn auch nicht nachhaltigen Bedürfnisbefriedigung.
Die aus den dysfunktionalen und meist unbewussten Schemata resultierenden Verhaltensmuster stehen außerdem im intrapsychischen Konflikt mit der eigenen "gewünschten" Persönlichkeit und/oder führen zu sozialen Problemen, Schwierigkeiten mit anderen Menschen, in der Partnerschaft (bzw. überhaupt einen Partner zu finden) oder im Berufsleben, da es sich dabei in der Regel um Schemata handelt, die mit den gesellschaftlichen Normen kollidieren oder in sonstiger Weise sozial oder persönlich für andere Menschen inakzeptabel sind. Dysfunktionale Schemata hindern den Betroffenen also an einer befriedigenden Lebensgestaltung bzw. am Erreichen seiner erklärten Lebensziele und beeinträchtigen darüber hinaus seine zwischenmenschlichen Beziehungen.
Das konkrete Ziel einer Schematherapie besteht nun darin, in einem ersten Schritt solche ungünstigen Erlebens- und Verhaltensmuster, die im Laufe des Lebens entstanden sind und sich verselbständigt haben, als solche zu erkennen und dem Patienten zugänglich bzw. bewusst zu machen. Dabei sollte der Therapeut anerkennen, dass das bislang praktizierte Verhaltensmuster des Patienten für diesen die einzige (oft verzweifelte oder vermeintlich alternativlose) Möglichkeit war, seine Bedürfnisse zu befriedigen oder sich seinen Mitmenschen mitzuteilen.
Der Patient erarbeitet, gemeinsam mit dem Therapeuten, rückblickend diejenigen Situationen seines Lebens, in denen er sehr starke negative Gefühle (Enttäuschung, Angst, Eifersucht, Scham, Schuldgefühle, Neid, Verlassenheitsgefühle, Einsamkeit etc.) empfunden hat. Denn auch, wenn es sich innerhalb der jeweiligen Situationen für den Patienten meist so anfühlt, so sind es doch in der Regel nicht die Situationen selbst, die seine starken negativen Gefühle auslösen, sondern vielmehr vorangegangene (Kindheits-)Erfahrungen, infolge derer die entsprechenden dysfunktionalen Schemata aktiviert wurden und die dann auch im weiteren Verlauf des Lebens immer in den entsprechenden Situationen ebendiese negativen Gefühlsassoziationen hervorrufen.
So kann ein Patient etwa die für ihn prägende und traumatische Erfahrung gemacht haben, dass seine Eltern ihn als Kind emotional vernachlässigten und sich ihm gegenüber abweisend und desinteressiert verhielten und somit sein Grundbedürfnis nach Nähe, Zuwendung und Anerkennung nicht befriedigt wurde. Aus diesem Grunde bemühte er sich stets, Aufgaben möglichst gut zu erfüllen und sich immer den Wünschen und Vorstellungen seiner Eltern entsprechend zu verhalten, um von diesen die ersehnte Anerkennung und Zuneigung zu bekommen. Da er als Kind oder Jugendlicher mit diesem Verhaltensmuster mehr oder weniger erfolgreich war und er damit sein Ziel, nämlich die Befriedigung seiner emotionalen Grundbedürfnisse, immer wieder kurzfristig erreichen konnte, verfestigt sich im weiteren Verlauf seines Lebens dieses Verhaltensmuster, alles möglichst gut machen zu müssen und sich immer und überall angepasst und gefällig zu verhalten, um Zuneigung und Anerkennung zu erhalten. Es liegt auf der Hand, dass ein derartiges Verhaltensmuster für den Patienten auf Dauer eher kontraproduktiv ist bzw. sogar massiv sein Selbstwertgefühl und seine seelische Gesundheit beeinträchtigen kann und er sich früher oder später von seinem starken Wunsch nach Anerkennung und Gefallenwollen lösen muss.
Ähnlich (allerdings ins gegenteilige Extrem verlaufend) verhält es sich bei einem Menschen, dessen Grundbedürfnis nach Autonomie und/oder Kontrolle in seiner Kindheit nicht hinreichend erfüllt wurde, indem er zuviel elterliche Fürsorge erhielt, ihm alle Aufgaben abgenomme...
Inhaltsverzeichnis
- Das erwartet Sie in diesem Buch
- Was ist Verhaltenstherapie?
- Was ist Kognitive Verhaltenstherapie?
- Geschichte und Entwicklung der Kognitiven Verhaltenstherapie
- Wann kommt eine Kognitive Verhaltenstherapie zum Einsatz?
- Wie läuft eine Kognitive Verhaltenstherapie ab?
- Psychotherapeutische Techniken und Methoden der Kognitiven Verhaltenstherapie
- Kritik an der Kognitiven Verhaltenstherapie