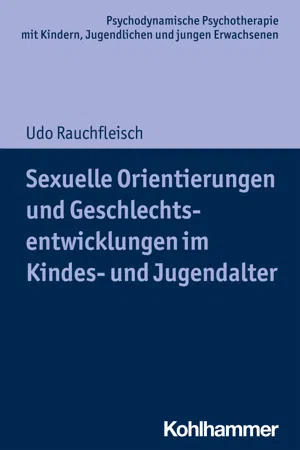
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Sexuelle Orientierungen und Geschlechtsentwicklungen im Kindes- und Jugendalter
- 166 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Verfügbar bis 5 Dec |Weitere Informationen
Sexuelle Orientierungen und Geschlechtsentwicklungen im Kindes- und Jugendalter
Über dieses Buch
Die geschlechtliche Entwicklung spielt in medizinischen, psychologischen und pädagogischen Konzepten zwar eine zentrale Rolle, meist wird aber nur die heterosexuelle cis Identität berücksichtigt. Gleichgeschlechtliche Orientierungen und Transgeschlechtlichkeit bleiben hingegen unerwähnt. Anhand vieler Kasuistiken zeigt der Autor, wie wichtig es im Umgang mit lesbischen, schwulen, bisexuellen sowie trans Kindern und Jugendlichen ist, die spezifischen Bedingungen, unter denen diese in unserer cis heteronormativen Gesellschaft aufwachsen, in Familie, Schule und Psychotherapie zu berücksichtigen, um sie beim Aufbau einer stabilen Selbstidentität unterstützen zu können.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Sexuelle Orientierungen und Geschlechtsentwicklungen im Kindes- und Jugendalter von Udo Rauchfleisch, Arne Burchartz, Hans Hopf, Christiane Lutz, Arne Burchartz,Hans Hopf,Christiane Lutz im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Psychology & Psychotherapy. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
1 Wie entstehen die sexuellen Orientierungen und die Geschlechtlichkeiten?
1.1 Die Ausgangslage
Die Fragen nach dem »Wie« und »Warum« sind Fragen, die bei den verschiedensten Themen nicht nur den wissenschaftlichen Diskurs prägen, sondern die auch in privaten Gesprächen und in den Medien immer wieder auftauchen. Interessant – und für das Thema dieses Buches wichtig – ist dabei, dass diese Fragen im Allgemeinen nur bei den Themen gestellt werden, die ungewöhnlich oder fremdartig erscheinen. Bei Themen und Phänomenen hingegen, die als »selbstverständlich« betrachtet werden, tauchen Fragen nach dem »Wie« und »Warum« praktisch nicht auf.
Im Hinblick auf die Geschlechtsentwicklung und die sexuellen Orientierungen bedeutet dies, dass die Entwicklung der Cisgeschlechtlichkeit, d. h. der Nicht-Transgeschlechtlichkeit (s. u.), und der Heterosexualitäten im Allgemeinen auch im wissenschaftlichen Bereich nicht diskutiert werden. Sie werden in unserer von der Cis- und der Heteronormativität geprägten Gesellschaft als »normal« und »selbstverständlich« betrachtet, und es finden sich dazu auch keine Forschungsbefunde. Hingegen sind die davon abweichenden Entwicklungen wie die Transgeschlechtlichkeit und die Homo- und Bisexualitäten Gegenstand vieler Untersuchungen und werden zum Teil sehr kontrovers diskutiert.
Gerade im Umgang mit Kindern und Jugendlichen liegt es nahe, sich Gedanken über die Entwicklung dieser Phänomene zu machen. In diesem Fall müssen wir jedoch das ganze Spektrum ins Auge fassen, d. h. wir müssen die Cis- ebenso wie die Transgeschlechtlichkeiten und die Homo- und Bisexualitäten ebenso wie die Heterosexualitäten berücksichtigen.
An diesem Punkt der Diskussion sehen wir uns unverhofft mit einem Problem konfrontiert: Wie erwähnt, sind zwar verschiedene Theorien und Hypothesen zur Entwicklung der Transgeschlechtlichkeit und der Homo- und Bisexualitäten entwickelt worden. Die Fragen nach dem »Wie« und »Warum« der Cisgeschlechtlichkeit und der Heterosexualitäten sind jedoch ein weißer Fleck auf der wissenschaftlichen Landkarte. Es ist deshalb notwendig, aus den uns vorliegenden Hypothesen aus verschiedenen Wissenschaftszweigen die wichtigsten und am plausibelsten erscheinenden Aspekte herauszudestillieren und auf dieser Grundlage ein mehr oder weniger konsistentes Konzept zu formulieren.
Mit dieser vorsichtigen Formulierung möchte ich darauf hinweisen, dass uns über die Entwicklung der Geschlechtlichkeit und der sexuellen Orientierungen keine wirklich verlässlichen, evidenzbasierten Befunde vorliegen. Wir bewegen uns hier lediglich auf dem Terrain von Hypothesen. Ich beziehe mich im Folgenden unter anderem auf die Konzepte von Stoller (1968), Reiche (1997), Mertens (1992) und Ermann (2019) sowie auf verschiedene eigene Publikationen (2011, 2016, 2019a, 2019b).
1.2 Zur verwendeten Terminologie
An dieser Stelle sei noch auf einige terminologische Probleme hingewiesen. In der Fachliteratur ebenso in den Stellungnahmen der LGBTIQ*-Community2 werden unterschiedliche Begriffe mit je spezifischem Bedeutungsgehalt verwendet und – mitunter vehement – abgelehnt oder verteidigt. Dies gilt beispielsweise für den Identitätsbegriff.
Es ist den Kritiker*innen zuzustimmen, die bemängeln, dass der Identitätsbegriff mit sehr unterschiedlichen Bedeutungen verwendet wird. So weichen die Identitätskonzepte, wie sie in der Philosophie, in der Mathematik, im rechtlichen Kontext und in der Psychologie (als Ich-Identität) verwendet werden, erheblich voneinander ab (Benedetti & Wiesmann, 1986). Zudem ist die Identität auch im psychologischen Bereich keine klar umrissene Persönlichkeitseigenschaft, zumal sie von verschiedenen Autor*innen unterschiedlich definiert wird. Sie weist vielmehr einen prozesshaften Charakter auf und kann aus diesem Grund weniger eindeutig beschrieben werden.
Eine Konsequenz dieser zum Teil erheblich voneinander abweichenden Bedeutungen des Identitätsbegriffs ist, dass die interdisziplinäre Kommunikation darunter leidet. Ein aktuelles politisches Beispiel ist der – bedauerliche – Entscheid des Schweizer Bundesrats (aus dem Jahr 2019), Menschen mit Transgeschlechtlichkeit nicht in das neue Antidiskriminierungsgesetz aufzunehmen, da es bei ihnen um die Identität gehe, die aber nicht eindeutig definierbar sei.
Im Vorwort der Publikation einer interdisziplinären Ringvorlesung an der Universität Basel zum Thema Identität unterscheidet Benedetti (1986, S. 7) bei der Ich-Identität eine vertikale und eine horizontale Linie.
»Auf der vertikalen Linie findet Ich-Identität als Integration von entwicklungsbedingten Ich-Zuständen statt, die im unbewussten und bewussten Gefühl des Selbst, des Person-Seins verdichtet werden und manchmal in herausfordernden lebensgeschichtlichen Momenten in die helle Erkenntnis münden: ›Das bin ich!’ ›Das will ich sein!’«
Auf der horizontalen Linie der Ich-Identität werden »verschiedene, auch gleichzeitige soziale Rollen im einheitlichen Selbstgefühl und im Bild, das die Sozietät von uns entwirft, integriert. Diese horizontale Linie verbürgt die Befriedigung der Ansprüche verschiedener Rollen, in denen die Person sich erfüllt« (Benedetti, 1986, S. 7).
Einen wesentlichen Beitrag in der psychologischen Auseinandersetzung mit der Ich-Identität hat Erikson (1966) geleistet. Für Erikson bedeutet die sich in Stufen lebenslang entwickelnde Ich-Identität, sich einem Kollektiv zugehörig zu fühlen und sich dabei zugleich als einmaliges Individuum zu wissen. Es ist das, was Kohut (1973) als »Selbst« bezeichnet hat, als Kern unserer Persönlichkeit, der durch die Interaktion zwischen Eltern und Kind geformt wird. In einem ähnlichen Sinne spricht Mead (1968) davon, dass die Bildung der Identität von den sozialen Interaktionen über Sprache und andere Mittel der Kommunikation abhängt.
Wie diese Umschreibungen der Ich-Identität zeigen, besteht trotz etlicher Divergenzen zwischen den verschiedenen Sichtweisen der Autor*innen insofern doch Einigkeit, dass die von Benedetti (1986) beschriebene vertikale (psychologische) und die horizontale (soziale) Dimension in enger Wechselwirkung miteinander stehen. Die eine ist ohne die andere nicht denkbar.
Das Resultat dieser Interaktion ist die Ich-Identität, in der sich die verschiedenen Facetten der Persönlichkeit zu einer Ganzheit zusammenfügen und dem Individuum trotz aller Veränderungen im Verlauf des Lebens das Gefühl der Kohärenz und Konsistenz in Bezug auf die eigene Person vermitteln. Bei der Entstehung der Ich-Identität ist die erwähnte Wechselwirkung zwischen dem Individuum und seinen Bezugspersonen von zentraler Bedeutung. Es ist das dialogische Prinzip, das der jüdische Religionsphilosoph Martin Buber (1936) mit dem Hinweis umschrieben hat, dass wir am Du zum Ich werden.
Kritik am Identitätsbegriff ist von verschiedenen Seiten formuliert worden. Es sind vor allem Autor*innen, die eine somatische Ätiologie der Entwicklung von cis, trans und anderen Formen der Geschlechtlichkeit postulieren. Nach ihrer Ansicht ist der Begriff »Identität« zu schwammig, ihm fehle die Evidenzbasierung, und er ist ihnen zu stark mit Pathologiekonzepten assoziiert. Zu dieser negativen Konnotation hat wesentlich die ICD-Formulierung »Störungen der Geschlechtsidentität« mit der darunter subsumierten Diagnose »Transsexualismus« beigetragen. Kritische Äußerungen dieser Art kommen zum Teil auch aus der LGBTIQ*-Community.
Aus diesem Grund ist der Transsexualismus aus neurowissenschaftlicher Perspektive als eine Form hirngeschlechtlicher Intersexualität, als »neurointersexuelle Körperdiskrepanz« (Diamond, 2006, 2016; Haupt, 2016), beschrieben worden. In einer neueren Arbeit hat Haupt (2019) diese Auffassung weiter differenziert und sich von der Bezeichnung der Neurointersexualität distanziert. Die Autorin verwendet nun den allgemeineren Begriff der »Geschlechtsentwicklung«, wobei sie vier Varianten unterscheidet:
• (überwiegend) männliche Varianten (frühere Begriffe: Transmänner, Frau-zu-Mann, transsexuelle Männer, männliche Transgender usw.),
• (überwiegend) weibliche Varianten (frühere Begriffe: Transfrauen, Mann-zu-Frau, transsexuelle Frauen, weibliche Transgender usw.),
• alternierende Varianten (frühere Begriffe: Bigender, Gender fluid, partiell Cross Dresser usw.),
• gemischt-manifeste Varianten (Früherer Begriff: non binär).
Mit diesem Konzept möchte die Autorin die bisher weit verbreiteten Pathologiekonzepte vermeiden und an die für die Betreffenden selbst relevante subjektive Phänomenologie anknüpfen. Der Vorteil des Begriffs der »Geschlechtsentwicklung« ist, dass er sich außerhalb der Pathologiekonzepte bewegt.
Bei der Arbeit an diesem Buch war ich zur Überzeugung gekommen, es sei günstig, diesen vorurteilsfreien Begriff der »Varianten der Geschlechtsentwicklung« zu übernehmen. Nach reiflicher Überlegung habe ich mich nun aber doch entschlossen, diesen Begriff nicht zu verwenden, da er schon für ein anderes Phänomen, nämlich für Menschen mit Intergeschlechtlichkeit, vergeben ist (Deutsche Gesellschaft für Urologie, 2016). Ihn hier in einem anderen Sinne zu verwenden, würde unweigerlich zu Konfusionen geführt haben.
Auf der Suche nach einem anderen Begriff, der möglichst vorurteilsfrei ist und sowohl die körperliche als auch die psychische Dimension berücksichtigt, bin ich auf den Begriff der »Transgeschlechtlichkeit« gestoßen, der immer wieder in der Diskussion um »Transsexualismus«, »Transgender«, »Transidentität«, »genderqueer« etc. auftaucht. Ich werde ihn deshalb in diesem Buch verwenden, weil er mir am besten geeignet erscheint, darauf hinzuweisen, dass das Phänomen »Trans« die Person als Ganze, körperlich wie psychisch, betrifft.
Gleichwohl werde ich in diesem Buch neben dem Begriff der Transgeschlechtlichkeit auch den der Identität verwenden. Im Sinne der erwähnten körperlich-seelischen Ganzheit stellen diese Begriffe für mich keinen Widerspruch dar. Vielmehr betrachte ich sie als zwei Aspekte desselben Phänomens, wobei einmal die psychologische Ebene (Identität) und einmal die somatische Ebene (Geschlechtlichkeit) thematisiert wird.
Wie meine Ausführungen über die verschiedenen Konzepte der Identität gezeigt haben, ist auch dieser Begriff, ebenso wie der der Transgeschlechtlichkeit, im Grunde wertfrei und nicht vorurteilsbeladen. Er hat seine negative Konnotation erst durch die ICD-Diagnose der »Störung der Geschlechtsidentität« (F 64.0) erhalten. Im Folgenden verwende ich »Identität« hingegen im Sinne der zitierten psychologischen Autor*innen, die von der Ich-Identität sprechen, die den Kern unserer Persönlichkeit, das Selbst, bildet und zu Kohärenz und Konsistenz der Persönlichkeit führt.
1.3 Ein Modell der Geschlechtsentwicklung und der Entwicklung der sexuellen Orientierungen
Mit Ermann (Ermann, 2019) können wir die Geschlechtsentwicklung und die Ausbildung der sexuellen Orientierungen als einen stufenweisen Entwicklungsprozess verstehen. An seinem Ursprung steht die Protogeschlechtsidentität (Reiche, 1997) als eine schon von Geburt an bestehende »unbestimmte Ahnung der Geschlechtlichkeit« (Ermann, 2019, S. 15), eine Grundbereitschaft des Menschen, sich sexuell zu fühlen.
Im Grunde ist bei diesem Begriff der zweite Teil des Wortes, »Identität«, meines Erachtens überflüssig und in Anbetracht der oben diskutierten terminologischen Probleme irreführend. Es geht hierbei ja nicht um einen Identitätsanteil im psychologischen Sinne, sondern, wie Ermann (2019, S. 15) es beschreibt, um eine Grundbereitschaft des Menschen, sich sexuell zu fühlen und, so müssen wir wohl ergänzen: sexuell zu sein. Aus diesem Grunde erscheint es mir besser und zutreffender, von »Protogeschlechtlichkeit « zu sprechen.
Eine solche Sicht steht auch in weitgehender Übereinstimmung mit den oben zitierten neurowissenschaftlichen Ansätzen (vgl. Haupt, 2019). Ich werde im Folgenden deshalb diesen Begriff verwenden. Worauf die Protogeschlechtlichkeit beruht, ist nach Ermann (2019, S. 15) bis heute nicht sicher bekannt. Es kommen genetische, hormonelle und hirnorganische Determinanten in Betracht sowie unbekannte psychologische und soziale Einwirkungen, die bereits in die vorgeburtliche Zeit zurückreichen.
Auf der Grundlage der Protogeschlechtlichkeit baut sich im Verlauf der Entwicklung das auf, was wir mit Mertens (1992) als »Bausteine« der sexuellen Identität bezeichnen können. Es sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit »Identität« hier eine Kerndimension der Persönlichkeit gemeint ist, die dem Individuum das Erleben von Kohärenz und Konsistenz vermittelt.
Eine zentrale Dimension dabei ist die sexuelle Kernidentität (core gender identity),
»das primordiale, bewusste und unbewusste Erleben (…), entweder ein Junge oder ein Mädchen bezüglich seines biologischen Geschlechts (im Englischen »sex« im Unterschied zu »gender«) zu...
Inhaltsverzeichnis
- Deckblatt
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort
- 1 Wie entstehen die sexuellen Orientierungen und die Geschlechtlichkeiten?
- 2 Gibt es Entwicklungsbedingungen von homosexuellen, bisexuellen und Kindern mit Transgeschlechtlichkeit, die von denen der cis und heterosexuellen Kinder abweichen?
- 3 Folgen des »Andersseins«
- 4 Segen und Fluch des Internets
- 5 Therapeutische Aspekte
- 6 Ein »gelingendes« Leben als trans, bi- und homosexueller junger Erwachsener
- Literatur
- Stichwortverzeichnis