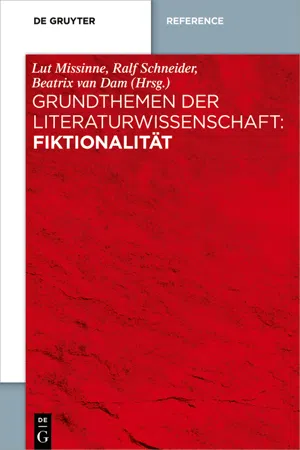
eBook - ePub
Grundthemen der Literaturwissenschaft: Fiktionalität
- 633 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Grundthemen der Literaturwissenschaft: Fiktionalität
Über dieses Buch
Fiktionalität ist ein zentrales und vieldiskutiertes Konzept der Literaturwissenschaft, spielt aber auch in zahlreichen anderen gesellschaftlichen Diskursen und Praktiken eine Rolle, von Moraldiskussionen über Politik und Recht bis hin zu den Wissenschaften. Der Band erschließt im ersten Teil Phänomene und Begriffe von Fiktionalität aus literaturwissenschaftlicher Sicht systematisch und historisch, wobei Beiträge aus verschiedene Philologien vertreten sind.
Im interdisziplinär angelegten zweiten Teil lotet er die Bedeutung von Fiktionalität in nicht-literarischen Zusammenhängen, Praktiken und Theorietraditionen aus und versammelt Artikel aus Ethnologie, Theologie, Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie. Insgesamt rücken Aspekte der Medialität und sozialen Praktiken in den Vordergrund, und Begriffe wie 'fiktional' und 'Fiktionalität' werden in ihrer Differenz zu anderen Konzepten wie Authentizität, nicht-fiktional, real etc. verstanden.
Damit verschafft das Handbuch einen Überblick über vielfältige Aspekte von Fiktionalität für ein breites Fachpublikum literaturwissenschaftlicher und anderer Disziplinen von fortgeschrittenen Studierenden bis zu Spezialisten.
Im interdisziplinär angelegten zweiten Teil lotet er die Bedeutung von Fiktionalität in nicht-literarischen Zusammenhängen, Praktiken und Theorietraditionen aus und versammelt Artikel aus Ethnologie, Theologie, Geschichtswissenschaft, Rechtswissenschaft, Politikwissenschaft, Soziologie und Psychologie. Insgesamt rücken Aspekte der Medialität und sozialen Praktiken in den Vordergrund, und Begriffe wie 'fiktional' und 'Fiktionalität' werden in ihrer Differenz zu anderen Konzepten wie Authentizität, nicht-fiktional, real etc. verstanden.
Damit verschafft das Handbuch einen Überblick über vielfältige Aspekte von Fiktionalität für ein breites Fachpublikum literaturwissenschaftlicher und anderer Disziplinen von fortgeschrittenen Studierenden bis zu Spezialisten.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Grundthemen der Literaturwissenschaft: Fiktionalität von Lut Missinne, Ralf Schneider, Beatrix Theresa van Dam, Lut Missinne,Ralf Schneider,Beatrix Theresa van Dam im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Literature & Literary Criticism. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
IV Interdisziplinäre Implikationen und Konzepte
IV.1 Fiktionalität und Philosophie/Phänomenologie/Ontologie
Maria E. Reicher
1 Einleitung
Bach, Kent (1985/86). „Failed Reference and Feigned Reference: Much Ado about Nothing“. Grazer Philosophische Studien 25/26 (1985/86): 359–374. Demmerling, Christoph und Íngrid Vendrell Ferran (Hgg., 2014). Wahrheit, Wissen und Erkenntnis in der Literatur. Berlin. In diesem Beitrag wird Fiktionalität aus philosophischer Perspektive behandelt. Im Zentrum werden dabei einige Paradoxien stehen. Es wird jeweils zunächst gezeigt, wie diese entstehen, und dann werden verschiedene Lösungsansätze für sie vorgestellt und diskutiert. Den Beginn machen die ontologischen Paradoxien der Fiktion (Abschnitt 2), gefolgt von dem Paradoxon der emotionalen Reaktionen auf Fiktionen (Abschnitt 3). Abschnitt 4 beschäftigt sich mit der erkenntnistheoretischen Frage, ob fiktionale Werke eine Erkenntnisquelle sein können und wenn ja, in welcher Hinsicht und wie das möglich ist.
Zunächst müssen jedoch einige terminologische Klärungen vorgenommen werden. Die erste terminologische Klärung betrifft die Termini ‚fiktional‘ und ‚fiktiv‘. Der Ausdruck ‚fiktional‘ wird als ein (im weitesten Sinn) sprechakttheoretisches Prädikat für Sprechhandlungen bzw. Sprachwerke gebraucht. Der Terminus ‚fiktiv‘ fungiert hingegen als ein ontologisches Prädikat für jene Gegenstände, die in fiktionalen Werken repräsentiert werden. In diesem Sinne kann man von fiktionalen Erzählungen, fiktionalen Romanen und fiktionalen Filmen sprechen, im Gegensatz etwa zu Tatsachenberichten, Biografien und Dokumentarfilmen. Hingegen spricht man von fiktiven Figuren, fiktiven Orten und fiktiven Ereignissen. Was genau der Gegensatz zu ‚fiktiv‘ ist, ist bereits eine ontologische Frage, auf die im Folgenden zurückzukommen sein wird. Kandidaten sind etwa ‚real‘ bzw. ‚real existierend‘ und ‚konkret‘.
Zweitens ist es im Folgenden wichtig, zwischen fiktionaler Rede einerseits und Rede über Fiktionen andererseits zu unterscheiden. (Der Ausdruck ‚Rede‘ wird hier allgemein für sprachliche Äußerungen aller Art verwendet, egal ob mündlich oder schriftlich und unabhängig von ihrer Komplexität). Der Text eines fiktionalen Romans ist ein Fall fiktionaler Rede; wenn sich hingegen Leser über die Figuren, die Schauplätze oder die Handlung eines solchen Romans unterhalten, ist dies ein Fall von Rede über Fiktionen.
Der Gegensatz zu fiktionaler Rede ist ernsthafte Rede. Das entscheidende Merkmal zur Unterscheidung von ernsthafter und fiktionaler Rede ist nicht der Wahrheitsgehalt der sie konstituierenden Äußerungen. Rede, die aus falschen Äußerungen besteht bzw. falsche Äußerungen enthält, kann durchaus ernsthafte Rede sein. Entscheidend sind die Ansprüche der Sprecher. In nichtfiktionaler Rede erheben die Sprecher in der Regel Wahrheitsanspruch für ihre Behauptungen; zusätzlich erheben sie epistemische Rechtfertigungsansprüche, d. h., sie beanspruchen, ihre Behauptungen mit guten Gründen für wahr zu halten. Auf der Seite der Adressaten gibt es in der Regel die entsprechenden Erwartungen: Es wird in der Regel erwartet, dass die Äußerungen des Sprechers wahr und epistemisch gerechtfertigt sind.
Freilich werden diese normativen Regeln auch in ernsthafter Rede manchmal gebrochen. Aber wenn das der Fall ist, dann ist das ein Mangel, und wir sind berechtigt, dem Sprecher dies vorzuwerfen. Doch in fiktionaler Rede sind die erwähnten normativen Regeln grundsätzlich außer Kraft gesetzt. Daher wäre es unangemessen (und ein Zeichen dafür, dass jemand das Sprachspiel der fiktionalen Rede nicht verstanden hat), etwa einen Märchenerzähler dafür zu tadeln, dass er Dinge erzählt, die nicht den Tatsachen entsprechen, oder vom Autor eines fiktionalen Romans zu verlangen, dass er Belege für seine Schilderungen beibringt.
Soweit eine Kurzfassung der Standardanalyse fiktionaler Rede. In Abschnitt 4 dieses Beitrags („Das erkenntnistheoretische Paradoxon der Fiktion“) wird jedoch gezeigt werden, dass diese Standardanalyse einer Verfeinerung bedarf, um bestimmten Phänomenen gerecht zu werden.
2 Ontologische Paradoxien der Fiktion
Von einer Paradoxie spricht man in der Philosophie, wenn aus anscheinend wahren bzw. unmittelbar einleuchtenden Prämissen etwas offenkundig Falsches oder Unsinniges folgt. Ein besonders deutlicher Fall einer Paradoxie liegt dann vor, wenn aus den anscheinend wahren Prämissen ein logischer Widerspruch folgt. Das Folgende ist ein Beispiel für einen solchen Fall:
OntP1
- Pegasus ist ein geflügeltes Pferd.
- Pegasus existiert. (1)
- Pegasus existiert nicht.
Prämisse 1 scheint eine Feststellung zu sein, die als Antwort auf die Frage „Wer oder was ist Pegasus?“ in vielen Kommunikationskontexten vollkommen akzeptabel wäre. (Die Frage könnte etwa bei einem Quiz gestellt werden oder im Zuge einer Prüfung über griechische Mythologie oder von einer Person, die etwas über Pegasus hört oder liest und damit nichts anfangen kann.)
Prämisse 2 folgt logisch aus 1, gemäß weithin anerkannter fundamentaler logischer Prinzipien. (Ich folge hier einer in der Logik verbreiteten Konvention, wonach in einem Argument jeweils durch Zahlen in runden Klammern angegeben wird, aus welchen vorangegangenen Sätzen ein Satz folgt.) Aufgrund welcher Prinzipien bzw. Annahmen diese Folgerungsbeziehung gilt, wird gleich näher erläutert werden.
Prämisse 3 ist anscheinend eine empirische Wahrheit. Wir wissen, dass es keinen Sinn hat, sich auf die Suche nach Pegasus zu machen: Wir können ‚ihn‘ unter den Dingen in der Welt nicht finden. Prämisse 3 widerspricht jedoch Prämisse 2, welche ihrerseits aus der anscheinend wahren Prämisse 1 logisch folgt, also auch wahr sein müsste. (Denn die logische Folgerungsbeziehung ist wahrheitserhaltend: Jeder Satz, der aus einem wahren Satz logisch folgt, ist selber auch wahr.) Doch von zwei einander widersprechenden Sätzen muss mindestens einer falsch sein.
Ähnlich gelagert – nur auf einem anderen fundamentalen logischen Prinzip basierend – ist folgende Paradoxie:
OntP2
- Pegasus ist ein geflügeltes Pferd.
- Es gibt Flügelpferde. (1)
- Flügelpferde gibt es nicht.
Auch hier folgt 2 aus 1 (unter Anwendung eines weithin akzeptierten logischen Prinzips), widerspricht jedoch einer augenscheinlich wahren empirischen Aussage (3). OntP1 und OntP2 sind ontologische Paradoxien, weil sie Fragen der Existenz betreffen. (Die Ontologie ist jene philosophische Disziplin, die sich mit der Frage beschäftigt, was es gibt.)
Die philosophische Herausforderung besteht darin, die Paradoxien aufzulösen und damit die Widersprüche zu vermeiden. Es wurde gesagt, dass die Paradoxien aus allgemein bzw. weithin akzeptierten Annahmen und Prinzipien entstehen. Daher erfordert deren Auflösung, dass wir mindestens eine der relevanten Annahmen aufgeben. Aus dieser Überlegung ergeben sich drei grundsätzlich mögliche Lösungsansätze:
- a.
- Man könnte Prämisse 1 aufgeben, also „Pegasus ist ein geflügeltes Pferd“ als falsch verwerfen.
- b.
- Man könnte Prämisse 3 aufgeben, also „Pegasus existiert nicht“ bzw. „Flügelpferde existieren nicht“ als falsch verwerfen.
- c.
- Man könnte die Schlussfolgerung von Prämisse 1 auf Prämisse 2 verwerfen, also die Annahme aufgeben, dass aus „Pegasus ist ein Flügelpferd“ logisch folgt, dass Pegasus existiert bzw. dass Flügelpferde existieren.
Die Lösungsansätze lassen sich grob in realistische und antirealistische Theorien fiktiver Gegenstände einteilen. Antirealistische Theorien halten daran fest, dass es weder Flügelpferde im Allgemeinen noch Pegasus im Besonderen gibt. Diese Theorien müssen Wege finden, die Ableitung der Existenzsätze (Prämisse 2) zu vermeiden. Dies kann entweder durch ein Aufgeben bzw. Modifizieren von Prämisse 1 geschehen oder durch ein Aufgeben bzw. Modifizieren der betreffenden logischen Prinzipien. Realistische Theorien hingegen erkennen an, dass es fiktive Gegenstände gibt, und müssen daher erklären, warum der Widerspruch zu den empirischen Wahrheiten (Prämisse 3) nur ein scheinbarer ist. Außerdem müssen realistische Theorien eine Reihe von Fragen in Bezug auf die besondere Natur fiktiver Gegenstände klären.
Antirealistische Theorien fiktiver Gegenstände
Vertreter antirealistischer Theorien halten also an der dritten Prämisse („Pegasus existiert nicht“ bzw. „Flügelpferde existieren nicht“) fest. Diejenigen von ihnen, die zugleich an der ersten Prämisse („Pegasus ist ein Flügelpferd“) festhalten wollen, müssen daher Wege finden, die Ableitung von „Pegasus existiert“ aus der ersten Prämisse zu blockieren. Um zu verstehen, wie dies gelingen kann, ist es erforderlich, sich genauer anzusehen, aufgrund welcher Annahmen und Prinzipien diese Ableitung zulässig ist.
Einige grundsätzliche Anmerkungen mögen für das Verständnis des Folgenden hilfreich sein: Logische Folgerungsbeziehungen gelten stets im Rahmen eines bestimmten logischen Systems. Logische Systeme enthalten Regeln, die festlegen, welche Sätze man aus einer gegebenen Menge von Sätzen ableiten kann. Für OntP1 und OntP2 ist jeweils eine solche Ableitungsregel relevant. Es gibt jedoch nicht nur eine Logik (ein logisches System), sondern viele. Logische Systeme sind Menschenwerk. Es ist letztlich eine Frage der Entscheidung (idealerweise getroffen aufgrund sorgfältiger Überlegung und Abwägung von Vor- und Nachteilen), welches logische System man akzeptiert. Es gibt aber so etwas wie ein ‚Standardsystem‘, das heute von den meisten Philosophen und Logikern akzeptiert und verwendet wird. Es wird oft als ‚klassische Logik‘ bezeichnet. Dieses ist der Ausgangspunkt der folgenden Ausführungen.
Zunächst zu OntP1: Warum folgt – in der klassischen Logik – „Pegasus existiert“ aus „Pegasus ist ein geflügeltes Pferd“? – Zunächst einmal folgt „Pegasus existiert“ in der klassischen Logik aus jedem beliebigen Satz, weil es sich dabei um eine logische Wahrheit handelt. D. h., „Pegasus existiert“ ist aus logischen Gründen wahr, unabhängig vom Zustand der Welt.
Dies ist auf den ersten Blick überraschend, da es doch eine Frage der Empirie und nicht eine Frage der Logik zu sein scheint, welche Lebewesen und andere Dinge auf der Welt existieren. Die klassische Logik geht jedoch davon aus, dass Ausdrücke wie „Pegasus“ (so genannte „singuläre Terme“, von denen Eigennamen eine wichtige Unterkategorie sind) stets einen Gegenstand in der Welt bezeichnen (wobei „Gegenstand“ hier im weitesten Sinn zu verstehen ist). In diesem Sinne macht die klassische Logik eine Existenzvoraussetzung.
Streng genommen betrifft diese Existenzvoraussetzung freilich nicht solche natürlichsprachliche Namen wie „Pegasus“, denn diese sind nicht Bestandteile eines logischen Systems. Logische Systeme bedienen sich vielmehr sogenannter formaler Sprachen. Diese enthalten nicht die Wörter unserer natürlichen Sprachen, sondern an ihrer Stelle etwa einzelne Buchstaben. So werden die Buchstaben a, b, c … für singuläre Terme verwendet, die Buchstaben F, G, H … für Prädikatausdrücke (z. B. „ist ein Flügelpferd“), die Buchstaben x, y, z für sogenannte Variablen (deren Bedeutung ungefähr dem deutschen ‚etwas‘ entspricht). Doch in der Philosophie werden logische Systeme in der Regel dafür verwendet, sich Klarheit über die Struktur philosophischer Argumente zu verschaffen. Diese Argumente sind meist ursprünglich in natürlichen Sprachen formuliert. Dies bedeutet, dass es für eine gründliche logische Analyse oft erforderlich ist, die Prämissen und Konklusionen der natürlichsprachlichen Argumente sozusagen in die formale Sprache des logischen Systems zu ‚übersetzen‘ (zu ‚formalisieren‘). Dazu muss man sich zuerst über die logische Struktur der natürlichsprachlichen Prämissen und Konklusionen klar werden: Handelt es sich um einen einfachen Subjekt-Prädikat-Satz oder ist die Struktur komplexer? Wenn Ersteres, was ist das Subjekt, was das Prädikat? Enthält der Satz singuläre Terme, und wenn ja, welche?
Es scheint nun (zumindest auf den ersten Blick) klar zu sein, dass „Pegasus“ in „Pegasus existiert“ ein singulärer Term ist. Folglich wäre dieser Satz halbformal als ‚a existiert‘ darzustellen, und dies muss – aufgrund der erläuterten Existenzvoraussetzung in der klassischen Logik – wahr sein.
Es ist also zunächst die Existenzvoraussetzung der klassischen Logik, die für die problematische Ableitung von „Pegasus existiert“ aus Prämisse 1 verantwortlich ist. Daraus könnte man ein Argument gegen diese Existenzvoraussetzung schmieden: Wenn eine bestimmte Annahme in einem logischen System zur Ableitung offensichtlich falscher Sätze aus augenscheinlich wahren Sätzen führt, dann sollte diese Annahme aufgegeben werden.
In der Tat gibt es logische Systeme, die diese Existenzvoraussetzung nicht enthalten. Man nennt sie existenzfreie Logiken. In diesen ist nicht vorausgesetzt, dass jeder singuläre Term etwas bezeichnet; daher wäre „Pegasus existiert“ in einem solchen System keine logische Wahrheit. Dennoch kann auch in einer existenzfreien Logik „Pegasus existiert“ aus „Pegasus ist ein Flügelpferd“ abgeleitet werden, und zwar aufgrund eines Prinzips, das – in halbformaler Schreibweise – lautet:
(PP) a ist F → a existiert.[Lies: Wenn a F ist, dann existiert a.]
Ich nenne dieses Prinzip das Prädikationsprinzip (kurz: PP). ‚a‘ fungiert hier, wie gesagt, als singulärer Term der formalen Sprache, ‚F‘ als Prädikatausdruck. Dem Prädikationsprinzip liegt die Intuition zugrunde, dass man einem Gegenstand, der nicht existiert, nicht wahrheitsgemäß ein Prädikat zusprechen kann. Mit anderen Worten: Das Haben einer Eigenschaft scheint Existenz zu implizieren. Daher scheint es, dass jemand, der behauptet, dass Pegasus ein Flügelpferd ist, nicht zugleich leugnen kann, dass Pegasus existiert.
Wenn man also den Schluss von „Pegasus ist ein Flügelpferd“ auf „Pegasus existiert“ blockieren möchte, genügt es nicht, die Existenzvoraussetzung der klassischen Logik aufzugeben. Man müsste auch das Prädikationsprinzip verwerfen. Wenn man die dem Prädikationsprinzip zugrunde liegende Intuition teilt, wird man das als sehr hohen Preis für die Auflösung von OntP1 e...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- I Einleitung
- II Historische Entwicklungslinien
- III Allgemeine Fragestellungen
- IV Interdisziplinäre Implikationen und Konzepte
- V Anhang