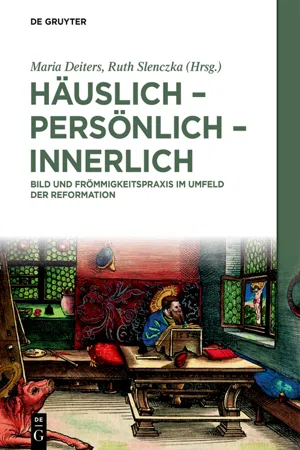
Häuslich - persönlich - innerlich
Bild und Frömmigkeitspraxis im Umfeld der Reformation
- 437 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
Häuslich - persönlich - innerlich
Bild und Frömmigkeitspraxis im Umfeld der Reformation
Über dieses Buch
Der reich bebilderte Sammelband führt in das noch kaum erschlossene Forschungsfeld privater Bild- und Frömmigkeitspraktiken im Umfeld der Reformation ein und entfaltet die Sphären des Privaten dabei im Spannungsfeld zwischen "persönlich" und "gemeinschaftlich", "innerlich" und "äußerlich-sichtbar" sowie "häuslich" und "öffentlich".
Das bereits vor der Reformation erstarkende Interesse der Laien an Formen und Methoden der persönlichen Aneignung und Verinnerlichung des Glaubens ließ im 16. und 17. Jahrhundert nicht nach. Dem spüren die Autoren aus der Perspektive verschiedener Disziplinen nach, wobei ein besonderer Fokus auf den Bildwerken liegt, die in dieser individualisierten Frömmigkeitskultur hervorgebracht und genutzt wurden. Die zentrale Rolle solcher religiöser Bilder ist gerade für den Protestantismus wenig erforscht: Einzelne Gattungen und Werkgruppen, etwa bebilderte Frömmigkeitsliteratur oder kleinformatige, mobile religiöse Bildwerke, rückt der Band erstmals in den Fokus der Forschung, andere werden unter der Frage nach innovativen Bildstrategien zum persönlichen Glaubensvollzug neu verhandelt.
Der interdispziplinäre Zugriff verbindet dabei Kunstgeschichte, Theologie, Germanistik, Geschichte und Buchwissenschaft.
Häufig gestellte Fragen
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Information
Der Weg zum Himmel und die nahe Gnade
Auffallende Quantitäten und Qualitäten der spätmittelalterlichen Frömmigkeit
Vielfalt und polare Spannungsverhältnisse in der spätmittelalterlichen Frömmigkeit
Die generelle Zweiseitigkeit von menschlichem Bemühen und himmlischer Gnadenhilfe
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Der Weg zum Himmel und die nahe Gnade Neue Formen der spätmittelalterlichen Frömmigkeit am Beispiel Ulms und des Mediums Einblattdruck
- Bildgeleitete Andacht Auskünfte der konfessionellen Kontroversliteratur des 16. Jahrhunderts zu Gefahren und Gefährdung der Bildandacht
- Das illustrierte Flugblatt und sein Publikum Massenmedien, Massenwirksamkeit und eine Anleitung zur Rezeption
- Aneignung der Bibel über Bilder Die Haus- und Familienbibeln des Nürnberger Patriziers Martin Pfinzing und des Hallenser Seidenstickers Hans Plock
- Die Kirche in der Kammer Zum Verhältnis zweier Gemälde Emanuel de Wittes aus dem Jahre 1678
- Selbstdeutung als Frömmigkeitspraxis Cranachs gemalte Selbstzeugnisse
- Die Transformation der mittelalterlichen ars moriendi zur reformatorischen Leichenpredigt
- Lutherische Erbauungsbücher für den persönlichen Gebrauch aus Nürnberg
- Zum-Verschwinden-Bringen, Alludieren, Distanzierung Strategien der Verinnerlichung und der Unterstützung des Gebets in Beispielen der deutschen und niederländischen Grafik des 15. und frühen 16. Jahrhunderts
- „Also, das das hertze anhebe“ Herz und Gebet in Luthers Einleitung zu Johannes 17
- „Spectator ardens discere“ Die visuelle Poesie biblischer Meditation in Benito Arias Montano’s „Humanae salutis monumenta“ von 1571
- Carthusians, Modern Devotees and Vernacular Bible Readers in the Low Countries (1350–1550)
- Catechisms and Their Images
- Neuer Wein in alten Schläuchen? Luthers Betbüchlein und die Martyrologien des Ludwig Rabus als Substitut der altgläubigen Heiligenlegenden zur privaten Frömmigkeitsübung
- Der Nachlass der Herzogin und Nonne Philippa von Geldern Eine persönliche Sammlung von Gegenständen zum devotionalen Gebrauch
- Church Authority and Individual Devotion The Cult of the Maria Regina of Santa Maria in Trastevere, Rome, until the Late Sixteenth Century
- Zweifaches Bekenntnis Ein konfessioneller Bilddiskurs in einem Görlitzer Bürgerhaus des 16. Jahrhunderts