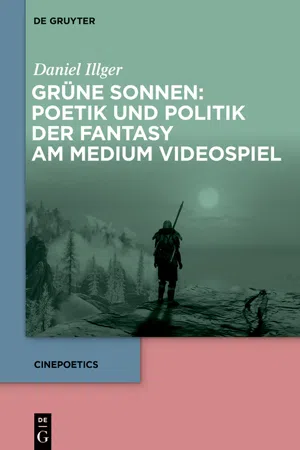Annäherungen an ein leidiges Genre
In der Tat: Fantasy ist ein leidiges Genre. Das beginnt schon bei dem Namen. Die Bezeichnung Fantasy entstammt eben, wie Johannes Rüster schreibt,
keinem literaturwissenschaftlichen Diskurs, sondern ist vielmehr organisch im Spannungsfeld populärer Literatur zwischen editorischem Verlangen nach Kategorisierung und dem Identifikationsbedürfnis einer eingeschworenen Lesergemeinde entstanden.1
Entsprechend unklar und wenig trennscharf ist der Ausdruck. Über die Genres Science-Fiction und Horror lässt sich zwar Ähnliches sagen,2 aber bei der Fantasy ist es ärger. Das liegt daran, dass diesem Wort etwas unleugbar Albernes anhaftet, sowie damit eine Idee von Literatur, oder von Kunst allgemein, erfasst sein soll.
Der Ausdruck Science-Fiction erweckt Vorstellungen von einem kühnen Gedankenflug in unendliche Horizonte der Zeit und des Raumes, von Spekulation und Experiment und dem Ausloten immer neuer innerer und äußerer Grenzen. Und „Horror“ verweist auf Gefühle, die sehr wohl ein affektpoetisches Kalkül bestimmen können: Angst, Schrecken, Ekel – und die wohlig-unbehagliche Faszination, die mit dem Blick in die Abgründe der Sterblichkeit einhergeht.
Fantasy hingegen …
Offenkundig ist jegliche ästhetische Produktion abhängig von dem Gebrauch des rätselhaften Vermögens, das wir gemeinhin als Fantasie bezeichnen. Auch wenn ich ganz alltägliche Vorgänge gestalten will, die sich an ganz alltäglichen Orten abspielen, benötige ich Fantasie, weil diese Dinge weder im sprachlichen Ausdruck noch in der (audio)visuellen Komposition per se gegeben und abrufbar sind.3 Es ist also heikel, wenn sich ein Genre in seiner Selbstkennzeichnung auf jenes Vermögen beruft. Entweder, so steht zu befürchten, haben wir es mit einer Banalität oder mit einer Anmaßung zu tun. Verweist die Fantasy in ihrem Namen auf den Umstand, dass ein Kunstprodukt, wenn es etwas taugen soll, mit einem Mindestmaß an Fantasie gefertigt sein sollte? Oder will sie behaupten, dass es Werken, die anderen Genres – oder, sofern das möglich ist, überhaupt keinem Genre – zuzuordnen sind, an Fantasie mangelt? Oder beansprucht sie, in ihrer Poetik eine ganz besondere Art der Fantasie zu entfalten, gewissermaßen eine Fantasie zweiter Ordnung?
Johannes Rüster legt eine Genredefinition vor, die vermuten lässt, dass der letztgenannte Fall zutrifft: „Eine Anderswelt in mythischem Modus, die auf den globalen Sagenschatz rekurriert – und so dem Rezipienten in der Eukatastrophe Katharsis verschafft“; das sei die „Kombination“, welche die Fantasy „in ihrem Kern bis heute entscheidend prägt“.4 Auch Frank Weinreichs Überlegungen weisen in diese Richtung, benennt er doch „erstens die Heldin, den Held oder die Heldengruppe, zweitens die imaginäre Welt und drittens die Magie“ als jene Charakteristika, die sich für eine Bestimmung des Genres „auch im Allgemeinen zu eignen scheinen“.5 Hingegen heißt es bei John Clute, ein der Fantasy zugehöriger Text sei
a self-coherent narrative. When set in this world, it tells a story which is impossible in the world as we perceive it; when set in an otherworld, that otherworld will be impossible, though stories set there may be possible in its terms.6
Und Richard Mathews erklärt kurz und bündig: „Fantasy enables us to enter worlds of infinite possibilities.“7
Sicherlich unterscheiden sich die genannten Definitionen, was ihre theoretische Grundlage, die verwendete Begrifflichkeit und die Schwerpunktsetzung betrifft. Sie alle bestätigen jedoch die Ahnung, dass die Fantasy für sich ein irgendwie privilegiertes Verhältnis zur Fantasie beansprucht. Gemein ist ihnen zudem, dass sie bestrebt sind – oder sich genötigt fühlen – in knappen Sätzen viele große Wörter unterzubringen. Wir werden sehen, was es mit dem mythischen Modus und der Eukatastrophe auf sich hat, von denen Rüster spricht. Fest steht, dass die Fantasy eine Menge vorhat mit ihrem Publikum. Es gilt, Helden kennenzulernen, deren Abenteuer sich in magischen Welten voller ungeahnter oder gar unermesslicher Möglichkeiten zutragen. Und das Ganze soll obendrein eine Katharsis herbeiführen.
Der eine oder die andere mag nun geneigt sein, auf gut Berlinerisch zu fragen: Geht’s och ’ne Nummer kleener? Die Antwort lautet freilich: Nein, tut uns leid, kleiner ist aus.8 Vor diesem Hintergrund wird deutlich, was es mit der Anmutung von Albernheit auf sich hat, die dem Namen Fantasy innewohnt. Das Genre will sehr viel. Es ist dem Monumentalen ebenso wie dem Transzendenten zugeneigt und setzt eine Fantasie ins Werk, die nicht einfach das Alltägliche in besonderen Farben malt, sondern danach strebt, ganze Welten zu erschaffen – ähnlich wie der Zauberer das Karnickel aus dem Hut zieht. Hierin besteht die Verheißung der Fantasy. Hierin besteht zugleich ihre Gefährdung. Denn ein solcher Anspruch gerät leicht zur Farce; das Epische wird dann zur Aufgeblasenheit, das Andersweltliche zum Mumpitz. Wäre das Genre eine personale Instanz, so müsste man ihm vorhalten, dass es sich gerne mal vertut, was die eigene Fallhöhe betrifft. Aufs wahre Maß zurechtgestutzt, bleibt mitunter wenig übrig. In diesem Sinn ist wohl Arno Metelings süffisante Bemerkung zu verstehen, einen Fantasy-Roman erkenne man „an den mehreren hundert Seiten Text, dem Untertitel, der auf eine Reihe hinweist, dem kitschigen Covermotiv mit erhabenem Prägedruck des Titels, aber vor allem – wenn man ein oder zwei Seiten weiterblättert – an der beigefügten Landkarte“.9
Bekanntlich soll man ein Buch nicht nach dem Umschlag beziehungsweise dem Einband beurteilen. Doch was ist von Romanen zu erwarten, die eine solche Selbstdarstellung nötig haben? Ihre Leserinnen und Leser muss man sich wohl als sehr junge Menschen vorstellen – oder als solche, die auf ungute Weise jung geblieben sind. Wohlbekannte Klischeebilder drängen sich auf: der muskelbepackte, halbnackte Barbar mit riesigem Schwert, zu dessen Füßen sich Frauen in zerrissenen Kleidern räkeln; oder die ätherische Dame mit wallenden Gewändern, wallendem Haar und traumverlorenem Blick, die auf einem Einhorn durch pastellfarbene Wälder reitet …
Aber auch, wer nicht darauf besteht, die Fantasy von ihrer infantilsten Seite zu betrachten, muss einräumen, dass sich das Genre in einer prekären Position befindet.10 Durch seine Neigung zu „ersatzmetaphysischer Tröstung“ sei es, so Rüster, „natürlich ins Visier ideologiekritischer Theorie, etwa der marxistischen Literaturkritik geraten“.11 Ich will sogleich erläutern, welchen Anschuldigungen sich die Fantasy ausgesetzt sieht. Eines vorweg: Der, wie Rüster schreibt, „wohlfeile Eskapismusvorwurf“12 gehört noch – wohlfeil oder nicht – zu den freundlicheren Kritikpunkten.
Fantasy und Fantastik
Zunächst jedoch muss ein Umstand gewürdigt werden, der dazu beiträgt, die verworrene Gemengelage aus Sicht der deutschsprachigen Forschung noch ein wenig verworrener zu machen. Auch diese Komplikation verdankt sich dem Etikett „Fantasy“. Genauer gesagt der Tatsache, dass nicht nur der Name des Genres, sondern desgleichen der allergrößte Teil des Materials, das (zumal aus literatur- und filmwissenschaftlicher Perspektive) die unverrückbaren Bezugspunkte der Diskussion abgibt, dem angloamerikanischen Kulturkreis entstammt. Nun ist es, was die „Fantasy“ betrifft, im Verlauf der Übersetzungs- und Übertragungsprozesse zu einer Bedeutungsverschiebung gekommen. Wie Hans-Heino Ewers erläutert, entspricht
die weite und übergeordnete Kategorie der Phantastik dem englischen Begriff der ‚fantasy‘, während Fantasy enger gefasst und zumeist als eine Sonderform bzw. Subgattung der Phantastik ausgegeben wird.13
Daraus folgt, dass die Arbeiten, die sich etwa in den USA mit der fantasy beschäftigen, hierzulande eher als Beiträge zur Fantastik-Forschung betrachtet werden würden; englische Publikationen, die sich ausschließlich der Fantasy widmen, findet man hingegen selten14 – eigentlich nur dann, wenn einschlägige Autoren, etwa. J. R. R. Tolkien oder George R. R. Martin, oder einschlägige Werke, etwa Ursula K. Le Guins Earthsea-Zyklus (1964–2018), einer Betrachtung unterzogen werden. Umgekehrt gibt es im deutschsprachigen Raum eine verhältnismäßig emsige Forschung, die sich der Fantasy als „Sonderform bzw. Subgattung der Phantastik“ widmet, aufgrund ihrer Orientierung an der angloamerikanischen Kultur aber gezwungen ist, Kategorien miteinzubeziehen, die eben nur Sinn machen, wenn man fantasy als Fantastik versteht. Michael Endes Momo (1973) oder Neil Gaimans Neverwhere (1996) lassen sich vielleicht gewinnbringend der „Urban Fantasy“ subsumieren – es wäre aber meines Erachtens wenig hilfreich, eine solche Zuordnung bei Robert E. Howards Conan-Erzählung The Tower of the Elephant (1933) oder Scott Lynchs Gentleman-Bastards-Roman The Lies of Locke Lamora (2006) anzustreben, nur weil beide, Howard und Lynch, die Handlung hier jeweils in einer Großstadt ansiedeln.15
Zusätzlich zu den unvermeidlichen Schwierigkeiten, die mit dem Klassifizierungsstreben der taxonomischen Genretheorie einhergehen – und die den entsprechenden Autoren durchaus bewusst sind16 –, ergibt sich also das Problem, dass fantasy und Fantasy häufig stillschweigend in eins gesetzt, zumindest aber nicht hinreichend differenziert werden. So werden Kategoriengebäude errichtet, die zwar keine Kartenhäuser sein mögen, jedoch allemal auf schwankendem Grund stehen.17 Das wird etwa daran deutlich, dass sich für J. K. Rowlings Harry-Potter-Reihe (1997–2007), bekanntlich die Epiphanie zeitgenössischer Populärkultur, offenbar kein geeigneter Platz in den Taxonomien findet. Frank Weinreichs Ansicht nach zählen die Abenteuer des Zauberschülers schlicht zu den „protoypische[n] Werken der Fantasyliteratur“18, wohingegen Rüster der Meinung ist, dass sich die Harry-Potter-Heptalogie einer klaren Zuordnung entzieht, da sie nicht nur in zwei Welten spielt, „deren eine mit der außerliterarischen identisch scheint“, sondern darüber hinaus „die Fantasy mit anderen populären Literaturformen“, in diesem Fall dem „britischen Schulroman“, vermischt.19 Meteling hingegen sortiert Rowlings Romane bei der „all age- oder young adult-Fantasy“ ein, was zwar zutreffen mag, an sich aber wenig bis nichts erklärt. Und dies ist umso auffälliger, weil der Autor nicht nur auf eine nähere Bestimmung der „all age- oder young adult-Fantasy“ verzichtet, sondern sie zudem in keinerlei Verhältnis zu den von ihm ausgemachten „literarischen Traditionen oder Reihen“ innerhalb der Fantasy setzt20 – als da wären: 1. „Geschichten über die Beziehung zwischen Menschen und Feenwesen“; 2. „Sword-& Sorcery-Literatur“; 3. „Tierfantasy“; 4. „Weird, Contemporary oder Urban Fantasy“; und 5. „die sogenannte epische Fantasy (epic fantasy) (auch: high fantasy)“21 –, sodass man zu dem Schluss kommen muss, die irgendwie fantastische Literatur für Menschen allen Alters und junge Erwachsene stelle eine monadische, für sich bestehende Einheit dar.22
Was fängt man an mit einer solchen verwirrenden Vielfalt von Kategorien, die sich von Autor zu Autor unterscheiden, dabei durchaus nicht ohne Weiteres miteinander übereingebracht werden können, und doch irgendwie alle dasselbe bezeichnen, oder zu bezeichnen scheinen? Ich glaube, man kommt nicht umhin, die grundlegende Methodik zu hinterfragen. Kurz gesagt, es braucht einen anderen Ansatz als die taxonomische Genretheorie. Worunter ich die Vorstellung verstehe, dass sich Genres, wie Hermann Kappelhoff schreibt, „in ihren Darstellungsformen durch eine gesetzmäßige Beziehung zum repräsentierten Gegenstand“ bestimmen ließen.23 Warum eine Korrektur hier so dringend nottut, mag deutlicher werden, wenn wir uns nun vergegenwärtigen, welche Vorwürfe gegen die Fantasy erhoben werden – auf der Grundlage eines taxonomischen Genreverständnisses, wohlgemerkt.