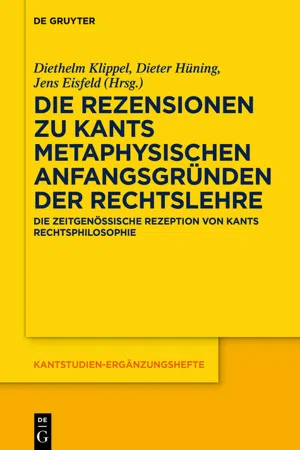
eBook - ePub
Die Rezensionen zu Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre
Die zeitgenössische Rezeption von Kants Rechtsphilosophie
- 374 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Die Rezensionen zu Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre
Die zeitgenössische Rezeption von Kants Rechtsphilosophie
Über dieses Buch
Die Kantforschung hat die Reaktion der Zeitgenossen auf Kants "Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre" bisher kaum untersucht. Vorliegende Edition macht die insgesamt 27 Rezensionen zum ersten Mal zugänglich. Der Band enthält zudem eine Bibliographie der Kantkommentare und weiterer zeitgenössischer Quellen, ferner drei Beiträge zur Rezeption der Rechtslehre Kants um 1800 und den Hintergründen der seither vernachlässigten Forschung.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Die Rezensionen zu Kants Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre von Diethelm Klippel, Dieter Hüning, Jens Eisfeld, Diethelm Klippel,Dieter Hüning,Jens Eisfeld im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Philosophie & Philosophische Metaphysik. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Teil II: Rezensionen zur ersten Auflage der Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre (1797)
Die Metaphysik der Sitten. Erster Theil: Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre.XII + 235 + [1] S. ‒ Königsberg: Nicolovius 1797.
1 Allgemeine juristische Bibliothek [Verf.: -r.]. Hrsg. von einer Gesellschaft Tübinger Rechtsgelehrter. 1797, Bd. 3, S. 145‒168.
/145/ […]
Der ehrwürdige Greis arbeitet noch immer mit der ganzen Stärke seines männlichen Geistes an der Vollendung des grossen Werks, das menschliche Erkenntnisvermögen in seinen ächten Wirkungskreis zu versetzen, und eine Wissenschaft der Philosophie zu begründen, die das Unerkennbare zum Erkennbaren und das Denkbare zum Wirklichen zu erheben sich nicht anmast; sondern, reine und empirische Vernunfterkenntnis absondernd, das Unbefriedi-/146/gende der theoretischen Erkenntnis durch die Aussprüche und nothwendigen Forderungen der practischen Vernunft ergänzt. Es ist hier wohl nicht der Ort, den Ruhm eines Mannes durch Recensentenlob zu vergrössern, den selbst die Gegner seiner Philosophie mit Ehrfurcht nennen. Noch weniger begnügt sich Rec. mit dem blossen Nachsprechen einiger Formeln oder mit Heraushebung einzelner Sätze des Verf. Er versucht es vielmehr, die Gedankenreyhe desselben, die, wie in allen seinen Schriften, theils durch die Natur einer alles in seine Elemente auflösenden Untersuchung, theils aber auch nach einer ohne Zweifel wohlgemeinten Disciplin für den Leser mit Mühe erhoben werden mus, in den wesentlichsten Momenten aufzufassen, und in eine, wo möglich, einfache Uebersicht zu übertragen. Am Ende wird er freymüthig seine Zweifel gegen einzelne Behauptungen äussern. Denn daß, einen einzigen Zweifel ausgenommen, den sich Rec. bis jezo nicht lösen konnte, gegen die Deduction und eigentliche Begründung der Rechtslehre selbst wohl schwerlich viel Erhebliches zu erinnern seyn dürfte, davon hat ihn sein angestrengtestes Nachdenken und selbst auch die Schwäche des Tadels überzeugt, den er von seynwollenden Richtern in diesem Fache gehört und auch leider! schon gelesen hat. Alles hängt in diesen metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre mit den ersten Grundprincipien der kritischen Philosophie zusammen, die auch diesem Gebäude im Ganzen seine Haltung geben, ja sogar einzelne Rechtssäze, die der Menschenverstand bisher als nothwendig angesehen und so aufgestellt hatte, auf die bestimmteste Weise zu Vernunftwahrheiten erheben. Auch diese Schrift wird dem schiefesten Misbrauch ausgesetzt seyn. Es wird Civilisten geben, die aus der kritischen Philosophie Sätze ableiten werden, welche aus einer ganz andern Quelle flossen. Und Jünglinge wird es geben, die, zu diesem Studium von der Natur berufen oder nicht berufen, alles positive gelehrte Studium des Statutarischen in unserer Jurisprudenz, als vermeintliche Rechtsphilosophen, verwerfen werden. Aber es wird auch Männer geben, die[,] ohne das positive System aus seinem eigenen Zusammenhang reissen zu wollen, sich dennoch zu höheren Gesichtspuncten erheben, und die Quelle der wichtigsten /147/ Bestimmungen desselben in der blossen Vernunft suchen werden. Diesen wird, ohne den Gebrauch des Empirischen, und ohne die historische Kenntnis des Statutarischen verwerfen zu wollen, an einer blos empirischen Rechtslehre nicht mehr genügen. Ihre Rechtswissenschaft wird von Vernunftprincipien ausgehen, das Naturrecht wird ihnen nicht blos eine Art von leichterer Voreinleitung ins positive Recht seyn. Es wird zu seiner eigenthümlichen Würde erhoben werden, die philosophische Grundlage zu seyn, an welche sich die gesammte Rechtslehre anschliest.
Nothwendiger Weise aber schliest sich diese philosophische Grundlage der gesammten Rechtslehre an die höheren Untersuchungen und Resultate der Kritik der Vernunft an. Und zwar folgt auf die Kritik der practischen Vernunft unmittelbar die Metaphysik der Sitten. Ein Gegenstük der metaphysischen Anfangsgründe der Naturwissenschaft, soll sie die metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre, so wie der Tugendlehre, enthalten. (Dieser leztere Theil wird nach der Zusage des Verf. in kurzem nachfolgen).
Da der Rechtsbegriff ein reiner, jedoch auf die Anwendung in der Erfahrung gestellter Begriff ist, für die Mannigfaltigkeit der Fälle in der Erfahrung aber Vollständigkeit der Eintheilung niemals möglich ist, so kann einzig ein reines, a priori entworfenes Rechtssystem in metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre zur Grundlage gesetzt werden. Die besonderen Erfahrungsfälle, worauf dasselbe bezogen wird, können nur in Anmerkungen erwähnt werden. In Ansehung ihrer ist kein System, sondern nur Annäherung zum System möglich.
Dis vorausgesezt wird in der vorangehenden Einleitung vor allen Dingen das Verhältnis der Vermögen des menschlichen Gemüths zu den Sittengesetzen entwickelt. Zuerst wird der Begriff des Begehrungsvermögens bestimmt. Es ist das Vermögen, durch seine Vorstellungen Ursache der Gegenstände dieser Vorstellungen zu seyn. Liegt der Bestimmungsgrund zum Handeln in dem Begehrungsvermögen selbst, nicht in dem Object desselben, ist es also ein Begehrungsvermögen nach Begrif-/148/fen, so heißt es ein Vermögen, nach Belieben zu thun und zu lassen. Ist es mit dem Bewußtseyn des Vermögens seiner Handlung zu Hervorbringung des Objects verbunden, so heißt es Willkühr. Ohne dieses Bewußtseyn ist der Act desselben ein Wunsch. Das Begehrungsvermögen endlich, dessen innerer Bestimmungsgrund in der Vernunft des Subjects angetroffen wird, ist der Wille. Er unterscheidet sich von der Willkühr darinn: diese ist mit Bewußtseyn verbundenes Begehrungsvermögen in Beziehung auf die Handlung betrachtet; der Wille ist es in Beziehung auf den Bestimmungsgrund der Willkühr zur Handlung. Er hat vor sich eigentlich keinen Bestimmungsgrund, sondern ist, sofern sie die Willkühr bestimmen kann, die practische Vernunft selbst.
Die menschliche Willkühr wird durch Antriebe afficirt, nicht bestimmt. Sie ist für sich nicht rein; sie kann aber aus reinem Willen bestimmt werden. Nur von ihr kann gesagt werden, daß sie frey sey. Denn der Wille eines vernünftigen Wesens, oder die practische Vernunft, ist immer mit sich selbst übereinstimmend und nothwendig. „Handle nach einer Maxime, die zugleich als allgemeines Gesez gelten kann“, ist der oberste Grundsaz seiner Gesezgebung.
Selbst die Freyheit der Willkühr kann nicht durch das Vermögen der Wahl, für oder wider das Gesez zu handeln, definirt werden. Was beym Menschen als Phänomen geschieht, erklärt den theoretisch gar nicht darstellbaren Begriff der Freyheit des Menschen als intelligiblen Wesens keineswegs. Nur im practischen Gebrauch beweist der transcendente Begriff der Freyheit seine Realität durch practische Grundsäze, die als Geseze eine Causalität der reinen Vernunft, und einen reinen, von allen empirischen Bedingungen unabhängigen Willen in uns darthun, in welchem die sittlichen Begriffe und Geseze ihren Ursprung haben. So bestimmt sich nun der Begriff der Freyheit der Willkühr negativ: als die Unabhängigkeit ihrer Bestimmung durch sinnliche Antriebe, positiv: als das Vermögen der reinen Vernunft, für sich selbst practisch zu seyn.
/149/ Die Geseze der Freyheit sind moralisch. Gehen sie blos auf äussere Handlungen und deren Gesezmäsigkeit, so sind sie juridisch; fordern sie, daß sie sie selbst die Bestimmungsgründe des Willens seyn sollen, so sind sie ethisch. Jene Geseze beziehen sich blos auf die Freyheit im äussern, diese auf die Freyheit im äussern und innern Gebrauch. Immer aber ist die Gesezgebung der Vernunft für die Freyheit von aller Erfahrung unabhängig, geht einzig aus ihr selbst hervor. Macht sie eine Handlung zur Pflicht, und die Pflicht zur Triebfeder der Handlung, so ist sie ethisch; schließt sie die Pflicht nicht mit als Triebfeder ein, läßt sie noch eine andere Triebfeder, als die Idee der Pflicht selbst zu, so ist sie juridisch. Uebereinstimmung einer Handlung mit dem Gesez aus der Triebfeder der Pflicht ist Moralität – ohne Rüksicht auf die Triebfeder Legalität.
Rechtslehre und Tugendlehre unterscheiden sich also nicht sowohl durch ihre verschiedenen Pflichten, als vielmehr durch die Verschiedenheit der Gesezgebung, welche die eine oder die andere Triebfeder mit dem Gesez verbindet. Die Ethick hat neben ihren besonderen Pflichten (z. B. denen gegen sich selbst) auch mit dem Rechte Pflichten gemein, aber nur die Art der Verpflichtung nicht. Nur auf äussere Handlungen (d. h. ohne Hinsicht auf ihre Triebfeder) beschränkt sich die juridische Gesezgebung. Sie sezt fest, was ist Recht und Unrecht; und der oberste eingetheilte Begriff bey dieser Unterscheidung ist der Act der Willkühr.
Was ist denn nun aber Recht? diese Frage sezt bey Rechtsgelehrten in gleiche Verlegenheit, wie die: was ist Wahrheit? den Logiker. Er mus alle empirische Principien verlassen, und die allgemeinen Criterien dieses Begriffs in der blossen Vernunft aufsuchen.
Der Begriff des Rechts, sofern es sich auf eine ihm correspondirende Verbindlichkeit bezieht, betrifft 1) nur das äussere practische Verhältnis einer Person gegen eine andere, deren Handlungen als Facta mittelbar oder unmittelbar Einfluß aufeinander haben können; 2) bedeutet er nicht das Verhältnis der Willkühr auf den Wunsch /150/ oder auf das blosse Bedürfnis des Andern, wie etwa in den Handlungen der Wohltätigkeit oder Hartherzigkeit, sondern lediglich auf die Willkühr des Andern; 3) kommt in diesem Verhältnis der Willkühr nicht die Materie der Willkühr, der Zweck, den ein Jeder mit dem Object, das er will, sich vorsezt, sondern blos die Form desselben in Betrachtung. Es fragt sich einzig: ist die Willkühr frey? und läßt sie sich bey der Handlung des Einen mit der Freyheit des Andern nach einem allgemeinen Gesez vereinigen?
So bildet sich der Begriff von Recht. Im objectiven Sinn ist dasselbe „der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die Willkühr des Einen mit der Willkühr des Andern nach einem allgemeinen Gesez der Freyheit zusammenvereiniget werden kann.“ (S. XXXIII.)
Das allgemeine Princip des Rechts ist: „eine jede Handlung ist recht, die oder nach deren Maxime die Freyheit der Willkühr eines Jeden mit Jedermanns Freyheit nach einem allgemeinen Geseze zusammen bestehen kann.“
Und so ist also Recht im subjectiven Sinn „jede Bestimmung meines Zustandes, der mit der Freyheit von Jedermann bestehen kann.“ Besteht meine Handlung, mein Zustand nach dieser Probe, so thut der mir Unrecht, der mich darinn stört, denn dieses Hindernis kann mit der Freyheit nach allgemeinen Gesezen nicht bestehen. Aber nach allgemeinen Gesezen kann Zwang, als Widerstand gegen Hindernisse des nach den nemlichen Gesezen mir zukommenden Gebrauchs der Freyheit gedacht werden. Und so wird also der angegebene subjective Begriff des Rechts gleichbedeutend mit der Definition seyn, daß dasselbe das Vermögen sey, Andere zu ver[p]flichten.
Aber diesen Begriff des Rechts leiten wir einzig und nothwendig aus dem moralischen Imperativ her. Nur durch diesen kennen wir unsere eigene Freyheit; von dieser gehen alle moralische Geseze, alle Rechte und Pflichten aus; und ohne jenen pflichtgebietenden Saz können wir das Vermögen, Andere zu verpflichten, d. i. den Begriff des Rechts nirgends herleiten. (S. XLVIII.)
/151/ Von diesem Rechtsbegriff, der auf ein Verhältnis freyer wesen gegen einander sich bezieht, von dem Recht der Menschen ist das Recht der Menschheit in unserer eigenen Person verschieden, das Recht, nie blosses Mittel zum Zweck Anderer, sondern immer zugleich Zweck für sie zu seyn; dessen Gebrauch ich zwar, ohne die rechtmäßige Freyheit Anderer zu stören, aufgeben kann, zu dessen Entsagung ich aber nach allgemeinen Gesezen so wenig gezwungen werden kann, als zur Fortsezung eines diesem Recht der Menschheit in mir zuwiderlaufenden Verhältnisses (S. XLIII.).
Aus dem categorischen Imperativ aber, der mir gebietet, die Menschheit in meiner sowohl als in der Person jedes Andern jederzeit zugleich als Zweck, nie blos als Mittel zu behandeln, entspringt die gedoppelte Nothwendigkeit: die Zwecke Anderer so wie meinen Selbstzweck nicht zu zerstören, jene so wie diesen, thätig zu befördern. Das Leztere ist unvollkommene, ist Tugendpflicht; das erstere zu thun ist vollkommene, ist Rechtspflicht. Die besonderen Geseze, wodurch die Rechtspflichten bestimmt werden, theilen sich unter der Leitung folgender Grundsäze ein:
- „1)
- Sey ein rechtlicher Mensch, (honeste vive) behaupte deinen Werth als Mensch gegen Andere. (Lex justi.)
- 2)
- thue Niemanden Unrecht (neminem laede) und solltest du auch darüber aus aller Verbindung mit Andern herausgehen, und alle Gesellschaft meiden müssen (Lex juridica.)
- 3)
- tritt, wenn du das Leztere nicht vermeiden kannst, in eine Gesellschaft mit Andern, worinn Jedem das Seine gegen jeden Andern gesichert seyn kann (suum cuique tribue. Lex justitiae.)“ (S. XLIII.)
Sofern nun aber lediglich vom Verhältnis freyer Wesen zu einander, von eingentlichen Rechten der Menschen die Rede ist, so können dieselbe eingetheilt werden:
- als systematische Lehren: in das Naturrecht, das auf lauter Principien a priori beruht, und in das /152/ positive (statutarische), was aus dem Willen eines Gesezgebers hervorgeht;
- als (moralische) Vermögen Andere zu verpflichten: in das angebohrne, und das erworbene Recht. Jenes kommt ohne allen rechtlichen Act jedem von Natur zu; zu diesem wird ein rechtlicher Act erfordert. Das angebohrne ist nur ein einziges. Freyheit Unabhängigkeit von eines Andern nöthigender Willkühr, sofern sie mit jedes Andern Freyheit nach einem allgemeinen Gesez bestehen kann, ist dieses Recht. Alle andere sogenannte angebohrne Rechte sind in diesem höheren Rechtsbegriff als Glieder der Eintheilung enthalten.
Soll aber das Naturrecht selbst in dem so eben angegebenen Sinne wiederum eingetheilt werden, so kann die oberste Eintheilung desselben in das natürliche und gesellschaftliche, keineswegs als richtig angenommen werden. Im Naturstande gibt es selbst Gesellschaften, als die elterliche, die ehliche; folglich ist der gesellschaftliche Zustand dem Naturzustande nicht entgegengesezt. Richtiger wird das Naturrecht in das natürliche und in das bürgerliche, oder in das Privat- und öffentliche Recht eingetheilt.
Diese Eintheilung legt nun auch Herr Kant zum Grunde, und handelt in der allgemeinen Rechtslehre erstem Theil das Privatrecht, oder die Lehre vom äusseren Mein und Dein überhaupt ab. Im ersten Hauptstück: von der Art, etwas Aeusseres als das Seine zu haben, wird der Begriff des Rechtlich-Meinen (meum juris) also vorangesezt: „es ist dasjenige, womit ich so verbunden bin, daß der Gebrauch, den ein Anderer ohne meine Einwilligung von ihm machen möchte, mich lädiren würde.“ (S. 55.) Wie ist nun aber dieses Rechtlich-Meine möglich? Diese Möglichkeit beruht auf dem Postulat der practischen Vernunft, wodurch sie sich a priori erweitert, daß es nothwendig sey, einen jeden Gegenstand meiner Willkühr als objectiv-mögliches Mein oder Dein anzusehen und zu behandeln. Eine Maxime, nach welcher, wenn sie Gesez würde, /153/ ein Gegenstand der Willkühr an sich herrenlos werden müßte, ist widersprechend. Es würde Aufhebung der Willkühr durch die Freyheit seyn, wenn ich das, was ich zu gebrauchen physisch die Macht habe, was also Gegenstand meiner Willkühr ist, rechtlich nicht gebrauchen dürfte; wenn also brauchbare Gegenstände ausser aller Möglichkeit des Gebrauchs versezt würden. Durch dieses Postulat gibt die practische Vernunft uns die Befugnis, (die wir aus blossen Begriffen vom Rechte überhaupt nicht herausbringen könnten,) allen Andern eine Verbindlichkeit aufzuerlegen, die sie sonst nicht hätten, sich des Gebrauchs gewisser Gegenstände unserer Willkühr zu enthalten, weil wir sie zuerst in Besiz genommen haben.
Dieser ist die subjective Bedingung der Möglichkeit des Gebrauchs. Er kann ein sinnlicher, (possessio phænomenon), und kann ein blos intelligibler Besiz ohne Inhabung (possessio noumenon) seyn. Immer muß jedoch zu dem äussern Mein und Dein ein intelligibler Besiz als möglich vorausgesezt werden.
Wie ist denn nun aber dieser blos rechtliche Besiz möglich? diese Frage ist noch nicht aufgelöst, und beruht auf der höheren allgemeinen Frage: wie ist ein synthetischer Rechtssaz a priori möglich?
Der Saz, daß derjenige, welcher mich in meinem empirischen Besiz, in meiner Inhabung stört, meine Freyheit nach einer Maxime einschränke, die mit dem allgemeinen Axiom des Rechts nicht bestehen kann, ist blos analytisch; er geht nicht über das Recht einer Person in Ansehung ihrer selbst hinaus. Dagegen geht der Saz von der Möglichkeit des Besizes einer Sache ausser mir, nach Absonderung aller Bedingungen des empirischen Besizes im Raume und in der Zeit über jene einschränkende Bedingungen hinaus. Er gründet sich auf das obige Postulat der practischen Vernunft, jeden Gegenstand meiner Willkühr als objectiv-mögliches Mein oder Dein anzusehen und zu behandeln. Wenn es nun also nothwendig und Rechtspflicht ist, gegen Andere so zu handeln, daß das Aeussere (Brauchbare) auch das Seine von irgend Jemand werden könne, dieses aber ohne einen nicht phy-/154/sischen Besiz nicht gedacht werden kann, so mus auch die intelligible Bedingung eines blos rechtlichen Besizes möglich seyn; wenn gleich diese Möglichkeit für sich selbst nicht bewiesen oder eingesehen werden kann, weil dieser Besiz ein Vernunftbegriff ist, dem seine Anschauung correspondirend gegeben werden kann, sondern nur als nothwendige Folge aus jenem Postulat unmittelbar entspringt.
So kann nun also erst zu der oben gegebenen Nominaldefinition des äussern Mein und Dein die Realerklärung hinzugesezt werden, daß es dasjenige sey, in dessen Gebrauch mich zu stören Läsion seyn würde, ob ich gleich nicht im Besiz desselben (nicht Inhaber des Gegenstandes) bin. Hier aber, wo vom Besiz von Gegenständen der Willkühr die Rede ist, werden sie in practischer Rüksicht als Dinge an sich, nicht blos als Erscheinung, betrachtet, und sind so zu betrachten, weil es nicht um theoretische Erkenntnis der Natur der Dinge an sich, sondern nur um Bestimmung der Willkühr in Hinsicht auf ihre Gegenstände zu thun ist.
Auf diese Gegenstände der Erfahrung mus der Vernunftbegriff eines intelligiblen Besizes angewandt werden. Diß geschieht durch den Uebergang auf den reinen (von allen Raums- und Zeitbestimmungen abgezogenen) Verstandesbegriff eines Besizes überhaupt, eines Habens; nicht der Inhabung.
Der äussere Gegenstand, als von mir unterschieden, mus als in meiner Gewalt gedacht werden. Er ist mein, weil mein Wille sich zu dem Gebrauch desselben dem Gesez der äusseren Feyheit gemäs bestimmt, ist mein durch die blos rechtliche Verbindung meines Willens mit ihm, unabhängig von meinem Verhältnis zu dem Gegenstand im Raume und in der Zeit. Durch den Act meines Willens, als einer allgemeingeltenden Gesezgebung, die in dem Ausdruck enthalten ist: „dieser Gegenstand ist mein“, lege ich allen Andern die Verbindlichkeit auf, die sie sonst nicht hätten, sich des Gebrauchs derselben zu enthalten.
Die äusseren Gegenstände meiner Willkühr können nur drey seyn: 1) eine körperliche Sache ausser mir; 2) /155/ die Willkühr eines Andern zu einer bestimmten That (præstatio); 3) der Zustand eines Andern im Verhältnis auf mich. Davon, daß ich eine Sache im Raume und in der Zeit definire oder nicht, hängt schlechterdings das Mein in derselben nicht ab. Eben so verhält es sich mit dem acceptirten Versprechen. Der Act des übereinstimmenden Willens ist an keine Zeitbestimmung, an keine Zwischenzeit zwischen Zusage und Annahme geknüpft. Eben dis gilt auch von dem rechtlichen Besiz einer Person, weil ein rechtliches Verhältnis, das sie verknüpft, durch örtliche Trennung nicht gehoben wird.
Indem ich nun aber erkläre, daß Etwas mein seyn soll, so lege ich jedem Andern die Verbindlichkeit auf, sich des Gegenstandes meiner Willkühr zu enthalten; aber ich bekenne mich auch dadurch gegen jeden Andern zu gleicher Enthaltsamkeit verbunden. Allein diese wechselsweise Sicherheit, die aus der allgemeinen Regel des äussern Rechtsverhältnisses hervorgeht, kann einzig durch einen gemeinsamen und Machthabenden Willen festgestellt werden. Dieser Zustand unter einer allgemeinen äussern (d. i. öffentlichen) mit Macht begleiteten Gesezgebung ist der bürgerliche. Und nur in diesem ist ein ä...
Inhaltsverzeichnis
- Title Page
- Copyright
- Contents
- Teil I: Einleitung
- Teil II: Rezensionen zur ersten Auflage der Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre (1797)
- Teil III: Rezensionen zu den Erläuternden Anmerkungen zu den Metaphysischen Anfangsgründen der Rechtslehre (1798)
- Teil IV: Rezensionen zur zweiten Auflage der Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre (1798)
- Teil V: Rezension der lateinischen Übersetzung der Metaphysischen Anfangsgründe der Rechtslehre (1799)
- Teil VI: Kantkommentare und weitere zeitgenössische Quellen
- Teil VII: Beiträge
- Personenregister
- Sachregister