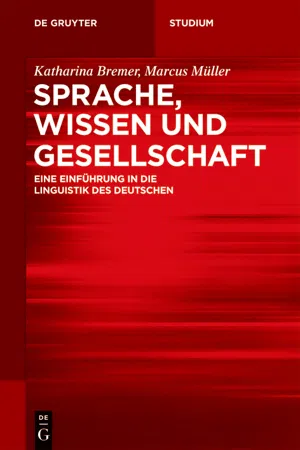1.3 Der Spracherwerb des Kindes als Teil seiner kognitiven und sozialen Entwicklung — 13
Die Komplexität der menschlichen Sprache – und damit aller menschlicher Einzelsprachen – setzt eine besondere Denkfähigkeit voraus, die uns auch von intelligenten Primaten noch deutlich unterscheidet. Menschliches Denken ist umgekehrt eng verwoben mit Sprachfähigkeit, und beides wiederum nicht zu trennen von den besonderen Kooperationsformen, die unsere Kultur entwickelt hat. Die These ist also: Menschsein, Gesellschaftlichkeit, Sprache und Geist sind nicht zu trennen. Sie bedingen einander und das lässt sich über den ganzen Verlaufsprozess der historischen Entwicklung verfolgen. Jürgen Habermas hat diesen Gedanken sehr prägnant ausgedrückt: „Erst in der Öffentlichkeit einer Sprachgemeinschaft entwickelt sich das Naturwesen zugleich zum Individuum und zum denkenden Menschen.“ (2001: 65)
Das folgende Kapitel wird den für unsere menschliche Eigenart kennzeichnenden Zusammenhang zwischen Sprache, Denken und Sozialität aus drei Perspektiven beleuchten. Die phylogenetische Perspektive verfolgt die Entwicklung von Sprache aus dem Blickwinkel der Evolution des Menschen (1.1). Der zweite Teil widmet sich der Frage, wie Sprache als spezifischer Typ eines mächtigen Systems von Symbolen beschrieben werden kann (1.2). Der dritte Abschnitt verfolgt die Verbindung von Menschsein und Sprache unter dem ontogenetischen Blickwinkel: Hier geht es um die Frage, wie das einzelne menschliche Kind Sprache erwirbt, welche Fähigkeiten dabei vorausgesetzt sind und welche neuen Möglichkeiten es dadurch andererseits hinzugewinnt (1.3).
1.1 Der Wandel von Kooperationsformen und die Entstehung von Kultur
Direkte Zeugnisse zu den Ursprüngen von Sprache beim modernen Menschen sind uns nicht zugänglich. Allerdings ist die Entwicklung des menschlichen Zusammenlebens durch Ausgrabungen erforscht worden, die auch auf die Evolution der Sprache Rückschlüsse zulassen. So interpretieren Anthropologen z. B. aufwändige Grabstätten als Beleg für eine entwickelte Kultur, die mythische Vorstellungen zu einem Leben nach dem Tod pflegt – und diese Tradition von Generation zu Generation weitergibt. Das ist ein Prozess, der ohne Sprache kaum vorstellbar ist (vgl. Müller 1997). Andere wichtige Indizien für den Beginn einer Sprache sind die Zunahme des Gehirnvolumens, das aufgrund jeweils gefundener Schädel errechnet werden kann; oder die Absenkung des Kehlkopfs, die Voraussetzung dafür war, dass frühe Menschen – anders als andere Primaten – die ganze Palette menschlicher Sprachlaute produzieren konnten. Auf der Basis solcher Ergebnisse wird geschätzt, dass die Entwicklung einer menschlichen Sprache vor ca. 120.000 Jahren begonnen haben könnte. Erste schriftliche Symbolverwendungen in Höhlenzeichnungen werden dagegen deutlich jünger datiert; sie liegen nur ca. 40.000 Jahre zurück.
Im Vergleich selbst zu „nahen Verwandten”, v. a. den großen Primaten wie Schimpansen und Orang-Utans, hat sich die Intelligenz der Menschen in dieser Zeit in unvergleichbarer Weise weiterentwickelt. Wie ist das zu erklären? Anthropologen haben auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage bei beiden Spezies die spezifischen Kommunikationsfähigkeiten untersucht (vgl. Tomasello 2011; 2014). Sie können auf der Basis ihrer Ergebnisse inzwischen eine nachvollziehbare Hypothese für einen wahrscheinlichen Verlauf vorschlagen. Danach haben sich die Unterschiede in Bezug auf Kooperationsformen, Sprache und Denkfähigkeit während eines langen Zeitraums in zwei großen Entwicklungsschritten herausgebildet.
Der erste Schritt ergab sich aus der Notwendigkeit, bei der Nahrungssuche zu zweit oder in kleinen Gruppen zusammenzuarbeiten. Dadurch mussten die frühen Menschen Möglichkeiten der Kooperation mit anderen erfinden, um gemeinsame Ziele zu erreichen. Gemeinsame Ziele sind mit gemeinsamer Aufmerksamkeit in der jeweils geteilten Situation verbunden – das ist die Keimzelle geteilter Intentionalität, die nach dieser gut gestützten Hypothese allen Weiterentwicklungen von Kultur zugrunde liegt. Zur Koordinierung der Perspektiven z. B. bei der Jagd wurden zunächst in kleinen Gruppen natürliche Gesten des Zeigens verwendet, vielleicht auch Pantomime – damit sind die Anfänge symbolischer Kommunikation gelegt (vgl. unten 1.2). Auch in dieser Phase ist es beim Kommunizieren bereits erforderlich, Abschätzungen der Relevanz der jeweiligen Gesten vorzunehmen und das vom Partner konkret Gemeinte muss jeweils vor einem Hintergrund gemeinsamen Wissens aktiv erschlossen werden – das ist bereits diesen frühen Formen mit der späteren, ausgebauten Sprache gemeinsam.
Ein zweiter Schritt ergab sich mit dem Größerwerden der zusammenlebenden Gruppen, die in der Folge auch miteinander konkurrierten. So entstand ein Gruppenleben mit einer über längere Zeit geteilten Gemeinschaft der zugehörigen Menschen, die immer mehr auch ein Bewusstsein dieser Gemeinsamkeit ausbildeten – also eine Kultur. Ihre Kultur stützte sich jeweils auf einen Hintergrund von kollektiv anerkannten Konventionen, Normen und schließlich auch Institutionen. Wesentlicher Teil dieser Entwicklung war die Entstehung sprachlicher Kommunikation.
Searle (2004) entwirft zur Illustration dafür, wie sich soziale Institutionen entwickeln, das anschauliche Beispiel einer frühen Gemeinschaft, die um ihre Behausungen einen Wall baut – um Feinde fernzuhalten und die Mitglieder am Ort zu halten. Diese Steinanhäufung hat ihre Barriere-Funktion zunächst dank physischer Eigenschaften: Es wäre einfach anstrengend, sie zu überwinden. Wir können uns aber leicht vorstellen, dass der Wall im Verlauf der Zeit allmählich verfällt – bis nur noch ein paar Steine in einer Reihe übrigbleiben. Es könnte durchaus sein, dass die Bewohner diese Reste des Walls nicht anders behandeln als den ursprünglichen Wall – also seine Funktion respektieren, diese Linie als Grenze anzusehen und nicht zu überschreiten. Damit ist ein entscheidender Schritt getan: Der Wall erfüllt jetzt seine Funktion dadurch, dass die Bewohner ihn in eben dieser Rolle akzeptieren. Sie erkennen an, dass er einen spezifischen Status besitzt – und dass an diesen Status eine gewisse Funktion gekoppelt ist. Searle nennt diese Funktionen „Statusfunktionen“ und sagt darüber (Searle 2004: 151): „Ich glaube, dass dieser Schritt, der Schritt von der physikalischen Beschaffenheit hin zur kollektiven Akzeptanz einer Statusfunktion, die grundlegende begriffliche Struktur hinter institutioneller Wirklichkeit bildet.“
Ein Beispiel für die Macht dieses Prozesses in der modernen Welt ist Geld. Anders als bei anderen Gegenständen (z. B. Badewannen oder Messern) kann es seine Funktion nicht aufgrund seiner physikalischen Beschaffenheit ausüben. So war selbst zu der Zeit, als Geld noch aus Gold oder Silber gemacht wurde, der Wert der einzelnen Münze eine erst durch entsprechende Prägung verliehene Funktion. Aber sie basierte in diesem Fall noch auf dem tatsächlichen Wert des für die Münze verwendeten Materials. Das Papiergeld der Moderne hat sich davon vollkommen gelöst: „Der Schein hat als Ware keinen Wert, und er hat als Vertrag keinen Wert; es ist ein reiner Fall von Statusfunktion.” (Searle 2004: 153).
Solche Prozesse der Symbolisierung – wo sich also Menschen verabreden, dass etwas für etwas Anderes stehen soll – liegen auch der Sprache zugrunde. Wir kommen darauf in 1.2 zurück.
Sprachlichkeit und die Entwicklung des Denkens
Nach der oben dargestellten Hypothese ist vor allem die Teilhabe an geteilter, in späteren Phasen der Evolution auch kollektiver Intentionalität der Ursprung für besondere Denkprozesse, die den Menschen im Verlauf der Jahrtausende so verändert haben. Es ist damit der soziale Aspekt des Denkens, der der Macht dieser Entwicklung zugrunde liegt. Diese neuen Möglichkeiten umfassen vor allem die symbolische und damit gleichzeitig perspektivische Repräsentation von Erfahrung – indem sprachliche Zeichen als Stellvertreter für ein bestimmtes Phänomen in der Sprachgemeinschaft geteilt werden, enthalten sie auf diese Weise eine intersubjektiv vermittelte Fassung und eine besondere Sichtweise. Dazu schreibt Tomasello (2002: 126):
Der zentrale theoretische Punkt ist, dass sprachliche Symbole die unzähligen Weisen der intersubjektiven Auslegung der Welt verkörpern, die in einer Kultur über einen historischen Zeitraum hinweg akkumuliert wurden; und der Erwerb des konventionellen Gebrauchs dieser symbolischen Artefakte, und damit die Verinnerlichung dieser Auslegungen, verwandelt die Eigenart der kognitiven Repräsentationen von Kindern grundlegend.
Menschen können also mithilfe der Sprache ihre Erfahrung anders verarbeiten, als sie es sonst tun würden: Sie sind beim Miteinander-Sprechen immer wieder neu veranlasst, ihr Denken aus der Perspektive des Anderen bzw. der Anderen zu betrachten.
Mit dieser Perspektivierung ist ein weiterer zentraler Aspekt verbunden: Sprache erlaubt, Verschiedenes unter einen „Nenner“ zu bringen – also Kategorien zu bilden, indem jeweils ein Bündel von Eigenschaften der Gemeinsamkeit zugrunde gelegt wird, andere Eigenschaften des konkreten Gegenstands dagegen nicht beachtet werden. Wenn wir von Autos reden, unterscheiden wir nicht zwischen Cabrios und Lastwagen, erwarten aber von beiden, dass sie fahren und dabei mindestens Personen befördern können.
Kategorienbildung erfolgt also nicht nur auf der Basis wahrnehmbarer Unterschiede (Äpfel schmecken anders als Tomaten und sehen auch anders aus), sondern auch aufgrund von Unterschieden, die wir über unser Wissen erschließen müssen. Ihre (Rück-)Wirkung auf unser Denken zeigt sich in der Fähigkeit, abstrakte Gemeinsamkeiten und Analogien zu entdecken und Hierarchien zu entwickeln (wir kommen darauf zurück; vgl. v. a. Kap. 3 und 10).
Einige allgemeinere Charakteristika menschlicher Sprache
Die Fähigkeit zu einer ausgebauten Sprache ist also dem Menschen vorbehalten – die Fähigkeit zur Kommunikation mit Artgenossen nicht: auch Bienen und Zebras, Delphine und Ameisen verständigen sich untereinander. Solche Kommunikationssysteme werden von vielen Tierarten verwendet und zeigen erstaunliche Eigenschaften. So können Bienen über den sogenannten Schwänzeltanz eine Futterquelle nicht nur in Bezug auf Flugrichtung und Entfernung, sondern auch auf die Art und Ergiebigkeit des Futters charakterisieren. Sie geben diese Informationen im „Tanz“ über genetisch festgelegte Bewegungen und Geräusche an die anderen Sammlerinnen weiter. Das ist zwar auch ein komplexer Prozess der Kommunikation über Zeichen, er unterscheidet sich aber doch deutlich von einer Sprache im engeren Sinn. Um diesen Unterschied deutlich zu machen, wird der folgende Abschnitt zunächst drei allgemeine Eigenschaften menschlicher Sprache vorstellen, über die die Kommunikationssysteme der Tiere (soweit wir bisher wissen) nicht verfügen. Vor diesem Hintergrund gehen wir dann auf die Organisation dieses Systems von spezifischen Zeichen ein, die diese Eigenschaften möglich macht.
Versetzung
Mitteilungen auch der kommunikativsten Vier- oder Mehrbeiner beziehen sich immer auf die aktuell gegebene Situation, das „Hier-und-jetzt”. Das Miauen unserer Katze kann vielleicht verschiedene Botschaften andeuten, die wir mit der Zeit sogar unterscheiden lernen, z. B. Hunger, Freiheitsdrang oder Schmerz. Aber sein Bezugspunkt wird immer die aktuell miteinander geteilte Situation sein. Bei der Rückkehr von ihrem nächtlichen Streifzug wird sie nichts davon mitteilen können, „wie es gewesen ist”. Wenn ich dem Hund „sitz!” befehle, wird er es verstehen; aber nicht, dass diese Anweisung erst für die bevorstehende Busfahrt gelten soll. Botschaften in der menschlichen Sprache dagegen können sich nicht nur auf andere, auch weit entfernte Orte beziehen – sie können solche Orte sogar für unser geistiges Auge erst entstehen lassen. Diesen Prozess, der durch die Sprache möglich wird, nennen wir Versetzung. Sie ermöglicht, vergangene oder zukünftige Ereignisse mit der gleichen Leichtigkeit zu beschreiben wie solche in der Gegenwart. Mit der menschlichen Sprache können dank dieser Eigenschaft auch fiktive Situationen erschaffen werden, ihre Botschaften umfassen also potentiell ein ganzes Universum möglicher Welten. Sie ist dafür eingerichtet, Vorstellungsräume zu entwerfen, die ganz neue, bisher nicht gekannte Eigenschaften haben, und so unsere bisherigen Vorstellungen zu erweitern oder zu weiteren Phantasien anzuregen.
Kulturelle Übertragung
Die Haarfarbe oder die Form der Augenbrauen erben wir von unseren Eltern – die Sprache nicht. Jedes Menschenkind kann durch sein Aufwachsen in der entsprechenden Kultur jede menschliche Sprache erwerben. Das nennen wir kulturelle Übertragung. Wird z. B. ein Kind japanischer Eltern von einer Familie in Australien adoptiert, wird es im Prinzip problemlos australisches Englisch als Muttersprache lernen. Die Signale, die Tiere in der Kommunikation verwenden, werden im Grundsatz dagegen mit der genetischen Information weitergegeben – auch ein in eine andere Gemeinschaft adoptierter Hund wird als Geste der Freundlichkeit mit dem Schwanz wedeln.
Produktivität
Eine gemeinsame Eigenschaft aller Sprachen ist, dass in ihnen ununterbrochen neue, bisher nie verwendete Äußerungen produziert werden. Schon Kinder mit einem noch sehr begrenzten Wortschatz bilden daraus je nach Bedarf in kreativer Weise ihre jeweils ganz eigenen Sätze. Auch beim Bilden neuer Wörter verstehen sie schnell, welche Prinzipien dafür in ihrer Sprache vorgesehen sind und machen sie sich für neue Formen zunutze – nicht nur für Äußerungen, die sie schon gehört haben. Menschliche Sprache setzt keine Grenzen des Ausdrucks, sondern lädt dazu ein, aus zunächst einfachen Elementen immer neue, komplexere Einheiten zu komponieren. Sie ist also produktiv. Wir kommen im nächsten Abschnitt darauf zurück, über welche Eigenschaften der sprachlichen Zeichen das im Einzelnen möglich wird.
Signalsysteme der Tiere sind dagegen auf ein festes und beschränktes Repertoire festgelegt und mit einer „fixen Referenz” versehen: einem Signal entspricht in der Regel genau eine Funktion. So gibt es bei den Schwarzstirn-Springaffen einen Ruf, der vor Schlangen warnt und einen, der einen Raubvogel ankündigt. Neue Signale sind typischerweise nicht vorgesehen.
Die Produktivität der Sprachbenutzung von Menschen zeigt sich nicht nur in Bezug auf die Differenziertheit und Hörerspezifik beim Zuschneiden der Information – sie zeigt sich auch in der Vielfalt der Sprechhandlungen, die wir gegenüber unseren Gesprächspartnern äußern können (vgl. Kap. 11). Während Menschenaffen ihre absichtlichen, gelernten Gesten ausschließlich dazu einsetzen, Handlungen von anderen einzufordern, können wir z. B. eine eigene Handlung rückblickend bedauern oder zur Begründung eine Geschichte erzählen, Selbstkritik üben und ein Versöhnungsangebot machen.
1.2 Menschliche Sprache als spezifisches Zeichensystem
Allen Zeichen gemeinsam ist ihre Eigenschaft, Stellvertreter zu sein: Ein Zeichen steht für etwas Anderes. Es ersetzt dieses „Andere” temporär oder dauerhaft – und ermöglicht damit ganz verschiedene Verwendungen dieser Verweisfunktion: Soll unser Mitbewohner etwas Wichtiges nicht vergessen, könnten wir einen Zettel schreiben, aber auch ein physisches Zeichen erfinden, um an diesen Gedächtnisinhalt zu erinnern, z. B. den Einkaufskorb auf den Küchentisch stellen.
Die Wissenschaft, die sich mit Zeichen allgemein und den Prozessen ihrer Verwendung beschäftigt, ist die Semiotik. Wir können an dieser Stelle ihre Perspektive nutzen, um das Funktionieren von Wörtern transparenter zu machen. Wörter (und genaugenommen auch Morpheme, dazu Kap. 6) sind die sprachlichen Zeichen par excellence, indem sie als „Stellvertreter” für konkrete oder abstrakte Konzepte aufgefasst werden können. Ihre spezifischen Eigenschaften treten deutlicher hervor, wenn wir sie im Vergleich zu anderen Zeichentypen betrachten. Bei der Beschreibung von sprachlichen Einheiten als Zeichen ist ein Modell ganz besonders erfolgreich angewendet worden, das der amerikanische Philosoph Charles Saunders Peirce (1839–1914) eingeführt hat: Ordnet man die Zeichen nach der Art der Verknüpfung zwischen Zeichen und Bezeichnetem, lassen sich drei Typen von Relationen unterscheiden – indexikalische, ikonische und symbolische Zeichenrelationen.
Die wichtigste, weil grundlegendste Zeichenrelation ist die indexikalische: Hier stehen Zeichen und Bezeichnetes in einer „natürlichen” Beziehung, die gleichzeitig obligatorisch ist, weil sie auf einer Grund-Folge-Relation beruht. Fieber erkennt man an (oder auch: es steht für) erhöhte(r) Temperatur, Regen an nasser Straße und Feuer an der Rauchsäule am Horizont. Es ist bei näherem Hinsehen schwierig, eine auf diese Weise definierte Gruppe von Zeichen überhaupt noch z...