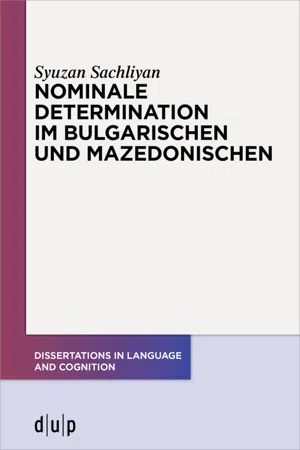1.1 Thematik
Bulgarisch und Mazedonisch sind zwei südslawische Sprachen, die zugleich dem Balkansprachbund angehören. Als Besonderheit in der slawischen Sprachfamilie haben sie die Kasusflexion fast vollständig verloren, nur bei Pronomen blieb diese erhalten. Die semantischen und syntaktischen Verbindungen zwischen Nomen und anderen Satzgliedern werden realisiert, indem die Kasusrelationen mit Präpositionen und mittels Objektreduplikation zum Ausdruck gebracht werden können und die Sätze eine rigide Struktur bekommen (Mišeska-Tomić 2006: 81 ff., 106 f.; Maslov 1956: 43). Bulgarisch und Mazedonisch sind die einzigen Standardsprachen in der slawischen Sprachfamilie, die über Artikel verfügen (vgl. Heine & Kuteva 2006)1. Deshalb kam der nominalen Determination und der Definitheit in der bulgarischen und mazedonischen Sprachtradition schon immer ein besonderes Interesse zu.
Die Verwendung des bulgarischen Definitartikels wurde sehr umfangreich unter dem Aspekt beschrieben, wann er aus syntaktischer Sicht obligatorisch, ausgeschlossen oder optional ist. Die semantischen Aspekte seiner Verwendung wurden dabei nur geringfügig analysiert. Für das Mazedonische existieren ausführlichere Arbeiten zu den semantischen Aspekten seiner Verwendung. Grund dafür ist die kontroverse Interpretation des Artikelstatus der mazedonischen Definitsuffixe.
Aus den genannten Gründen wird die vorliegende Arbeit vor dem theoretischen Hintergrund der Concept Types and Determination-Theorie (kurz: CTD-Theorie, Löbner 1985, 2011) verfasst, der ein semantischer Ansatz zugrunde liegt. Für das Bulgarische untersuche ich die Definitheit allgemein und den Gebrauch des Definitartikels. Für das Mazedonische werden im Zuge der Untersuchung der Verwendung der Definitsuffixe Schlüsse über ihren Artikelstatus gezogen.
Um eine vollständige Analyse der nominalen Determination im Bulgarischen und Mazedonischen durchzuführen, gehe ich auch der Frage nach, welche Nominalphrasen definit sind, obwohl ihre Definitheit nicht explizit gekennzeichnet wird, und welche definiten Nominalphrasen umgekehrt trotz einer expliziten Kennzeichnung auch nicht-referentiell verwendet werden können (sog. weak definites). Da in der CTD-Theorie solche NPs nur am Rande behandelt werden, ziehe ich de Swart (2015: 126–156) und Borik & Gehrke (2015: 1–43) hinzu. Ich beschränke die Untersuchung solcher NP auf Berufsbezeichnungen, Bezeichnungen von gesellschaftlichen und kulturellen Einrichtungen, von Freizeiteinrichtungen und -aktivitäten, von Feierlichkeiten, Mahlzeiten und Einkaufsmöglichkeiten. Massennomen behandle ich nicht, da bei ihnen der indefinite Gebrauch ohne Artikel den Normalfall darstellt und sich das Problem der Abgrenzung gegen weak definites nicht stellt.
Ich diskutiere in der vorliegenden Arbeit auch die Verwendungsweisen des indefiniten Artikels und den indefiniten Gebrauch von bloßen NPs im Bulgarischen und Mazedonischen, um später eine Abgrenzung zu den bloßen NPs in definiter Verwendung vornehmen zu können.
Die Arbeit ist wie folgt strukturiert. In Kapitel 2 Theoretische Grundlagen lege ich die einschlägigen theoretischen Ansätze zur Definitheit dar und bespreche sie in Hinblick darauf, welche Gebrauchsweisen für diese Ansätze problematisch sind. Ich werde argumentieren, dass die CTD-Theorie dazu beiträgt, diese problematischen Gebrauchsweisen zu analysieren und erklären. Im Anschluss daran führe ich die CTD-Theorie selbst ein und begründe, warum ich sie für die geeignetste Grundlage für die vorliegende Arbeit betrachte.
Kapitel 3 Nominale Determination im Bulgarischen und Kapitel 4 Nominale Determination im Mazedonischen sind weitgehend gleich strukturiert. Das dritte Kapitel beschreibt zunächst die Formen der bulgarischen Definitsuffixe. Ihre Verwendungsweisen werden nach der CTD-Theorie analysiert. Um das Thema Determination zu vervollständigen, diskutiere ich auch indefinite NPs mit oder ohne Indefinitartikel. Abschließend gehe ich auf bloße Nominalphrasen und Nominalphrasen mit Definitartikel in weak definite-Verwendung ein.
Das vierte Kapitel zur nominalen Determination im Mazedonischen beginnt ebenfalls mit der Behandlung definiter NPs, ausgehend von einer Formenbeschreibung und Erläuterung der Etymologie der drei Varianten von Definitsuffixen. Ich diskutiere ausführlich die Kontoverse in der Literatur zum Artikelstatus der drei Varianten und stelle meine Kritik daran dar. In diesem Zusammenhang stelle ich die Formen der zu den Artikelvarianten parallelen Demonstrativpronomen vor. Ich zeige, wie sich Demonstrativpronomen von Definitartikeln unterscheiden lassen. Im Anschluss untersuche ich die mazedonischen Definitsuffixe ebenfalls gemäß den Verwendungsweisen der CTD-Theorie (Löbner 1985, 2011) und erbringe so den Nachweis, dass es sich bei den drei Varianten tatsächlich um Definitartikel handelt – mit einer zusätzlichen deiktischen Differenzierung.
In Kapitel 5 fasse ich die Arbeit zusammen und schließe mit einem Ausblick auf weitergehende Fragestellungen, die sich aus dieser Arbeit ergeben haben.
1.2 Sprachdaten
In der vorliegenden Arbeit habe ich authentische Sprachdaten verwendet. Als Quellen habe ich zum einen Internetbeiträge von Onlinezeitungen, Foren, Portalen und Blogs herangezogen. Zum anderen benutze ich Korpusbeispiele (gekennzeichnet mit ,K‘), für das Bulgarische aus dem Bulgarian national reference corpus und für das Mazedonische aus Sketch Engine. Das bulgarische Nationalkorpus ist ausbalanciert. Es enthält über 400 000 000 Tokens. 50 % des bulgarischen Nationalkorpus sind funktionale Texte, 30 % sind Zeitungsbeiträge, 10 % sind Beiträge aus Regierungs- und Rechtstexten und 10 % aus anderen Gattungen. Da zum Zeitpunkt meiner Datenerhebung noch kein nationales, elektronisches Korpus der mazedonischen Sprache existierte, habe ich mich dazu entschlossen, wie bereits erwähnt, Sprachdaten aus dem elektronischen Korpus Sketch Engine mit 40 348 792 Tokens zu verwenden. Zusätzlich habe ich Iljoskis Bühnenstück Čorbadži Teodos aus der elektronischen Sammlung der Braḱa Miladinovci-Bibliothek in Skopje und die mazedonische Übersetzung von Orwells Roman 1984 verwendet, die mir vom Sonderforschungsbereich 991 The Structure of Representations in Language, Cognition, and Science zur Verfügung gestellt wurde.
Zur Datenerhebung habe in der vorliegenden Arbeit zusätzlich Informantenbefragungen eingesetzt. Die Informanten wurden aufgefordert, für gegebene Nominalphrasen zu entscheiden, ob eine der vorgegebenen Optionen zutreffend ist, und falls ja, welche. Für die negativen Beispiele waren ausschließlich die Sprecherurteile maßgebend. In den restlichen Fällen habe ich die Sprecherurteile mit den Sprachdaten abgeglichen.
Meine Informanten sind Muttersprachler des Bulgarischen und des Mazedonischen mit unterschiedlichem Bildungsniveau. Sie haben entweder ihre Ausbildungszeit ganz oder teilweise in Mazedonien bzw. in Bulgarien verbracht oder halten sich aktuell dort auf. Alle Beispiele sind von mir übersetzt und einheitlich glossiert worden. Die Übersetzungen wurden in Übereinstimmung mit Muttersprachlern durchgeführt. Für mögliche Fehler trage ich die Verantwortung.