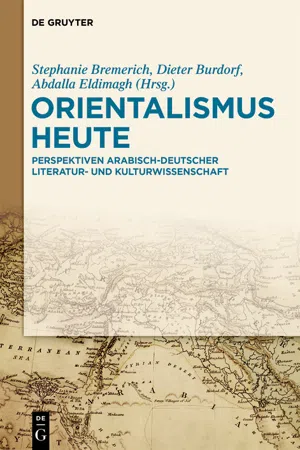„Sei ein Mann, Suleika!“
Orientalistische Objektbesetzungen in der symbolischen Imagination von Geflohenen
Die Prozeduren kultureller Fremdrepräsentationen sind, wie andere Alteritätsdiskurse auch, aufs Engste mit den Dynamiken der Selbstvergewisserung verknüpft. Wenn nichts mehr den Konsens über die Realität der Außenwelt und die Identität des denkenden Subjekts mit sich selbst garantiert, kann das Nachdenken und Reden über das Fremde und die vermeintliche Eigenart des Nicht-Identischen allzu leicht zur neurotischen Dauerbeschäftigung geraten.1 Der Versuch, die eigene Kultur durch die erstaunten Augen fiktiver Fremder zu betrachten, verfügt in Europa bekanntlich über eine lange Tradition. Im gebrochenen Spiegel imaginierter Beobachter*innen erscheint entweder das geliebte, nicht selten melancholisch-kulturpessimistisch verklärte oder aber das verhasste Selbstbild. Dass in dieser Dynamik besonders das sogenannte ,Orientalische‘ gleichzeitig den Nicht-Ort des eigenen ‚Nebenbewusstseins‘ und einen paradigmatischen symbolischen Trennungsstrich darstellt, ist allseits bekannt. Der Orient dient dabei als negative Projektion eigener Selbstkonstruktion und etabliert in seiner Differenz zugleich eine maßgebliche Ordnungsgrenze zur Regulierung westlicher Ein- und Ausschlussprozeduren: „Der Orient ist für das Abendland all das, was es selbst nicht ist.“2 Ebenso bekannt ist, dass die westliche Kultur der kolonialen Moderne von besonders expansiven und gewalttätigen Verfahren der selbstkonstituierenden Weltentzauberung geprägt ist.
Aber die historische Dynamik des Orientalismus erschöpft sich nicht in der Dialektik von Fremddarstellung und Selbstkonstruktion. Sie umfasst mehr als nur die Herstellung fremdkultureller Zeichensysteme. Die orientalisierten Anderen sind trotz des imaginierten Referenzkorpus keine bloßen Metaphern für das Fremde ohne innerweltliche Existenz. Dies wurde zuletzt im Zuge der sogenannten ,Flüchtlingskrise‘ deutlich. Von dieser Beobachtung nimmt meine Argumentation ihren Ausgang.
Die postkoloniale Revision des herkömmlichen Geltungsanspruchs europäischer Fremdrepräsentation als Darstellung mit widerspruchs- und zweckfreiem referenziellen Gehalt hat die Idee des Orients inzwischen als antagonistische Projektion und negatives Supplement normativ gesetzten Europäertums entlarvt. Doch obschon die rigorose kulturgeographische Trennung von Orient und Okzident in kritischen Wissenschaftskontexten inzwischen als obsolet gilt, ist die Autorität des orientalistischen Repräsentationssystems keineswegs gebrochen. Das gilt für wissenschaftliche Debatten ebenso wie für die Diskurse der Politik, der Werbung oder der Tourismusindustrie. Die politisch-ideologischen und soziokulturellen Extrapolationen des Orientalismus beeinflussen nach wie vor konkrete Lebensverhältnisse. Dabei trägt nicht nur das Fortschreiben des Topos in den Massenmedien zur Konservierung rassistischer und kulturessentialistischer Typologien bei. Gerade weil es unmöglich erscheint, exakt zu benennen, wie das Gebiet einzugrenzen wäre, zu dem die sogenannten ,Orientalen‘ oder die ‚orientalische‘ Kultur gehören, konnte der ebenso diffuse wie überdeterminierte Diskurs bis heute seine Wirkungsmacht in sehr verschiedenen Lebenszusammenhängen konsolidieren. Es mag also sein, dass der westliche Diskurs über den Orient primär als selbstbezüglicher Identitätsdiskurs zu deuten ist. Dennoch ist die Denunzierung fremder Reden, Gesten und Taten nicht hinreichend analysiert, solange sie nicht im historischen Spannungsfeld von materiellen Machtrelationen und Herrschaftswissen platziert wird. Trotz seiner imaginären Herkunft kann das diskursive Konstrukt des Orients als politische Kategorie, als Ordnungsmuster kultureller Differenzsetzung oder geostrategisches Planungsfeld nach wie vor enormen Anteil an der Konsolidierung und Transformation konkreter Lebensverhältnisse an sehr verschiedenen Orten erhalten. Davon sind derzeit nicht zuletzt jene Menschen betroffen, die aus den Herkunftsregionen des Nahen Ostens oder Afrikas nach Europa zu fliehen versuchen. Insofern gibt es im Kontext der aktuellen deutschen Flüchtlingsdebatte keinen Anlass, von einem anderen oder positiven Orientalismus zu sprechen. Diese Sichtweise erscheint genauso wenig plausibel wie der Versuch, Rassismus in einer positiven Variante zu denken. Der Skandal des fortwährenden orientalistischen Rassismus liegt zuvorderst nicht im Denken eines schlechthin Fremden, das nicht existiert. Das eigentliche Grauen bilden die fortwirkenden diskriminierenden Effekte orientalistischer Objektbesetzungen, obwohl die oder der orientalische Fremde von Natur niemals existiert hat.3
Im Folgenden fahnde ich nach den widersprüchlichen Konfliktmustern orientalistischer Objektbesetzungen in der symbolischen Repräsentation von Fluchtmigrant*innen. Meine Argumentation richtet sich zuvorderst auf das psychosoziale Feld des Imaginären und weniger auf die den dominanten Imaginationen vorausgehenden ereignisgeschichtlichen Wahrheiten. Mich interessieren die in den ausgemachten Konfliktstrukturen anzutreffenden Alteritätsmuster primär hinsichtlich ihrer halb- und unbewussten Anteile. Ich gehe davon aus, dass die in unserer eigenen politischen Gegenwart fortwirkenden Effekte des Orientalismus auch und besonders in der aktuellen psychologischen Dialektik von Fremddarstellung und Selbstkonstruktion zu untersuchen sind.4 Aber das orientalistische Imaginäre ist keineswegs als unwirklich oder irrelevant abzutun. So wie die imaginierten Geographien des literarisch-künstlerischen Orientalismus entscheidende ideologische Möglichkeitsbedingungen für koloniale Landnahmen darstellten, wirken auch die Imaginationen von Fliehenden und Geflohenen direkt auf politische Formen gesellschaftlichen Austausches sowie die legalistischen Kodifizierungen von (Zugehörigkeits‐)Grenzen und Einwanderungsprozeduren.
Für die jüngste deutsche Flüchtlingskrisendebatte lässt sich insgesamt ein äußerst ambivalentes Pendeln zwischen der Behauptung solidarischer Aufnahme- und zweckfreier Assimilationslust einerseits und den Machtäußerungen hierarchischer Aneignung und phobischer Abwehr andererseits beobachten. Um meine Diskussion eben dieses Pendelns in einen größeren historischen Deutungszusammenhang zu stellen, unternehme ich zunächst einen Rekurs zu Johann Wolfgang Goethe und damit zu jenem literarischen Orient-Emigranten, der selbst fast zweihundert Jahre nach seinem Tod wie wohl kein anderer als nationaler Lehrmeister eines gleichermaßen uneigennützigen wie respektvollen Orientalismus größtmöglicher dialogischer Identifikation gilt. Friedrich Nietzsches parodistische Kritik alt-europäischer Orientalismen im tropologischen Possenspiel des Zarathustra soll abschließend als polemisches Korrektiv zum goetheanischen Paradigma zweckfreier Fremdwissenslust sowie als quasi post-moralische Erinnerung an die nicht eingelösten ethischen Ansprüche unserer vorgeblich selbstlosen europäischen Flüchtlingspolitik dienen.
1 West-östliche Flucht
Beharrlich hält sich hierzulande die Behauptung, beim ,deutschen Orientalismus‘ handele es sich um einen vom vorherrschenden (neo‐)kolonialen Umgang mit außereuropäischen Kulturen deutlich abweichenden nationalen Sonderweg. Als Beleg werden regelmäßig die Arbeiten Georg Forsters, Johann Gottfried Herders, Friedrich Rückerts und Johann Wolfgang Goethes herangezogen. Besonders Goethes West-östlicher Divan5 avanciert inzwischen geradezu zu einem kulturpolitischen Programm dialogischen Verstehens und identitärer Grenzüberwindung zwischen den Kulturen.6 Schenkt man der verbreiteten These eines von den politisch-strategisch angeleiteten Repräsentationen des französischen oder britischen Kolonialismus signifikant abweichenden deutschen Orientalismus Glauben, dann ist diese zuerst im literarisch-philosophischen Diskurs des frühen 19. Jahrhundert herausgebildete nationale Variante von dem aufrichtigen Bemühen interkultureller Übersetzungen und nicht von eigennützigen Motiven kolonialer Expansion und Landnahme gekennzeichnet.7 Leo Kreutzer postuliert für Goethe noch euphemistischer einen „ungleichzeitig präkolonial[en]“ Diskurs von „erstaunlicher postkolonialer Aktualität“. Nicht aus der Außenposition imperialer Ambitionen nähere sich demnach die deutsche Geistesgröße ihrem Gegenstand, sondern im Bemühen um größtmögliche Identifikation „von innen“.8 Gemäß dieser Lesart der orientalistischen Werke Goethes, Herders und anderer deutscher Denker geht es darin zuvorderst um die Anerkennung geteilter Humanität in kultureller Vielfalt.
Sehr ähnlich argumentieren schon seit langer Zeit die Apologet*innen der deutschen Islamwissenschaft. Obschon die unter kolonialen Bedingungen generierten und zirkulierten Fremdbilder der britischen und französischen Orientalistik auch in der von den Methoden der philologischen Texterschließung und historischen Quellenkritik beherrschten deutschen Orientalistik verfestigt und erweitert wurden, gelang es den Arabist*innen und Islamwissenschafler*innen sehr lange erfolgreich, die bereits 1981 ins Deutsche übertragene Orientalismus-Studie Edward Saids zu ignorieren9 oder als unwissenschaftliches „Pamphlet“10 abzutun. Die Warnung vor einem geistigen Imperialismus halten viele Fachvertreter*innen aufgrund der historischen Spezifität der deutschen Orientalistik für unbegründet.11 Die von Said ausgelöste internationale Debatte fand in der Folge überwiegend ohne deutsche Beteiligung statt. Jene nützliche Wirkung der Orientalismus-Studie, die manche Anfang der 1980er Jahre antizipierten12, blieb in den deutschen Fachdebatten weitgehend aus, sodass bereits zehn Jahre nach dem Erscheinen von Orientalism der darin entwickelte Orientalismus-Begriff schlicht für obsolet erklärt werden konnte.13 Die Behauptung, Saids Kritik sei methodisch und inhaltlich widerlegt, avancierte inzwischen nicht nur bei deutschen Orient-Forscher*innen zu einem kaum weiter hinterfragten Axiom. Umfassende genealogische Studien zur historischen Genese und fortwirkenden Macht des akademischen und außerakademischen Orientalismus deutscher Provenienz stehen nach wie vor aus. Dabei wird regelmäßig die genuin deutsche Aneignung der islamischen Welt mit dem ebenso weit verbreiteten wie unhaltbaren Verweis auf die weitgehend ausgebliebene deutsche Kolonialerfahrung von dem Orientalismus-Verdikt freigesprochen.14 Obschon sich also hierzulande die Behauptung, beim deutschen Orientalismus handele es sich um einen nationalen, einen besseren Sonderweg, als äußerst langlebig erwies, finden sich seit geraumer Zeit vermehrt solche Stimmen aus dem Inneren und Äußeren der akademischen Disziplin, die das Unbehagen an den historisch gewachsenen Macht-Wissenskonfigurationen klar zum Ausdruck bri...