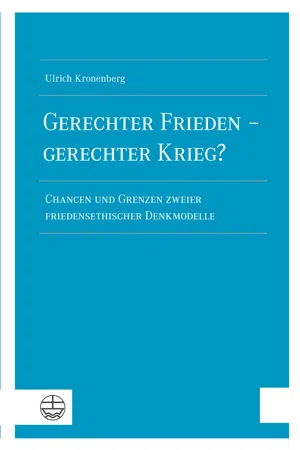![]()
1.Die Stellung der Friedensethik in der evangelischen Theologie und Kirche seit 1945
Kaum ein ethisches Thema hat seit 1945 die evangelische Kirche stärker bewegt als die Frage nach Krieg und Frieden.1 In dieser Zeit hat sich eine Friedensethik entwickelt, die die innere Entwicklung von Theologie und Kirche widerspiegelt.2 Während dieser Entwicklung entstanden zahlreiche kirchliche Initiativen wie die Gründung der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste (ASF), Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF), Forschungsstätte der evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) oder die Einrichtung des Amtes eines Friedensbeauftragten der EKD und in den Gliedkirchen der EKD. Sie alle gehören zur Friedensarbeit der EKD. Auch der 1957 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der EKD geschlossene Militärseelsorgevertrag trug dem gewandelten Denken bezüglich der an Bedeutung gewinnenden Friedensethik Rechnung3 und hat sich in den vergangenen 60 Jahren bewährt.
Nach den leidvollen Erfahrungen der beiden Weltkriege im 20. Jahrhundert begann man in Deutschland nach dem Zusammenbruch 1945, über neue Wege zum Frieden nachzudenken. Die Denkschriften der EKD zum Thema spiegeln diese Entwicklung wider. Die oft unrühmliche Rolle der Kirche in den Weltkriegen4 führte zu grundsätzlichen Überlegungen in einer Situation, die man als Nullpunkt oder Wendepunkt ansehen muss. Interessant sind dabei Aussagen und Analysen der damals führenden Theologen wie Karl Barth, Friedrich von Bodelschwingh, Otto Dibelius, Martin Niemöller, Hermann Sasse, Helmut Thielicke oder Theophil Wurm.5
Die Frage nach Krieg und Frieden bewegte Theologie und Kirche immens, als nach den erhofften neuen Möglichkeiten wieder Kriegsgefahr am Horizont auftauchte und die Welt in eine schmerzliche Blockspaltung des Kalten Krieges geriet. Der Einsatz der Atomwaffen in Hiroshima und Nagasaki im August 1945 zeigten die furchtbaren Folgen der modernen Waffentechnik auf, die ein bis dahin unvorstellbares Bedrohungspotential darstellte. Bereits im August 1948, als der Weltkirchenrat in Amsterdam zu seiner ersten Sitzung nach dem Krieg zusammentrat, drohte die Gefahr eines neuen Weltkrieges, und in dieser bedrohlichen Situation wurde der Satz formuliert, dass Krieg nach Gottes Willen nicht sein soll.6 Er wurde in den folgenden Jahrzehnten der internationalen Spannungen und der atomaren Hochrüstung zu einer Art ›Grundgesetz‹ der Friedensethik und wird bis heute vielfach verwendet.7
In der Frage der deutschen Wiederbewaffnung spielte die Friedensethik der Kirche eine wichtige Rolle.8 In der Zeit der Kubakrise, der Studentenunruhen und des Vietnamkriegeswurde die Frage erneut aufgeworfen und es kam in Theologie und Kirche zu Auseinandersetzungen.9 In der Zeit des Nachrüstungsbeschlusses wurde die Frage nach Krieg und Frieden zur Bekenntnisfrage10 erhoben und wichtige kirchliche Foren wie der Evangelische Kirchentag befassten sich in teilweise sehr erhitzten Debatten mit dieser Problematik.11 Die Hochrüstungspolitik der Supermächte und das Bedrohungspotential der Massenvernichtungswaffen atomarer, biologischer und chemischer Art führten zu fast apokalyptischen Weltuntergangsszenarien.12
Nach der Entspannungspolitik von Bundeskanzler Brandt, den Ostverträgen, den Ostermärschen für den Frieden und gegen den Nato-Doppelbeschluss, dem Ende der Ära des Kalten Krieges, dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes, dem Untergang der DDR und der deutschen Wiedervereinigung wurde die Frage nach Krieg und Frieden erneut laut. Mit dem Ende der Blockspaltung und der atomaren Hochrüstung verbanden sich viele Hoffnungen auf eine friedlichere Zukunft ohne das gewaltige Bedrohungspotential der Supermächte. In Politik und Kirche sprach man von einer Hoffnung auf eine ›Friedensdividende‹. Es war ähnlich wie nach dem Kriegsende 1945. Jedoch wurden diese aufkommenden Hoffnungen rasch zunichte, als man mit ansehen musste, wie der Jugoslawienkrieg, die Irakkriege und der Krieg in Afghanistan und die damit zusammenhängenden Folgekriege des sog. Arabischen Frühlings diese Erwartung zunichtemachten. Der Krieg in seiner gewandelten Form gewann ein neues Gesicht und stellt die Welt vor völlig neue Herausforderungen. Die Revolutionierung des Kriegsbildes ist ähnlich wie die Entwicklung durch den Einsatz von Atomwaffen am Ende des Zweiten Weltkrieges bzw. durch die atomare Bedrohung seit dieser Zeit durch die ständige technische Verbesserung der Massenvernichtungswaffen seit den 50er Jahren.
Seit 1993 werden deutsche Streitkräfte in Auslandseinsätzen eingesetzt. Besonders das ISAF-Mandat der Bundeswehr in Afghanistan stellte die Friedensethik vor neue Herausforderungen. Wenn nicht alles täuscht, ist dieser politisch eingeschlagene Weg der internationalen Militärinterventionen noch lange nicht zu Ende und die deutsche Politik wird auch in Zukunft deutsche Streitkräfte in internationale Krisengebiete entsenden.13 Die Beschlüsse des Bundestages zum Syrieneinsatz bestätigen aktuell diese Erwartung. Seit dieser Zeit ist der Rahmen der Friedensethik wesentlich erweitert, denn bis zum Ende des Kalten Krieges beschränkten sich die Einsatzräume auf das Territorium Deutschlands: Gegenwärtig sind deutsche Streitkräfte in 18 Auslandseinsätzen weltweit im Einsatz: Der Rahmen der Friedensethik ist damit globalisiert und nicht mehr auf die reine Landesverteidigung beschränkt, wie dies bis 1990 der Fall war. Auch die Bündnisverpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland haben sich in dieser Zeit gewandelt und die deutsche Politik hat dem in vielfältiger Weise Rechnung getragen.
Die EKD hat in dieser Zeit immer wieder grundsätzlich und aktuell in Denkschriften zu den Entwicklungen Stellung genommen und auf die gewandelten politischen Rahmenbedingungen reagiert.14 Die Denkschriften spiegeln die Entwicklung der evangelischen Friedensethik deutlich wider. Im Grunde genommen zeichnete sich bereits 1948 in Amsterdam die bis heute anhaltende Entwicklung ab, dass sich keine einheitliche Linie finden ließ, da die Voraussetzungen zu unterschiedlich waren.15 Der 1959 unter Federführung von Carl Friederich von Weizsäcker in den Heidelberger Thesen formulierte Kompromiss, dass es verschiedene Wege für den Christen gibt, dem Frieden zu dienen, besteht im Grunde genommen bis heute fort. Zieht man den Horizont weiter, so durchzieht die Frage nach der Kriegs- bzw. Friedensethik die gesamte Geschichte des Christentums.16 Die Formen der sog. ›neuen Kriege‹17 werfen theologisch die Frage auf, wie die Evangelische Kirche auf diese Entwicklung antworten kann und was man zu dieser Thematik zu sagen hat. Der Politologe Herfried Münkler hat darauf verwiesen, dass nach dem Ende des klassischen zwischenstaatlichen Krieges die Formen des Krieges gewechselt haben und sich das Wort von Carl von Clausewitz, dass der Krieg sich hier wie ein Chamäleon verhalte, das in neuer Form aber in alter Stärke gewandelt auftrete, traurig bewahrheitet.18 Als wesentliche Merkmale der neuen Kriege nennt er die Erweiterung der Akteure (Privatisierung), die kriminelle Gewaltökonomie und die veränderten Gewaltmotive.
Der Paradigmenwechsel vom gerechten Krieg zum gerechten Frieden
Von besonderer Bedeutung ist nach den traumatischen Kriegserfahrungen des 20. Jahrhunderts der Terminus des ›gerechten Krieges‹ geworden. Bereits 1948 in Amsterdam war dies eine wichtige Frage der zuständigen Sektion IV, die sich mit der internationalen Unordnung dieser Welt befasste.19 Die Theorie des gerechten Krieges war und ist vielen ein Dorn im Auge (Num 33,55) und ein Pfahl im Fleische (2 Kor 12,7). Mit dem Terminu...