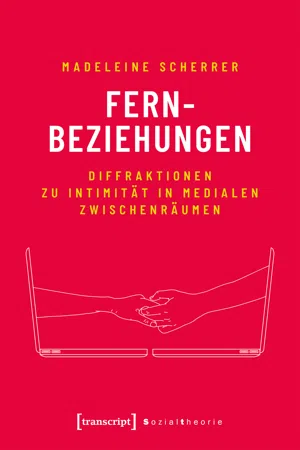
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Fernbeziehungen reproduzieren nicht nur normalisierte Vorstellungen von Intimität, sondern stellen sie zugleich infrage. Madeleine Scherrer erforscht, wie Frauen in Fernbeziehungen von vergeschlechtlichten Erfahrungen und Erwartungen berichten. Anhand theoretischer Ansätze zu Raum und Medialität zeigt sie auf, wie Fernbeziehungen als produzierte und sich überlagernde mediale Zwischenräume fungieren. Mit Rückgriff auf Karen Barads Methode der Diffraktion dekonstruiert sie normalisierte Intimitätsvorstellungen und hegemoniale dualistische Denkweisen.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Fernbeziehungen von Madeleine Scherrer im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Sozialwissenschaften & Bildung Allgemein. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Thema
SozialwissenschaftenThema
Bildung Allgemein1.Einleitung: Zur Produktion des Phänomens der Fernbeziehungen
Als Forscher wissen wir immer recht gut, woher wir kommen, […], aber wir wissen im Voraus nicht genau, wohin wir uns wenden, welchen Weg wir nehmen und wo wir uns zu einem bestimmten Augenblick befinden werden, denn um diese Positionen zu kennen und auf der Karte des Projekts einzutragen, müssten wir gefunden haben, wonach wir suchen, noch bevor wir es entdeckt hätten. […]
Natürlich können wir genau definierte Probleme voraussetzen, die bereits gelöst sind, aber wie sollten wir voraussetzen, dass eine Welt bereits konstruiert ist, deren Raum über uns hinausgeht, uns durchdringt und noch gar nicht existiert? (Serres, 2005, S. 258)
Natürlich können wir genau definierte Probleme voraussetzen, die bereits gelöst sind, aber wie sollten wir voraussetzen, dass eine Welt bereits konstruiert ist, deren Raum über uns hinausgeht, uns durchdringt und noch gar nicht existiert? (Serres, 2005, S. 258)
Das in der vorliegenden Arbeit zu untersuchende Phänomen der Fernbeziehungen ist, wie jedes andere Phänomen auch, der Untersuchung desselben nicht vorgängig. Es ist zwar möglich, zu sagen, dass es Fernbeziehungen gibt, aber diese Aussage bedeutet nicht, dass die Untersuchung von Fernbeziehungen das Phänomen ›wie es wirklich ist‹ in Erscheinung treten lässt. Stattdessen führen die theoretische wie auch die empirische Untersuchung dazu, dass das Phänomen in einer spezifischen Weise überhaupt erst hervorgebracht wird. Diese Positionierung basiert auf dem von Karen Barad ausgearbeiteten Ansatz des agentiellen Realismus, welcher den Feminist Science & Technology Studies und dem sogenannten ›New Materialism‹ zugeordnet wird. Der agentielle Realismus problematisiert grundlegende, im wissenschaftlichen Diskurs weit verbreitete Annahmen wie etwa diejenigen des ›Repräsentationalismus‹ und des Individualismus, auf denen Barad (2007) zufolge unterschiedliche Spielarten sowohl realistischer als auch sozialkonstruktivistischer Ansätze fußen (vgl. ebd., S. 42ff., 408f.). Darüber hinaus richtet sich der Fokus des agentiellen Realismus auf diskursiv-materielle Praktiken der Wissensproduktion, wobei von einer prinzipiellen Untrennbarkeit von Epistemologie und Ontologie ausgegangen wird (vgl. ebd.). Der auf diese Annahme zurückführbare Neologismus ›Onto-Epistemologie‹ bezieht sich entsprechend auf »the study of the intertwined practices of knowing and being« (ebd., S. 409; vgl. ebd., S. 185, 341; Barad, 2003, S. 829) und unter ebendiesen Vorzeichen steht auch die vorliegende Dissertation.
In dieser Einleitung ist zunächst zu klären, weshalb ich mich in meiner Arbeit mit dem Phänomen der Fernbeziehungen beschäftigt habe. Möglicherweise ist es so, wie Burckhardt (2018, S. 7) schreibt, dass ich mir als Forscherin die an diesen Forschungsgegenstand zu richtenden Fragestellungen nicht selbst ausgesucht habe, sondern dass ich stattdessen von ebendiesen Fragen »heimgesucht« (ebd.) worden und zum Schluss gekommen bin, dass sich ihnen in der Auseinandersetzung mit Fernbeziehungen besonders gut nachgehen lässt. Eine Einleitung zu schreiben bedeutet jedoch stets, einem bereits verfassten Text etwas nach- und unterzuschieben (vgl. Rheinberger, 1992, S. 9): »Ein solches Verfahren verstellt vorläufige Ansichten ebenso, wie es erlaubt, Verweisungen herzustellen, die sich erst nachträglich ergeben haben können« (ebd.; Hervorh. MS1). Die Nachträglichkeit des Verfassens einer Einleitung birgt demnach eine grundsätzliche Zwiespältigkeit (vgl. ebd.). Im Folgenden werde ich einerseits jene Fragen darlegen, die mich dazu geführt haben, mich dem Phänomen der Fernbeziehungen aus wissenschaftlicher Perspektive zuzuwenden, andererseits aber auch jene, die den Fortgang meiner Untersuchung geleitet haben. Ich versuche dabei, sowohl die Vorannahmen zu skizzieren, die diesem Projekt zugrunde liegen, als auch Verbindungslinien zwischen thematischen Aspekten des untersuchten Phänomens zu ziehen, die vor dem Untersuchungsprozess noch nicht absehbar waren und die sich erst allmählich haben ergeben können (vgl. ebd.).
Vor dem Hintergrund eines Verständnisses von Erziehungswissenschaft als kritischer Gesellschaftswissenschaft, deren zentrale Aufgabe mir unter anderem darin zu bestehen scheint, das Geflecht von Beziehungsstrukturen zwischen verschiedenen Menschen im Wechselspiel mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu untersuchen und damit zusammenhängend beispielsweise auch vorherrschende Vorstellungen von (nahen) sozialen Beziehungen zu kritisieren, drängte sich mir zu Beginn des Forschungsprozesses die Frage auf, welche Implikationen die Globalisierung2 für (nahe) soziale Beziehungen birgt. Mit dem Begriff der Globalisierung werden in wissenschaftlichen wie auch in politischen und öffentlichen Diskursen gemeinhin Prozesse bezeichnet, die einer Vision von ungehinderter Mobilität von Menschen und Kapital durch technologische Entwicklungen Vorschub leisten. Dies hat die feministische Humangeografin Doreen Massey dazu veranlasst, dieses hegemoniale Verständnis von Globalisierung, das Macht- und Herrschaftsverhältnisse ausblendet, als »economic globalisation« (Massey, 1999a, S. 15f.) zu bezeichnen. Inwiefern dieses einseitig auf ökonomische Prozesse abstellende Globalisierungskonzept problematisch ist, war mir zu Beginn des Forschungsprozesses keineswegs klar. Ich ging nicht nur davon aus, dass es so etwas wie ›Fernbeziehungen‹ wirklich gebe, sondern auch davon, dass diese Form naher sozialer Beziehungen in irgendeiner Art und Weise mit gegenwärtigen Globalisierungstendenzen einhergehe. Fernbeziehungen erschienen mir als eines der Globalisierungsphänomene schlechthin, denn ein über den ganzen Globus vernetztes kapitalistisches Wirtschaftssystem führt nicht zuletzt zu erhöhter Mobilität von denjenigen Menschen, deren Arbeitskraft sich dieses System zur Generierung von Mehrwert zu eigen macht. Daraus folgt, dass sich auch nahe soziale Beziehungen zunehmend über geografische Distanzen hinweg erstrecken, wenn Beziehungspartner_innen nicht am gleichen Ort eine Arbeitsstelle oder einen Studienplatz finden. Diese Vorannahme begründete mein ursprüngliches Interesse daran, wie Menschen ihre Fernbeziehung erfahren und welche Erwartungen sie zukünftig hinsichtlich ihrer Beziehung hegen. Das damit verbundene Ziel bestand somit in der Analyse naher sozialer Beziehungen (und im Spezifischen: Fernbeziehungen) unter der Bedingung der Globalisierung auf der Grundlage individueller Erfahrungen und Erwartungen von in solche Beziehungen involvierten Personen.
Zu Beginn des Forschungsprozesses konkretisierte sich mein Erkenntnisinteresse dahingehend, dass sich zeigte, dass Fernbeziehungen nicht unabhängig vom Begriff der Normalisierung zu untersuchen sind. Wenn beispielsweise bei Schneider (2009) in seinem Handbuchbeitrag über Distanzbeziehungen von einem »normalen Institutionalisierungsprozess von Paarbeziehungen« (S. 681) die Rede ist, womit unter anderem impliziert wird, dass Beziehungspartner_innen einen gemeinsamen Wohnsitz teilen, dann fallen Fernbeziehungen zunächst außerhalb dieses ›Normbereichs‹, denn die Ko-Residenz ist bei dieser Beziehungsform gerade nicht gegeben. Die Ausgangslage für die Auseinandersetzung mit dem Forschungsgegenstand der Fernbeziehungen scheint auf den ersten Blick relativ eindeutig zu sein, wenngleich diese Form von Beziehungen in der sozialwissenschaftlichen Forschung bislang kaum Beachtung fand (vgl. ebd.). Bei Fernbeziehungen handelt es sich den gängigen Annahmen zufolge in der Regel um nahe soziale Beziehungen zwischen zwei Personen, die über längere Zeit räumlich voneinander getrennt leben, wobei meist implizit davon ausgegangen wird, dass es sich dabei um sogenannte ›Liebesbeziehungen‹ handelt. Mit meiner Untersuchung versuchte ich, vermeintliche Eindeutigkeiten in Bezug auf die Fernbeziehungsthematik zu befragen und nachzuzeichnen, welche normalisierenden Diskurse diese Thematik durchziehen. Im Fokus standen die Fragen, wie diese Diskurse Vorstellungen dessen prägen, was überhaupt als Fernbeziehung gilt, und inwiefern diese Beziehungsform damit einhergehend als ›Spezialform‹ von nahen sozialen Beziehungen – und im Spezifischen: ›Paarbeziehungen‹ – konstituiert wird. Eine besondere Herausforderung dieses Vorhabens bestand darin, nicht a priori festzulegen, wie sich etwas verhält oder wie etwas ist, sondern gerade infrage zu stellen, weshalb etwas genau so in Erscheinung tritt bzw. treten konnte und weshalb sich genau dieses und nicht ein anderes Wissen über Fernbeziehungen konstituiert (hat). Ein Beispiel hierfür wäre die Untersuchung der Frage, wie es dazu kommt, dass bei Fernbeziehungen gemeinhin an Liebesbeziehungen gedacht wird, anstatt von vornherein zu supponieren, dass es sich bei Fernbeziehungen um Liebesbeziehungen handle.
Diese Herangehensweise entspricht einer dekonstruktivistischen Forschungshaltung im Anschluss an Derrida (1998, 2016a), bei der es darauf ankommt, keine voreiligen Bedeutungsschließungen vorzunehmen und diese gleichsam zu zementieren. Vielmehr geht es dabei um eine Offenheit gegenüber immer neuen Bedeutungsverschiebungen bei einer gleichzeitigen und kontinuierlichen Infragestellung dominanter Bedeutungen (vgl. Sandoval, 1994, S. 78). Angesichts dieser Überlegungen gilt es in der vorliegenden Arbeit, die oftmals unhinterfragt und als gegeben erachteten Bestimmungen darüber, was Fernbeziehungen sind und wie sie sich charakterisieren lassen, dekonstruktivistisch »in die Schwebe zurückzuversetzen« (Wimmer, 2016, S. 331). Damit wird nicht zuletzt der Anspruch erhoben, »die performativ erzeugten Normen und Ausschlüsse sichtbar zu machen und in Frage zu stellen« (Plößer, 2010, S. 227; vgl. hierzu auch Biesta, 1998, S. 406; Wimmer, 2016, S. 331). Des Weiteren ermöglicht es eine dekonstruktivistische Forschungshaltung, tief in hegemonialen westlichen Perspektiven verankerte »metaphysische Dichotomien wie Identität und Differenz, Einheit und Vielfalt, Innerlichkeit und Äußerlichkeit, Zeitlichkeit und Räumlichkeit, Gegenwart und Abwesenheit« (Angehrn, 2001, S. 350) zu problematisieren und zu verschieben und dabei die Unabschließbarkeit und die Instabilität von Bedeutungszusammenhängen anzuerkennen. Mit dem Fokus auf das Phänomen der Fernbeziehungen versuche ich einerseits, das ›Selbst‹ und das ›Andere‹, zwischen denen sich eine Beziehung entfaltet, zu dezentralisieren und auf diese Weise aus ihren scheinbar festen Verankerungen zu heben. Andererseits geht es mir bei dieser Fokussetzung darum, insbesondere die Dichotomien der Begriffe von Raum und Zeit sowie Gegenwart bzw. Anwesenheit und Abwesenheit zu veruneindeutigen (vgl. ebd.).
Mit der gewählten Perspektive schließe ich mich Masseys (2001b, S. 12) Aussage an, dass die Arbeit einer feministischen Wissensproduktion nicht allein darin bestehen könne, über Geschlechterverhältnisse zu forschen, sondern dass es mindestens ebenso wichtig sei, »the gendered nature of our modes of theorizing and the concepts with which we work« (ebd.) selbst zum (problematischen) Gegenstand der wissenschaftlichen Untersuchung zu erheben. Demnach muss die Wissensproduktion in mindestens zweierlei Hinsichten angegangen werden: Zum einen gilt es, das Phänomen der Fernbeziehungen auf der ontologischen und auf der ontischen Ebene – unter Berücksichtigung der Tatsache, dass diese beiden Ebenen selbst nie zur Deckung zu bringen sind bzw. dass stets eine Kluft dazwischen besteht – in den Blick zu bekommen. Gemäß Rheinberger (1992) orientiert sich hierbei »das wissenschaftliche Denken […] am Gegenstand seiner Arbeit« (S. 9) und es wird ein Wissen über das Phänomen der Fernbeziehungen hervorgebracht. Dementsprechend versuche ich in Kapitel 4, Fernbeziehungserzählungen in Spuren bzw. Spuren in Fernbeziehungserzählungen nachzuzeichnen, wobei ich Spuren als materialbezogene Konstruktionen verstehe, die aus der narrationsanalytischen Arbeit an transkribierten Gesprächen mit sich als Frauen verstehenden Menschen, die eine sich als Heterobeziehung verstehende Fernbeziehung führen, resultierten. Auf diese Weise ergeben sich empirisch fundierte Erkenntnisse zur Frage, wie die Erzählerinnen über ihre (vergeschlechtlichten) Fernbeziehungserfahrungen und die mit ihrer Beziehung zusammenhängenden Erwartungen sprechen. Zum anderen ist die epistemologische Ebene der Wissensproduktion zu bearbeiten, wobei sich das Denken »an der wissenschaftlichen Aktivität als seinem Gegenstand« (ebd.) ausrichtet. Hierbei ist zu fragen, wie das Phänomen der Fernbeziehungen in einer spezifischen Art und Weise hervorgebracht wird (bzw. wurde) und wie Wissen darüber erlangt werden kann (bzw. konnte). Dekonstruktivistisch ist dieses Vorhaben deshalb, weil damit der Anspruch verbunden ist, dass eine Auseinandersetzung mit der »Gewordenheit des Bestehenden« (Coffey, 2013, S. 15) erfolgt. Wie eingangs erwähnt, sind die Ebenen der Ontologie und der Epistemologie aus der Perspektive des agentiellen Realismus im Anschluss an Barad (2007) jedoch nicht als voneinander getrennt zu verstehen, denn »in contrast to the spectator theory of knowledge, what is at issue is not knowledge of the world from above or outside, but knowing as part of being« (S. 341).
Ähnlich wie Coffey (2013) das Anliegen ihres Dissertationsprojekts als eine Genealogie der modernen Liebesgeschichte unter Berücksichtigung des Heteronormativitätskonzepts beschreibt, geht es auch in der vorliegenden Arbeit darum, »hegemoniale Bedeutungsstrukturen« (S. 15) ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Deshalb sind Bedeutungen zu untersuchen, »die so selbstverständlich geworden sind, dass wir sie kaum mehr wahrnehmen; die so universell erscheinen, dass sie als natürlich eingestuft werden« (ebd.). Meine Fokussierung auf das Phänomen der Fernbeziehungen liegt in der Annahme begründet, dass sich spezifische – sich häufig der Aufmerksamkeit entziehende – vergeschlechtlichte, normalisierende Strukturen und Dynamiken naher sozialer Beziehungen an in bestimmten Aspekten von der Norm abweichenden, als ›Spezialform‹ etikettierten Beziehungen besonders gut zeigen lassen und sich solche Beziehungen gerade deshalb für eine Untersuchung ebendieser Strukturen und Dynamiken anbieten (vgl. Scherrer, 2015, S. 137). Diese Fokussierung auf das Phänomen der Fernbeziehungen stellt jedoch nicht einfach ein ›Kunstgriff‹ dar, der die Einnahme eines distanzierteren Blicks ermöglicht, um gemeinhin unsichtbar bleibende Strukturelemente naher sozialer Beziehungen – beispielsweise hinsichtlich der Heteronormativität – untersuchbar zu machen. Vielmehr wird damit das Ziel verfolgt, die gleichsam dichotome Stellung von ›Fernbeziehungen‹ versus ›Nahbeziehungen‹ selbst infrage zu stellen und deren (vermeintliche) Differenz zu problematisieren. Dieses Vorhaben verstehe ich als feministisches »politisches Projekt« (Coffey, 2013, S. 15), denn
[i]ndem wir die Machtstrukturen analysieren, die der Heteronormativität zugrunde liegen, und das sichtbar machen, was mit viel Aufwand immer wieder unsichtbar gemacht wird (wobei der Aufwand selbst ebenfalls unsichtbar gemacht wird), eröffnen wir ein Potenzial der Veränderbarkeit. (Ebd.)
Anders als es diese Autorin expliziert – nämlich, dass sie sich »nicht auf die Suche nach Möglichkeiten, Liebe anders zu erzählen« (ebd.), begebe – geht es mir im Folgenden durchaus auch darum, alternative Geschichten zum Phänomen der Fernbeziehungen zu generieren, um dadurch gerade die herkömmlichen Bedeutungsstrukturen, die hinsichtlich dieses Phänomens existieren, zu verschieben, das heißt, zu rekonfigurieren und zu verändern. Dies geht mit der Vermutung einher, dass sich neue Möglichkeiten von Wissensproduktionspraktiken eröffnen können, wenn »ein Wirbel aufgewühlter Erzählungen« (Tsing, 2019, S. 55) erzeugt wird, wobei diese Erzählungen »sich aus sich überlagernden und disparaten Wissens- und Seinspraktiken ergeben« (ebd., S. 214). Im Buch Der Pilz am Ende der Welt. Über das Leben in den Ruinen des Kapitalismus führe Tsing (2019) den Leser_innen die Kraft von Geschichten vor Augen, wie Haraway (2016, S. 37) festhält, und sie zeige »in the flesh how it matters which stories tell stories as a practice of caring and thinking« (ebd.). Die Aussagen dieser beiden Autorinnen zum Erzählen von Geschichten lassen sich dahingehend zusammenfassen, dass das Erzählen eine Praxis des Sorgens (im Sinne des Sorgsamseins) und Denkens sei (vgl. ebd.), wobei sich Erzählungen selbst aus Praktiken des Seins und des Wissens (vgl. Tsing, 2019, S. 214) konstituierten. Diese unterschiedlichen, mit dem Erzählen einhergehenden Praktiken scheinen eng miteinander verbunden zu sein, wodurch sich die Grenzen der (vermeintlich) klar voneinander trennbaren Bereiche des Seins, des Wissens, des Denkens und des Sorgens verflüssigen. Für die andere Seite von Erzählungen, das heißt jene des Zuhörens, stellt Haraway (2016) des Weiteren Folgendes heraus: »The risk of listening to a story is that it can obligate us in ramifying webs that cannot be known in advance of venturing among their myriad threads« (S. 132). Sowohl das Zuhören als auch das Erzählen von Geschichten bergen angesichts dieser Überlegungen vielfältige Herausforderungen, die etwa die (ethischen) Fragen nach dem verantwortlichen Umgang mit dem Unvorhersehbaren, dem Unbekannten und dem Ungewissen betreffen (vgl. ebd.).
Über das Zuhören und Erzählen von Geschichten hinaus ist auch der Forschungsprozess an sich stets von Ungewissheiten begleitet, denn es ist unmöglich, von vornherein absehen zu können, wohin genau dieser Prozess führen wird und welche Wege dabei einzuschlagen sein werden. Dabei folge ich Rheinberger (1992), der das Paradoxon der Formulierung eines ›Forschungsziels‹ darin begründet sieht, »etwas zu produzieren, das definitionsgemäß nicht in einer ›ziel‹-gerichteten Weise produziert werden kann. Das Unbekannte ist etwas, das nicht geradlinig angesteuert werden kann, weil man eben nicht weiß, was man ansteuern soll« (S. 54). Eingangs habe ich versucht, zu erläutern, welche Fragen sich mir zu Beginn des Forschungsprozesses in Bezug auf das Phänomen der Fernbeziehungen gestellt hatten und welches die ursprünglichen Ausgangspunkte der vorliegenden Arbeit waren, von denen aus sich mein Erkenntnisinteresse fortan konkretisierte. Wenngleich also das Anstreben eines genau bestimmten und eingegrenzten Forschungsziels, auf welches dann jedwede Forschungstätigkeit direkt ausgerichtet wird, als paradoxes Unterfangen angesehen werden muss, bedeutet dies nicht, dass keine forschungsleitenden Fragen zu formulieren wären. Solche Fragen sind auch für ein offenes Projekt mit ungewissem Ausgang unabdingbar, denn sie stellen während des zuweilen verworrenen Forschungsprozesses Orientierungspunkte dar, die dabei helfen, sich nicht allzu stark zu verzetteln und abzuschweifen – auch wenn nicht bestritten werden kann, dass manche Abschweifungen und Umwege durchaus produktiv sein können und zu neuen, unerwarteten Einsichten führen. Die erste forschungsleitende Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet wie folgt:
Wie lassen sich am Phänomen der Fernbeziehungen (vergeschlechtlichte) Erfahrungen und Erwartungen von Frauen in Bezug auf ihre Beziehung untersuchen?
Diese Frage bezieht sich auf methodologische und methodische Problemstellungen auf der empirischen Gegenstandsebene der Wissensproduktion. Dabei wird zu klären sein, welchen Stellenwert individuelle Erzählungen von Frauen, die sich in einer Fernbeziehung befinden, haben können und wie die Erkenntni...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Inhalt
- Dank
- 1. Einleitung: Zur Produktion des Phänomens der Fernbeziehungen
- 2. Normalisierungen: Fernbeziehungen als ›Spezialform‹ von Paarbeziehungen
- 3. Methodologie und Methode I: Narrative Interviews und Narrationsanalyse
- 4. Fernbeziehungserzählungen in Spuren – Spuren in Fernbeziehungserzählungen
- 5. Intermezzo: Ausblick auf die theoretischen Schnitte
- 6. Theoretischer Schnitt I: Raum
- 7. Theoretischer Schnitt II: Medialität
- 8. Methodologie und Methode II: Diffraktion
- 9. Das Phänomen der Fernbeziehungen in Diffraktionsmustern
- 10. Zum Schluss: Relationalität im Dazwischen – Rekapitulation und Implikationen
- Literatur