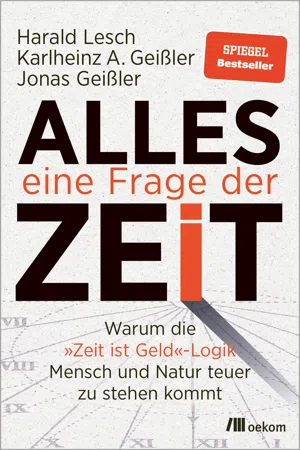
eBook - ePub
Alles eine Frage der Zeit
Warum die »Zeit ist Geld«-Logik Mensch und Natur teuer zu stehen kommt
- 272 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Alles eine Frage der Zeit
Warum die »Zeit ist Geld«-Logik Mensch und Natur teuer zu stehen kommt
Über dieses Buch
»Klimakrise, Artensterben, Burn-out? Alles eine Frage der Zeit!« Harald Lesch
Zeitnot und Hektik prägen unsere Gesellschaft. Gemäß dem Motto »Zeit ist Geld« kämpfen wir gegen alles Langsame, Bedächtige oder Pausierende, oft bis zur Erschöpfung. Dafür zahlt auch die Natur einen hohen Preis: Unsere Nonstop-Gesellschaft forciert die ökologische Krise. Was die Natur in Jahrtausenden erzeugt hat, wird in kürzester Zeit »verwertet«, ja regelrecht verbrannt.
Offensichtlich müssen wir uns die Sache mit der Zeit noch einmal genauer anschauen. Das haben sich der Physiker und Philosophieprofessor Harald Lesch, der Zeitexperte Karlheinz A. Geißler und der Zeitberater Jonas Geißler vorgenommen. Das Trio erklärt unterhaltsam, was Zeit eigentlich ist, wie sich unser Zeitverständnis im Lauf der Jahrhunderte geändert hat und warum uns die Zeit so oft fehlt – obwohl doch ständig neue nachkommt.
Ein Buch, das die wichtigsten Zeitfragen beantwortet, auch die nach mehr Zeitwohlstand und einem Leben in besserem Einklang mit den Rhythmen der Natur.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Alles eine Frage der Zeit von Harald Lesch,Karlheinz A. Geißler,Jonas Geißler im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Politik & Internationale Beziehungen & Politische Freiheit. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Kapitel 1 Die Krisen der Gegenwart |  |
»Unsere Zeit«, die Gegenwart, ist wie keine andere von ökologischen Krisen gezeichnet. Schon vor der Corona-Krise, und vermutlich noch lange nach ihr, dominiert das Wort »Krise« die täglichen Nachrichten.
Laut Wikipedia bezeichnet eine Krise im Allgemeinen einen Höhepunkt oder Wendepunkt einer gefährlichen Konfliktentwicklung in einem natürlichen oder sozialen System, dem eine massive und problematische Funktionsstörung über einen gewissen Zeitraum vorausging, die eher kürzer als länger andauert. Die mit dem Wendepunkt verknüpfte Entscheidungssituation bietet in der Regel sowohl die Chance zur Lösung der Konflikte als auch die Möglichkeit zu deren Verschärfung. Dass es sich hierbei um einen Wendepunkt handelt, kann jedoch oft erst festgestellt werden, nachdem die Krise abgewendet oder beendet wurde. Nimmt die Entwicklung hingegen einen dauerhaft negativen Verlauf, so spricht man von einer Katastrophe.
So weit, so gut. Dann machen wir doch mal einen Spaziergang durch das Gruselkabinett moderner Gesellschaften, die sich so sicher sind, dass alles immer verfügbar ist: Energie, Materie und Umwelt.
Die Krise der Energie
Im Westen, in den industrialisierten Gesellschaften, die am deutlichsten von der Globalisierung profitieren, sind wir Meister darin, ökologische Katastrophen zu verdrängen. Das fällt uns (noch) leicht, denn wir lösen die Katastrophen mit unserem Lebensstil woanders aus. Dieses »Woanders« ist meistens weit weg, irgendwo in Afrika, Südamerika oder Asien. Manchmal auch auf den Ozeanen zwischen den Kontinenten. Wie wir das tun? Nun, indem wir mit unserem Lebensstil in einem Ausmaß Energie verbrauchen, wie man es sich kaum vorzustellen vermag. Nur um mal einen Eindruck zu gewinnen: Wer auf einem Fahrradergometer zehn Stunden lang 100 Watt gestrampelt hat, hat gerade einmal eine Kilowattstunde an Energie freigesetzt. Die Deutschen verbrauchen jeden Tag und pro Person aber über 100 Kilowattstunden an Energie!
In dieser Energiemenge steckt alles, was wir tun: wie wir heizen, wie wir uns bewegen, wie wir kommunizieren, die Industrieproduktion, alles. Unsere Art des Wohnens, Essens, Trinkens und Reisens macht »Energiesklaven« nötig. Denn diese Energiemenge holen wir aus Kohle, Öl und Gas, inzwischen auch aus Sonne, Wind und Biomasse. Letztere Energiequellen sind heimisch, die Anlagen stehen bei uns im Land. Aber die fossilen Ressourcen, die holen wir aus der ganzen Welt zu uns. Diese fossilen Ressourcen sind vor rund 300 Millionen Jahren entstanden, in den Erdzeitaltern Karbon und Perm, durch Ablagerung und Pressung der Biomasse (alles, was damals gelebt hat) im Erdboden. Im Vergleich dazu ist es atemberaubend, wie schnell wir den gespeicherten Kohlenstoff, den wir seit rund 200 Jahren aus dem Boden wieder herausholen, verbrauchen: Wofür die Natur über eine Million Jahre zur Herstellung gebraucht hat, das verbrauchen wir in einem einzigen Jahr. Unser Energiehunger ist enorm, angefacht zu Lande, zu Wasser und in der Luft durch unsere Mobilität, Produktivität und ein sich stetig hebendes Wohlstandslevel. Seit Jahrzehnten gibt es keine Einschränkungen mehr im Energieangebot, deshalb verbrauchen wir ungebremst und unreflektiert immer mehr.
Hätten wir seit 1973 jedes Jahr eine Ölkrise mit mehreren autofreien Sonntagen erlebt, dann wären unsere Autos heute sicher deutlich leichter, kleiner und insgesamt sparsamer – vielleicht hätten wir sogar weniger. Allein die Vorstellung, Mitte der siebziger Jahre hätte mehr als ein Fünftel aller Pkw-Neuzulassungen aus riesigen allradgetriebenen Luxuslimousinen (SUVs) bestanden, wäre angesichts der damaligen Ölpreise nachgerade unvorstellbar.
Es ist also gerade die scheinbar grenzenlose Verfügbarkeit der Ressourcen, die unseren Energieverbrauch immer weiter hat anwachsen lassen. Man könnte es zugespitzt auch so formulieren: Wir haben Energie-Adipositas, wir sind energetisch »verfettet«. Als Physiker kann ich mir eine kleine Rechnung nicht verkneifen: Bei einem ungebremsten Energiewachstum von vier Prozent jährlich (wie bisher, vor der Corona-Pandemie) und dem derzeitigen Energieumsatz von zehn Billionen Watt (1013) – der Gesamtenergieverbrauch der Menschheit geteilt durch die Anzahl der Sekunden eines Jahres –, wird es nur rund 800 Jahre dauern, bis die Leuchtkraft der Sonne (1026 Watt) erreicht sein wird. Das ist natürlich physikalisch unmöglich, aber es zeigt unseren Energiehunger.
Dabei sind die wirklich großen Menschenmengen bis jetzt noch gar nicht an der globalen Energieorgie beteiligt. Indien und China liegen pro Kopf noch bei etwa 30 beziehungsweise 70 Kilowattstunden pro Tag und pro Person. Wenn diese beiden Länder einmal den westlichen Lebensstil praktizieren, dann werden globale Wachstumsraten von vier Prozent pro Jahr weit überschritten.
Obwohl also die Aussichten wirklich bedrückend sind, hat man seit Längerem nichts mehr von der Energiekrise gehört. In Deutschland hat sich trotz intensiver technischer Entwicklungen, Optimierungen und Effizienzsteigerungen der sogenannte Endenergieverbrauch seit 30 Jahren nicht mehr verringert. Die Geräte, Maschinen, Strukturen werden zwar immer sparsamer, aber wir setzen dafür immer mehr davon ein. Letztlich leben wir auf einem dermaßen luxuriösen Energieniveau, dass wir es unter keinen Umständen aufrechterhalten können. Alle, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, wissen das. Niemand macht sich da irgendwelche Illusionen. Wir verbrauchen zu viel Energie. Aber was passiert? Nichts! Die nächste Stufe der Energiekrise, die Katastrophe, ist längst unser normaler Dauerbegleiter geworden. Und über das Normale, das Sowieso, spricht man nicht.
Bei vielen meiner Vorträge und Gespräche zum Thema Energie stellte sich heraus, dass die meisten das Thema Energie überhaupt nicht mit einer kritischen oder gar katastrophalen Entwicklung verbinden. Das wir so viel Energie verbrauchen, wird uns gar nicht klar. Es bedrückt uns nicht, denn wir bezahlen einfach dafür. Energie wird gekauft, vor allem diese besonders hochwertige Form, die elektrische Energie. Und die ist eben da, die kommt aus der Steckdose, immer und zuverlässig, nicht zu viel und nicht zu wenig, in der richtigen Menge und Form, normalerweise als 230-Volt-Wechselspannung, für unsere Herde in unseren Hochleistungsküchen sogar als 400 Volt. Auch unsere Bewegungsenergie, sei es zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, kaufen wir ein. Wer Geld besitzt, besitzt auch Energie – so das Prinzip. Deutschland ist reich, kann sich genügend Stoffe leisten, die sich in Bewegungsenergie oder elektrische Energie umwandeln lassen. Und weil das so ist, erkennen wir das Krisenhafte gar nicht. Die obengenannte Kilowattstunde kostet für den Kunden nur 30 Cent. Für zehn Stunden Radeln bei 100 Watt bekämen Sie nur 30 Cent! Wobei das meiste davon Steuern und Abgaben sind. Die Produktion selbst bezahlen wir mit nur wenigen Cent.
Und dann das noch: Seit zwei Jahrzehnten verbrauchen wir mit Computern aller Art immer mehr elektrische Energie. Diese sogenannte Digitalisierung hat sich in sämtlichen Lebensbereichen inzwischen so sehr ausgebreitet, dass sie einen nicht unwesentlichen Teil unseres Energieverbrauches darstellt. Dank des World Wide Web, des sogenannten Internets, sind heute Milliarden Menschen miteinander vernetzt. Und die globalen Kommunikationsströme, soziale Plattformen, digitale Unterhaltungsindustrien und viele andere Anwendungen, Steuerungs- und Kontrolldienstleistungen verbrauchen massenhaft Energie. Eine Studie hat ergeben, dass das Internet im Jahr 2012 4,6 Prozent des weltweiten Stromverbrauchs ausgemacht hat.1 Damit wäre das Internet im internationalen Ländervergleich Platz sechs hinter China, den USA, der EU, Indien und Japan. Das liegt auch daran, dass immer mehr Geräte mit dem Internet verbunden werden. Es gibt smarte Textilien wie Kopfkissen, die vibrieren, wenn Menschen nachts schnarchen, Kühlschrank-Kameras, die erfassen, welche Lebensmittel im Kühlschrank liegen und ob deren Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, oder eine vernetzte Kaffeetasse, die die Temperatur von Getränken misst und sie gegebenenfalls warm hält. Seit 2018 gibt es sogar eine Dusche mit Sprachassistent. Durch dieses sogenannte Internet of Things rechnen Experten mit einem Mehrenergieaufwand von 70 Terawattstunden pro Jahr in der EU.2 Das sind mehr als zehn Prozent der derzeitigen Bruttostromerzeugung in Deutschland und mehr Strom, als Deutschland gerade mit Wind- und Solarkraft erzeugt.
Den meisten Strom verbrauchen in den letzten Jahren aber Videostreaming-Angebote. Sie erzeugen einen immensen Datenverkehr. Bei einer Stunde Netflix mit Full-HD-Auflösung werden etwa drei Gigabyte Daten übertragen – eine 30-Watt-Lampe kann mit der dafür benötigten elektrischen Energie circa 36 Minuten brennen. Dazu kommt natürlich noch der Verbrauch des Laptops, Computers oder Fernsehers und gegebenenfalls eines Bildschirms. Die allgemeine Erwartung ist, dass die immer intensivere Digitalisierung in vielen Ländern den Verbrauch an elektrischer Energie drastisch erhöhen wird.
Nur dann, wenn es weltweit gelingt, den Energieverbrauch so schnell wie möglichst vollständig durch erneuerbare Energiequellen zu decken, führt dieser Energiehunger nicht zur Katastrophe einer massiven Erhitzung des Klimas. Allerdings sind wir sogar im hochentwickelten, reichen Deutschland weit davon entfernt, unseren Primärenergiebedarf durch erneuerbare Energien zu decken. In Zahlen ist es weniger als ein Fünftel, den Rest besorgen fossile Quellen und die Kernenergie. Man kann sich leicht vorstellen, wie schwer es für ärmere Länder sein wird, die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen.
Die Krise der Materie
Dass die Ressourcen auf der Erde begrenzt sind, wurde von einer breiten Öffentlichkeit erstmals 1972 durch einen aufrüttelnden Bericht wahrgenommen. Damals erschien im Auftrag des Expertengremiums »Club of Rome« die Studie Die Grenzen des Wachstums, die zeigte, wie die Menschheit die Umwelt überfordert. Seitdem ist die Diskussion um die Endlichkeit von Rohstoffen und die fatalen Folgen der Umweltzerstörung nicht mehr abgeebbt – und trotzdem steigt unser Rohstoffverbrauch immer noch stetig an.
Ein Forscherteam vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) in Leipzig hat sich genauer angesehen, wie es derzeit um die Verfügbarkeit der wichtigsten Ressourcen auf der Erde steht. Neben den Klassikern Kohle, Erdöl und Erdgas untersuchten die Forscher vor allem erneuerbare Ressourcen. Mit dabei: die Milch- und Fleischproduktion, der Fischfang, die Ernten bei Getreide und Gemüse, das Grundwasser. Hinzu kamen in der Betrachtung unter anderem die Entwicklung der Fläche an Ackerland, der Einsatz von Dünger, die Siedlungsdichte, das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Insgesamt betrachteten die Forscher die Daten von 27 Ressourcen, die zentral für das Überleben unserer Gesellschaften sind. Das Ergebnis der Berechnungen, in die Zahlen aus zahlreichen nationalen und internationalen Datenbanken einflossen: 21 der betrachteten Ressourcen haben ihren Peak schon überschritten.
Überraschend ist, dass dies nicht bei den fossilen Energieträgern eingetreten ist, sondern vor allem bei Ressourcen, die mit der Produktion von Nahrungsmitteln zu tun haben und die als »erneuerbar« gelten. »Peak« bedeutet in diesem Fall nicht unbedingt, dass zum Beispiel die Fläche an Ackerland in Zukunft abnimmt, sondern dass neue Flächen nicht mehr in der Größe und Geschwindigkeit erschlossen werden wie früher. Sprich: Wachstum gibt es durchaus noch, allerdings ist es gebremst und schwächer als früher. Manchmal herrscht auch Stagnation, wie bei den Anbauflächen für Weizen oder Reis. Beinahe unheimlich ist, dass bis auf die Fläche von Ackerland (die schon 1950 ihren Wachstumshorizont erreichte) alle Peaks mit großer Wahrscheinlichkeit um das Jahr 2006 herum aufgetreten sind. Die Grenzen des Wachstums haben aber keineswegs nur die Länder des globalen Südens überschritten. Auch in Großbritannien beispielsweise nimmt der Ertrag in der Landwirtschaft pro Hektar ab, weil die Böden durch Jahrhunderte immer intensiverer Landwirtschaft ausgelaugt sind.
Der US-Umweltforscher Lester Brown hat in seinem Buch Voller Planet, leere Teller dargelegt, wie Ackerflächen und sauberes Wasser weltweit knapper werden. Eine Erklärung für die beobachteten Peaks könnte sein, dass sich auch das Bevölkerungswachstum global abgeschwächt hat. Allerdings führen Wirtschaftswachstum und steigender Konsum in Schwellenländern dazu, dass trotz eines geringeren Bevölkerungswachstums die Nachfrage nach Lebensmitteln, Energie und Ressourcen unvermindert steigt.
Zwar ist theoretisch jede Ressource ersetzbar: Wenn das Öl zu Ende geht, könnten Autos zum Beispiel auch mit Erdgas fahren, fehlt der Stahl, kann man Autos auch aus Carbon bauen. In der Biologie stimme das aber nicht, so die Studie. Man könne etwa die Gesamtmenge an Getreide nicht einfach durch Reis ersetzen – das liegt alleine schon wegen der unterschiedlichen klimatischen Anbaubedingungen auf der Hand. Jeder einzelne Rohstoff muss also in einem nachhaltigen Gleichgewicht gelassen werden, wenn auch noch unsere Nachfahren genug Nahrung haben sollen.
Da die Anzahl der Menschen und ihre Nachfrage nach Lebensmitteln schneller wächst als die Ernten, Fischfänge und Ackerfläche, könnte man sich fragen, warum es heute trotzdem weniger Hunger auf der Welt gibt als vor zwanzig Jahren. Offenbar geht die Menschheit mit den Ressourcen, die sie gewinnt, effizienter um. Es gehen heute weniger Nahrungsmittel bereits vor dem Konsum verloren. In der Tat ist das eine der Hoffnungen für die Zukunft. Zwar sind die Möglichkeiten für weiteres Wachstum begrenzt, wenn aber zum Beispiel die Verschwendung von Lebensmitteln reduziert wird, kann am Ende die auf den Tellern verfügbare Menge an Lebensmitteln noch um einiges steigen. Rund ein Drittel der Nahrungsmittel gehen heute zwischen Feld und Verkauf verloren oder landen bei den Verbrauchern im Müll.
An einer sehr wichtigen anderen Ressource lässt sich das Krisenhafte der Materieverfügbarkeit leicht ablesen: Denken wir mal über Trinkwasser nach!
Wir in Deutschland können uns kaum vorstellen, was es bedeutet, wenn Wasser zum Luxusgut wird. Bei uns ist Wasser zum Trinken immer da. Wenn keine Flaschen im Haus sind, dann drehen wir eben den Wasserhahn auf. In anderen Ländern sieht das völlig anders aus. Der Thinktank »World Resource Institute« (WRI) hat untersucht, wie es um die Wasserressourcen in 189 Staaten steht, und dazu Daten aus den Jahren von 1960 bis 2014 ausgewertet. Laut ihrer Studie lebt ein Viertel der Weltbevölkerung in Regionen, denen Wassermangel droht. Besonders stark betroffen sind demnach Staaten im Nahen Osten und Nordafrika, in denen es ohnehin sehr trocken ist. Am schlimmsten ist die Lage in Katar, Israel und im Libanon. Insgesamt leiden 17 Staaten an extrem hohem Wasserstress. Die Forscher verglichen, wie viel Wasser genutzt wird und wie viel nachkommt. In den am stärksten betroffenen Ländern beanspruchen Landwirtschaft, Industrie und Gemeinden jährlich mindestens 80 Prozent des zur Verfügung stehenden Wassers. Gibt es in diesen Regionen zusätzliche Dürren, kommen die Reserven an ihre Grenzen, warnt das WRI. Besondere Sorge bereiten den Forschern die knappen Wasserreserven in Indien. Mit 1,3 Milliarden Einwohnern hat der Staat mehr als dreimal mehr Einwohner als die restlichen 16 Staaten mit extrem hohem Wasserstress zusammen. Und da Dürren durch die Klimakrise weiter zunehmen, könnten Nachrichten über Wassermangel künftig noch häufiger werden.
Zu den Staaten mit extrem hohem Wasserstress kommen noch weitere Staaten mit »lediglich« hohem Risiko hinzu. Dort werden jährlich zwischen 40 und 80 Prozent der verfügbaren Wasserressourcen entnommen. Insgesamt lebt damit sogar ein Drittel der Weltbevölkerung in Gegenden mit extrem hohem oder hohem Wasserstress. Deutschland landet im Ranking übrigens in der mittleren Kategorie auf Platz 62. Hierzulande werden laut der Studie 20 bis 40 Prozent der Wasserreserven genutzt. Allerdings gibt es auch Regionen in Deutschland, in denen der Wasserstress hoch ist. Das betrifft einen breiten Streifen, der sich von Norden über Bremen, Hannover, Leipzig und Stuttgart nach Süden zieht.
In den nächsten Jahrzehnten wird sich die Lage noch verschärfen, denn in den letzten 50 Jahren hat sich die entnommene Grundwassermenge mehr als verdoppelt. In Anbetracht der wachsenden Weltbevölkerung und des zunehmenden Wohlstands gibt es keinen Grund anzunehmen, dass der Wasserbedarf in den nächsten Jahren wieder sinkt, ganz im Gegenteil.
Sogar auf elementarem Level kann man unseren gefährlichen Rohstoffhunger beobachten, etwa beim Phosphor. Phosphor ist eine wichtige Grundlage allen irdischen Lebens. Ohne Phosphor funktioniert kein biologischer Organismus, keine Zelle, keine Pflanze, kein Tier, und es ist ein entscheidender Bestandteil in Pflanzendüngern. Für Phosphor gibt es keine Alternative. Es ist ein echtes chemisches Element und lässt sich durch nichts ersetzen oder reproduzieren. Gewonnen wird es aus Mineralien wie Apatit. Etwa 160 Millionen Tonnen Phosphat werden im Moment auf der Welt pro Jahr abgebaut. Die weltweiten Vorräte würden theoretisch etwa 100 Jahre reichen, wenn man beim heutigen Verbrauch bliebe. Doch Phosphatdünger dürfte schon schneller, in rund 20 Jahren, knapp werden. Grund dafür ist, dass der geförderte Phosphor zunehmend an Qualität verliert, es also aufwendiger und damit teurer wird, ihn von Verunreinigungen zu befreien. Mit der wachsenden Weltbevölkerung und dem steigenden Nahrungsbedarf wird zudem die Nachfrage nach Phosphor steigen.
Gewaltige Düngemittelmengen ermöglichten erst die Bevölkerungsexplosion der letzten Jahrzehnte und den Wohlstand in den Industrienationen. Weltweit erzielt die Landwirtschaft nur durch den intensiven Einsatz von Phosphatdüngern die notwendigen Ernteerträge für die knapp acht Milliarden Menschen, die inzwischen auf der Erde leben. Aber durch maßlose Verschwendung von Düngemitteln und vielen Alltagsprodukten landen große Mengen Phosphor unwiederbringlich in den Ozeanen. Heute werden etwa 80 Prozent des geförderten Phosphors zu Düngemitteln verarbeitet, doch es entstehen auch neue Konkurrenzen dort, wo man Phosphor anders nutzen und einsetzen kann, wie beispielsweise zur Herstellung von Batterien für Elektroautos.
Die weltweiten Konsequenzen der bevorstehenden Phosphorverknappung sind leicht prognostizierbar: Die Preise für Düngemittel werden explodieren und dadurch die Getreideproduktion massiv verteuern. Lebensmittel werden zum Luxusartikel. Es scheint nur eine sinnvolle Strategie zu geben, um dem drohenden Phosphatmangel zu begegnen: Gerade dort, wo keine natürlichen Phosphatgesteine vorhanden sind, werden Recycling und Einsparen immer wichtiger. Der lebenswichtige Rohstoff fällt in hohen Mengen im Abwasser an, denn Tier und Mensch scheiden Phosphor aus. Mit neuen, modernen Methoden kann man bis zu 90 Prozent des Phosphors aus dem Abwasser und Klärschlamm zurückgewinnen. Gerade in Ländern mit intensiver Landwirtschaft und Tierhaltung wird ein regelrechter Phosphatüberschuss produziert – in Form von Gülle. Und die Recyclingverfahren von Phosphor sind bekannt und funktionieren gut.
So könnte man immer weiter machen, mit vi...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titel
- Impressum
- Inhalt
- Vorwort: Zeit wird’s!
- Kapitel 1: Die Krisen der Gegenwart
- Kapitel 2: Zeit – Uhr – Krise
- Kapitel 3: Die Physiker und die Zeit
- Kapitel 4: Uhrzeitfolgen
- Kapitel 5: Zeitvielfalt
- Kapitel 6: Nachhaltige Zeitkultur
- Anmerkungen