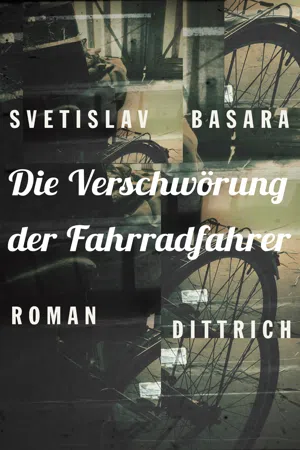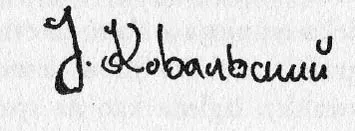![]()
DIE GESAMMELTEN WERKE VON
JOSEF KOWALSKY
![]()
KOWALSKY:
EINE BIOGRAPHIE
I
Im letzten Herbst berichteten die Tageszeitungen in einer Randnotiz im Kulturteil, dass der Dichter, Erzähler und Essayist Josef Kowalsky in seinem einundsechzigsten Lebensjahr in Dharamsala in Indien verstorben sei. Unter Kulturinteressierten fand diese Nachricht kaum Beachtung. Kowalsky war als Schriftsteller weder produktiv noch bekannt, aber seine Werke, verstreut in diversen Zeitschriften, wurden in gewissen spirituellen Kreisen aufmerksam gelesen. Es sei noch erwähnt, dass Personen von hohem Ansehen zu seinen Lesern zählten, wie zum Beispiel C. G. Jung, H.-G. Gadamer, G. Bataille und andere.
Das Leben dieses Mannes ist überzogen von unbekannten Daten, vernebelt von widersprüchlichen Gerüchten, die zu entkräften Kowalsky sich keine besondere Mühe machte. In einem Brief an einen Freund schreibt er 1937:
Jede Biographie ist eine große Mystifikation, und mir scheint sogar, dass die Biographie umso glänzender und ausgeschmückter ausfällt, je verdorbener der Porträtierte war. In diesem Sinne unternehme ich nichts, um die Gerüchte über meine Vergangenheit zu entkräften. Auch wenn ich die Dinge, über die man munkelt, nicht begangen habe, so habe ich viel schlimmere Dinge begangen.
Die Gerüchte, die nicht immer weit weg von der Wahrheit sind, so wie zahlreiche überprüfte »Wahrheiten«, die nichts anderes als Gerüchte sind, zeigen Kowalsky in Bildern, die einander ausschließen: Mal ist er ein Asket, ein Mann, der in seine innere Welt eingetaucht ist, dann wieder ein umtriebiger junger Mann und unübertrefflicher Charmeur; die einen beschreiben ihn als milde und verständnisvoll, die anderen als grob, hochmütig und grausam. Auf jeden Fall verlief das Leben dieses Mannes in einem quälenden Gleichgewicht zwischen dem Uranischen und dem Hedonischen, dem Erhabenen und dem Trivialen, dem Göttlichen und dem Satanischen. Obwohl Kowalsky sich zu außerordentlichen geistigen Höhen11 aufschwingen konnte, waren ihm auch finstere und depressive Zustände nicht unbekannt. Nur eines steht fest: Die Wahrheit über seine Persönlichkeit verbirgt sich hinter einer Mauer des Schweigens und der Mystifizierungen.
J. Kowalsky wurde am 12. Januar 1901 in Tübingen in die arme Familie des Schusters W. Kowalsky hineingeboren, der sein Handwerk vernachlässigte und sich dem Schreiben von kitschigen Gedichten und suspekten Erzählungen widmete. W. Kowalsky hat angeblich dem Orden der Kleinen Brüder der evangelischen Fahrradfahrer des Rosenkreuzes angehört (was nicht mit Sicherheit feststeht), dem später auch J. Kowalsky angehörte (was mit Sicherheit feststeht). J. Kowalsky verlor früh seine Mutter. Dennoch war er ein brillanter Schüler. Insbesondere tat er sich in Latein und Altgriechisch hervor. Vermutlich war dieses Talent ausschlaggebend dafür, dass er sich später am Tübinger Stift einschrieb, wo auch Hegel und Schelling ihre Ausbildung erhalten hatten. Im Tübinger Stift fiel er als exzellenter Student auf, jedoch stand sein schlechtes Benehmen seinen intellektuellen Leistungen um nichts nach. Er galt als ein hervorragender Kenner der Bibel, des Hl. Augustinus und des Hl. Thomas von Aquin. Dann kam es aber zu einer Wende, der ersten von vielen, die sein Leben von da an im Überfluss aufweisen sollte. Man wird nie erfahren, was ihn am 14. Oktober 1919 dazu brachte, nach Darstellung von Augenzeugen mitten in einer Vorlesung ganz ruhig aufzustehen, zum Professor zu gehen, dessen Taschenuhr von der Kette zu reißen, die Uhr mit dem Fuß zu zerstampfen, dabei auszurufen »Jetzt ist es aber genug« und für immer den Hörsaal zu verlassen. In Zusammenhang mit Kowalsky taucht immer wieder eine junge Frau auf, Grete, in die Kowalsky verliebt war. Zweifellos nahm sie einen gewissen Platz in seinem Leben ein (ihr hat er eines seiner ersten Gedichte gewidmet, »Die Gefährtin«), aber es ist schwer vorstellbar, dass sie der einzige oder wichtigste Grund für seinen Studienabbruch war. Wir sind eher geneigt anzunehmen, dass Josef in einem Alter, in dem junge Männer inspiriert von suspekten Idealen anfangen, die Welt um sich herum kritisch zu betrachten, die Heuchelei und das Elend der Gesellschaft, in der er lebte, in aller Deutlichkeit wahrzunehmen begann.
Man sagt, es gebe zwei Arten von Menschen: die Anständigen und die Verdorbenen – schreibt Kowalsky in jenen Jahren –, aber ich sage, es gibt nur Verdorbene und Schauspieler; Gestalten, die sich an öffentlichen Orten loyal, höflich und anständig geben, während sie insgeheim Diebe und Tyrannen sind. Ich will nicht sagen, ich sei besser als sie, im Gegenteil, ich bin schlechter; aber ich gebe nicht vor, loyal, höflich und anständig zu sein. Zu lange habe ich etwas vorgemacht. Außerdem sind diese Philister, wenn man genauer darüber nachdenkt, nicht einmal wirklich verdorben. Sie sind noch etwas viel Schlimmeres: Feiglinge, die sich zu armseligen Berufsverbänden und Gilden zusammenschließen, um unter dem Slogan »Gemeinsam sind wir stärker« eine Art Legitimität zu erlangen und das Nichts abzuwehren.
Im Lichte solcher Betrachtungen werden die Handlungen Kowalskys klarer. Seine Geliebte Grete war eine Prostituierte. Kowalsky störte das offenbar nicht. In seinen Augen waren ganz andere wirklich Prostituierte: die Damen aus höheren Gesellschaftsschichten, aufgedonnerte Gänse, die ihre Tage mit Tratsch und vorgetäuschter Kunstbegeisterung zubrachten. Für Letzteres hatte Kowalsky sein Leben lang nur Verachtung übrig, obwohl er selbst ein Musikliebhaber war. In jenen Jahren schloss er sich den Anarchisten an und später – enttäuscht vom endlosen Theoretisieren – der wesentlich kämpferischeren Kommunistischen Partei Deutschlands. Kowalsky war ständig in Bewegung. Getrieben vom unbändigen Wunsch, die Welt zu verändern und Elend und Erniedrigung auszurotten, suchte er die Siedlungen von armen Leuten und Arbeitern auf, sammelte Hilfsspenden für die Schwächsten und betrieb Agitation.
II
Im Jahr 1920 fuhr Josef Kowalsky als Delegierter zum Kongress der Komintern. Aus dieser Zeit gibt es eine Fotografie: In einem geräumigen Saal, offensichtlich in einem ehemaligen Schloss, sitzen Žil Imber-Droz, Bombači und Lepetit und betrachten eine Liste, die Imber-Droz in den Händen hält. Lucien Laurat sitzt mit aufgestützten Ellenbogen am Tisch und starrt gedankenverloren aus dem Fenster. Nicht weit von ihm entfernt ist Henri Lefebvre. Gekennzeichnet mit X (auf dem Foto) befindet sich im rechten Eck Josef Kowalsky. Er sieht so aus, als würde er schlafen. In einem Brief teilt Kowalsky einem Freund seine Eindrücke vom Kongress mit:
Getagt wurde in Moskau, im Thronsaal des Kreml. Die Sicht auf den Thron wurde von einem Vorhang verdeckt. Die Säle rund um den Thronsaal dienten bei den Aufenthalten der Zarenfamilie in Moskau als Residenz. Diese Privatapartments wurden für den Kongress in Lesesaal, Raucherzimmer, Buffet und Erholungszimmer für die Delegierten umfunktioniert. Im letzten Saal befand sich ein großes Bett. Viele Delegierte hielten dort ein Nickerchen oder verbrachten einige Augenblicke, um sich genüsslich zu strecken, im Wissen, dass sie dies auf dem Bett des Zaren taten.
Ich muss dir gleich sagen, mir gefiel es gar nicht, dieses selbstzufriedene, genusssüchtige Wandeln auf Gräbern; dieses kleinbürgerliche Herumliegen auf Zarenbetten. Man muss Grenzen setzen: Der Zar ist ein Zar, solange er am Leben ist; wenn er stirbt, ist er bloß ein Toter. So wie alle anderen auch.
Untergebracht wurden wir im Hotel »Lux«, von Luxus gab es dort allerdings keine Spur: Es ist voller Wanzen. Frühstück und Mittagessen nimmt man gemeinsam ein, im Speisesaal, am Abend gibt es einen Imbiss (»Pajok«), jeden Tag dasselbe: Schwarzbrot, ekelerregende, ranzige Butter, hart gekochte Eier mit halbleerer Schale, wegen des verschimmelten Strohs, in dem sie aufbewahrt wurden, von grausigem Geschmack.
D. H. Grainger, der sich in einem Text auf diesen Brief bezieht, stellt dessen Authentizität in Frage und behauptet: Entweder sei der Brief gefälscht oder Kowalsky habe ihn von Žil Imber-Droz abgeschrieben. Grainger, der sich auf Esoterik spezialisiert hat und nicht etwa auf die Geschichte der Arbeiterbewegung, bedenkt dabei allerdings nicht, dass damals in der Komintern eine Einheit im Denken vorherrschte. Menschen, die gleich denken, schreiben gleiche Briefe. Im Übrigen ist bekannt, dass Kowalsky keine hohe Meinung von Žil Imber-Droz hatte und ihn für einen »platonischen« Revolutionär hielt.12 Andererseits ist nicht auszuschließen, dass Kowalsky zum Zwecke der größtmöglichen Mystifizierung diesen Brief später selbst geschrieben hat.
Kowalsky blieb drei Monate lang in Russland. Vielleicht war es der Anblick von Elend und Armut, der damals auf den Straßen Moskaus auf Schritt und Tritt zu finden war und im scharfen Kontrast zum überbordenden Lu...