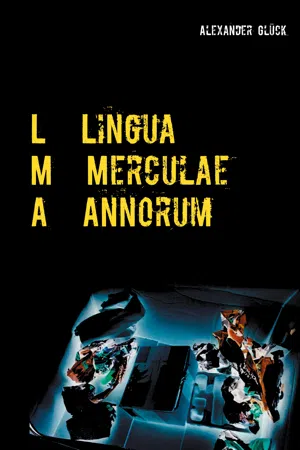![]()
1
DEUTSCH IM NEBEL DES UNGEFÄHREN
Sprache dient dem Fassen und Übermitteln von Informationen und Gedanken. Unsere deutsche Sprache geronn erst vor gut 400 Jahren zu ihrer heutigen Form, zuvor unterschied sich das Deutsch im Flickenteppich dieser verspäteten Nation teilweise ganz erheblich; tiefere Sprachgrenzen teilten das Hoch- vom Niederdeutschen. Trotz der durch das neu aufgekommene Massenmedium des Buches verbreiteten einheitlichen neuhochdeutschen Sprache blieben viele Varietäten erhalten, die teilweise und auch aus politischen Gründen (Niederländisch, Moselfränkisch) als eigene Sprachen anerkannt wurden, teilweise (Friesisch, Bairisch) eher als Dialekte gelten. Aus der Verschiedenheit der sich stets munter mißverstehenden deutsch Stämme erwuchsen Teilungen, aber auch der Föderalismus. Die deutsche Sprache unterliegt nicht, wie in zentralistisch regierten Ländern, staatlicher Besachwaltung, sie ist weitgehend offenes Terrain für Sprachakrobaten, Sprachschützer, Sprachästheten und Sprachpädagogen. Auch deshalb unterliegt sie einem steten Wandel: Begriffe und Bedeutungen tauchen auf, setzen sich fest oder lösen sich auch wieder aus dem Alltagsgebrauch, um ins Vergessen zurückzufallen. Es ist nicht besonders gewagt, wenn man der Veränderung unserer Sprache während der Regierungszeit Angela Merkels eine besonders auffällige Dynamik zuspricht.
Zu den wichtigsten Merkmalen jener Jahre, die von der Geschichtsschreibung dereinst mit dem Namen dieser Bundeskanzlerin gekennzeichnet werden dürften, gehört der gravierende Wandel, dem in dieser Zeit unsere Sprache unterworfen ist. Die Ära Merkel hat ein ganz bestimmtes Vokabular und einen sehr spezifischen Sprachgebrauch hervorgebracht, und zwar nicht nur seitens der Regierungsparteien, sondern auch in oppositionellen Gruppen, in den Medien und bei den Menschen. Einige dieser Veränderungen folgen einer klaren politischen Zielsetzung, wenn es etwa darum geht, Diskriminierungen entgegenzuwirken, Frauen besserzustellen oder einen Beitrag gegen die Erderwärmung zu leisten. Ob diese Anstrengungen sinnvoll sind oder nicht sogar einen gegenteiligen Effekt haben, wird in den jeweiligen Kapiteln erörtert werden. Allerdings kann man sehr vielen Sprachveränderungen diesen politischen Impetus nicht unterstellen. Schon der massenweise Gebrauch des Wörtchens „weil“ an Stellen, an denen eigentlich ein „denn“ zu verwenden ist, belegt etwas, das man mit „Dynamik der Gedankenlosigkeit“ bezeichnen könnte. Der Dauergebrauch von Wörtermüll wie lecker, nachhaltig, aufarbeiten, letztendlich und weiteren leeren Begriffen dieser Art gibt Aufschluß darüber, wie unreflektiert und unbewußt mittlerweile mit der Sprache umgegangen wird. Man hört und spricht nach, aber ganz offensichtlich ohne besonders weitreichende kognitive Anstrengungen.
Wenn das schon auf den ersten Seiten in einem Buch, das Streiflichter aus unserer Gegenwartssprache versammelt, als besonderer Aspekt erwähnt wird, dann keineswegs mit der Attitüde humorloser, oberlehrerhafter Sprachpuristik. Deutsch ist eine Sache von 100 Millionen Benutzern und es liegt mir völlig fern, im Rahmen dieses Buches zu besserem Deutsch oder zur Mäßigung beim Gebrauch von Fremdwörtern oder Anglizismen aufzurufen. Das wäre schon deshalb ein aussichtsloses Unterfangen, weil sich unsere Sprache inmitten eines beschleunigten Niedergangs befindet: In der Jugendsprache ist nice das neue „schön“ und krank ist das neue Wort, wenn man etwas bestaunt. Die Werbung preist ein Deodorant (Typ „Afrika“, abgefüllt in schwarze Flaschen, keiner regt sich auf) an11, das seinen Träger vor Schweiß schützen soll, dabei werden doch eigentlich die Umstehenden geschützt. Und dann heißt die Marke auch noch „Lynx“, zu deutsch „Luchs“: Er gehört zu den Tieren mit besonders einprägsamem Geruch. Das kauft man wirklich nur, wenn man ein völlig abgestumpftes Sprachbewußtsein hat.
Eine österreichische Versicherung stellt die Frage: „Kann meine Fahrradversicherung ein Windrad antreiben?“12, als hätte man das nicht bisher dem Wind überlassen. Und wenn ein Bruttoinlandsprodukt oder welcher Wert auch immer um 2 % zurückgeht, dann schreibt praktisch jeder auf jedem Kanal von einem „Rückgang um -2 %“. Flächendeckend spricht man von ehrgeizigen Projekten, obwohl doch der Ehrgeiz nur bei demjenigen liegen kann, der das Projekt verfolgt. Wir leben also in einer sprachlichen Wirklichkeit, die vor allem dadurch charakterisiert ist, daß ein Sachverhalt vollkommen sinnverkehrt aufgefaßt und dargestellt wird und dies überhaupt nicht bemerkt wird. Aber wenn man in einem Onlineforum jemanden auf falsche Interpunktion aufmerksam macht, und sei es nur wegen eines Wortspiels, wird das meistens sehr persönlich genommen und sehr unfreundlich beantwortet.
Im Unterschied zu vielen anderen sprachkundlichen Büchern will diese Veröffentlichung also überhaupt nicht auf Veränderungen hinwirken, sondern eine Reihe von Auffälligkeiten unserer jetzigen deutschen Sprache sammeln und zeigen. Denn eine sprachpflegerische Herangehensweise würde den Kennern ohnehin nicht viel Neues bieten, dabei aber von jenen anderen, die mit solchen Hinweisen kognitiv ohnehin nicht zurechtkommen, als spitzfindige Gängelei zurückgewiesen werden. Beschränken wir uns auf die Autopsie unserer Sprache, gelangen wir zu einer unverstellten Momentaufnahme, zu einem aktuellen Lagebericht. Damit können wir besser verstehen, was hier abläuft. Ein Tierfilmer, der den Kampf einer Spinne mit einer Wespe dokumentiert, wird auch nicht einer Seite helfen. Er zeichnet auf, was vor sich geht. Dadurch lassen sich die Ursachen und Folgen der fortschreitenden, uns alle betreffenden Sprachveränderungen erkennen. Manches davon wird sich lange halten, anderes recht bald wieder verschwinden. Im Rückblick wird man den heutigen Gebrauch von Wörtern und Begriffen eng mit unserer Zeit assoziieren und vielleicht feststellen, daß dieses Deutsch typisch für diese Jahre war.
Was aber sind diese besonderen zeittypischen Aspekte dieser jetzigen deutschen Sprache? Nach Durchsicht der gesammelten Begriffe und noch vor Abfassung der einzelnen Kapitel ließen sie sich so skizzieren: Einerseits eine starke Verflachung mit fortschreitendem Verlust an sprachlicher Genauigkeit, eine grassierende, wahrscheinlich durch das Internet induzierte Neigung zum plakativen Schlagwort, unter dem Gedanken und Zuschreibungen viel zu schnell und unreflektiert eingeordnet werden, eine generelle Tendenz zum Einfachen im Sprachgebrauch mit Dauerverwendung von Phrasen und Allgemeinplätzen. Andererseits eine auffallend starke Brutalisierung und Verhärtung vor allem im politischen Bereich, Tendenzen zur Stigmatisierung, Ausgrenzung und Verächtlichmachung, dadurch oft ungewollte Verharmlosungen, beispielsweise des Nationalsozialismus. Unsere Sprache der Gegenwart ist durch viele pseudo-originelle, aber oft falsche und meistens unpräzise Begriffe geprägt, durch unabsichtliche Rückgriffe in die Sprache des Nationalsozialismus (auch und gerade seitens der SPD) sowie durch einen auffallend häufigen Gebrauch technischer Begriffe, die eine mindestens latente Entmenschlichung vermuten lassen. Unsere Sprache spreizt sich zunehmend zwischen lustvollem Fremdwortgebrauch und einem sehr deutlichen Zug ins Triviale auf.
Seitens der Regierungs- und Verwaltungsstellen ist vermehrt ein autoritärer Unterton zu vernehmen, zugleich wird das Deutsche aber konsequent in den Bereich des Schwammigen geführt, bis hin zum Begriff des Deutschen selbst, der mal „schon länger hier lebt“, mal „türkische Wurzeln hat“, mal als Bewohner „Dunkeldeutschlands“ zum „Pack“ gehört und den „Rattenfängern“ folgt und dem man in diesem Fall auch einmal freistellt, „dieses Land zu verlassen“ – wobei „dieses Land“ ebenfalls in Anführungsstriche zu setzen ist: Das Deutsch offizieller Stellen versucht dieses Land irgendwie ungeschehen zu machen, weil es ja in gewisser Hinsicht auch folgerichtig ist, in einer Weltgesellschaft, der man die Unterteilbarkeit in Rassen völlig abspricht, auch auf Völker, Volkszugehörigkeit oder Volksgruppen ganz zu verzichten. „Volk“ ist deshalb natürlich so etwas wie der Problembegriff Nummer eins, und mit ihm keineswegs nur die längst abgewickelten, zur Rechtfertigung von Überfällen mißbrauchten und auch sonst sehr kontaminierten Vokabeln „Volkstum“, „Volkstumskampf“ oder „Volksgemeinschaft“, sondern auch eher harmlose wie „Volkstanz“, „Volkslied“, „Volkstheater“, „Volkskunde“ und dergleichen mehr. Die künstlerische Installation „Der Bevölkerung“ im Innenhof des Reichstagsgebäudes sieht auf Google Maps so aus, als läge dort schon bereit, was möglichst bald am Portal dieses Gebäudes befestigt werden soll, wenn man die Inschrift „Dem deutschen Volke“ für obsolet erklärt. Der Weg dorthin wird bereits geebnet.
Politische Steuerung durch Sprache ist indessen keineswegs neu. Schon im Wilhelminischen Deutschland wurden Sprachcodes entwickelt, doch erst im Nationalsozialismus perfektionierte man die Möglichkeiten, mit geregelter Sprache die Menschen zu manipulieren, ihr Denken zu beeinflussen und ihre Entscheidungen zu steuern. Auch die DDR war geprägt von sprachlicher Steuerung. Politische Sprache ist nie frei von politischer Intention, und ein Blick auf die Sprache unserer Zeit kann die ihr innewohnende Tendenz zur sprachlich-politischen Lenkung der Bevölkerung sichtbar machen. Manipulation durch Sprache wurde als Thema durch George Orwell (1984) und Aldous Huxley (Schöne neue Welt) literarisch popularisiert, sie wird inzwischen ganz offen betrieben und angewendet, beispielsweise in der Werbung, im Genderwesen und natürlich im Journalismus. Durch die Benutzung von Begriffen kann man Wertungen transportieren und unerwünschte Meinungen ausgrenzen. Die Lufthoheit über der Sprache bedeutet nichts anderes als die Kontrolle der öffentlichen Meinung. Es ist kein Zufall, daß sich die ARD für ihren Framing-Leitfaden ausgerechnet Rat bei einer Kennerin der NS-Sprachmanipulation gesucht hat.
Die politische Sprache der Gegenwart ist einerseits durch Neuschöpfungen, Euphemismen und Verstärkungen geprägt, andererseits durch Anleihen bei früheren totalitären Systemen, wenn beispielsweise regierungsseitig der Begriff Zusammenrottungen aus dem DDR-Strafrecht bemüht wird oder der SPD-Politiker Stegner seinen Parteikollegen Sarrazin im reinsten NS-Jargon als charakterlich gescheitert bezeichnet. Vielen der heute typischen Vokabeln sieht man ihre politische Brisanz nicht auf den ersten Blick an (Europäische Lösung), andere versuchen der Aufmerksamkeit durch ihre unverhohlene Lächerlichkeit zu entwischen (Bätschi). Wieder andere verschleiern religionsimmanente Probleme (Islamismus statt politischer Islam) oder entlarven die ihnen zugrundeliegende Gedankenwelt (widerliche Lebensschützer). Manche wurden zum Etikett (Haß, Lügenpresse), manche bescheiden sich als dezente Hinweise (Lückenpresse, Qualitätsmedien).
Viele Menschen haben inzwischen gelernt oder sich darauf zurückbesonnen, mit diesen Codes umzugehen und zwischen den Zeilen zu lesen, interessanterweise eher in den neuen Bundesländern. Gelegentlich wird das damit erklärt, daß man dort während der DDR-Diktatur Erfahrungen auf diesem Gebiet gesammelt hat. Zweifellos hat sich dabei aber auch die Sprache als Ganzes verändert, und es ist sehr fraglich, ob sich nach dieser Zeit der Status quo ante von selbst wieder einstellen wird. Sprache entwickelt sich immer nach vorne, weswegen sich diese Umgestaltungen kaum rückgängig machen, sondern allenfalls verarbeiten lassen werden. Das war auch früher so: Vielen Begriffen aus der technisierten Sprache der dreißiger und vierziger Jahre (etwas aufziehen) sieht man heute ihren zeitlichen Hintergrund nicht mehr an, sie werden ohne politische Absicht verwendet. Ähnlich wird es auch mit manchen Begriffen laufen, die in unserer Zeit entstanden sind.
Angela Merkel verdankt ihre beachtlich lange Regierungszeit nicht zuletzt dem Umstand, daß sie sehr geschickt mit Sprache umgeht. Sie behauptete zwar, es sei ihr wichtig, auf ihre Sprache zu achten und präzise zu sein, aber sie wußte auch, „daß es zwischen Denken, Sprechen und Handeln einen ziemlich engen Zusammenhang gibt.“ Aus diesem Grund war die geschickte Verwendung der Sprache immer ein Teil ihrer politischen Taktik. „Framing“ nennt man diese Kunst der Bundeskanzlerin und ihrer Redenschreiber, durch die Wahl der Formulierung die politische Debatte so zu beeinflussen, daß es nicht auffällt. Diese subtile Form der Manipulation wird einmal zu den wichtigsten Arbeitsfeldern gehören, wenn man erforschen wird, wie sie funktioniert hat, die politische Steuerung in unserer Zeit. Mit ihrem sprachlichen Instrumentarium gelingt es Angela Merkel, den Rahmen einer Debatte abzustecken, sich selbst aber unverdächtig oder kompetent erscheinen zu lassen. Ein paar Kostproben: Europäische Lösung, nationale Abschottung, etwas vom Ende her denken, auf Sicht fahren, ein freundliches Gesicht machen, Stabilitätsunion, Wettbewerbsfähigkeit, die schon länger hier Lebenden oder das dann bald entsorgte ihre Hausaufgaben machen.
Solche Formulierungen und Begriffe wurden für dieses Buch gesammelt, und zwar ausdrücklich nicht nur solche von Angela Merkel, sondern auch von anderen Repräsentanten unserer Zeit. Dadurch kann aus gegenwärtig reichlich sprudelnden Quellen das Vokabular geschöpft werden, das für unsere Zeit typisch ist und das sie prägt. Gleichwohl ist dieses Buch weder gegen Angela Merkel gerichtet noch gegen irgendeine politische Partei. Der Zweck dieses Unterfangens ist nämlich nicht, gegen bestimmte politische Gruppen zu arbeiten oder ihren Sprachgebrauch agitatorisch auszuschlachten, sondern vielmehr: eine Momentaufnahme der politischen Sprache und Sprachverwendung in unseren zunehmend als bleiern empfundenen Jahren anzufertigen, die später als Arbeitsgrundlage für weitere Forschungen gefragt sein könnte.
„Wer die Sprache bestimmt, beherrscht das Denken. Auch deshalb bekämpfen totalitäre Ideologen freie Medien stets, und auch deshalb versuchen Diktaturen, den Wortschatz ihrer Untertanen zu beeinflussen“, schrieb Sven Felix Kellerhoff 2010. „Gleichzeitig aber ist Sprache in hohem Maße verräterisch, weil sie schlaglichtartig Einblicke in antihumanes Denken gewährt.“ Zu den hervorragenden Sammlungen politisch motivierter Vokabeln gehören neben der beispielgebenden „LTI“ Victor Klemperers auch das „Wörterbuch des Unmenschen“ von Dolf Sternberger, Wilhelm Emanuel Süskind und Gerhard Storz, das „Vokabular des Nationalsozialismus“ von Cornelia Schmitz-Berning, „Schlagwörter der Nachkriegszeit“ von Dieter Felbick, „Giftige Wörter der SED-Diktatur“ von Ulrich Weißgerber und das „Wörterbuch der Vergangenheitsbewältigung“ von Thorsten Eitz und Georg Stötzel. Sie sind als Beispiele jedem empfohlen, der sich mit den für unsere Beobachtung interessanten Fragen befassen will. Aus der aktuellen Literatur seien die „Widerworte“ Alexander Kisslers sowie das im rechts stehenden Antaios-Verlag erschienene „Die Sprache der BRD“ von Manfred Kleine-Hartlage empfohlen, die für dieses Buch die eine oder andere Inspiration gegeben haben.
Gerade letztgenannte Veröffentlichung dürfte...