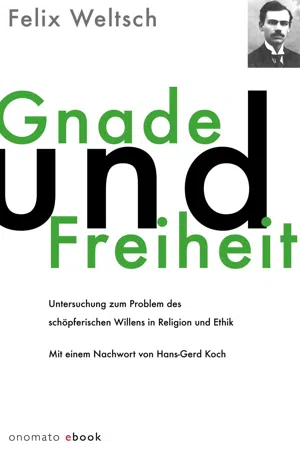![]()
Schöpferische Freiheit
als religiöses Prinzip
Im Gottesbegriff hat sich im Verlaufe der religiösen Entwicklung eine Bewegung in zwei Richtungen vollzogen:
1. in der Richtung der Beantwortung der Frage: Wo ist Gott? und 2. in der Richtung der Beantwortung der Frage: Was ist höchste Wirklichkeit: Sein oder Werden?
Nach dem ersten Gesichtspunkt:
1. Gott ist außerhalb der Natur und außerhalb der menschlichen Seele – Gott ist transzendent;
2. Gott ist in der menschlichen Seele. Er ist immanent;
3. Gott ist im All, weil er mit dem All identisch ist; der Standpunkt des Pantheismus.
Der transzendente Gott war stets der Gott der offiziellen Religionen, der Gott der Überlieferung, der Gott der historischen Offenbarung. Nur ein solcher Gott läßt sich durch unsere Mitteilung lehren; nur von einem solchen kann man dem Volk berichten; es ist der Gott, dessen Anerkennung sich auf historische Tatsachen stützt. Es ist der Gott des offiziellen Christentums wie auch des offiziellen Judentums. Der Gott der Scholastik sowie der Gott der Rabbinen.
Der immanente Gott ist der Gott der Mystik; von der Transzendenz zur Immanenz weist auch die philosophische Entwicklung des Gottesbegriffes, die ja ihr lebendiges Material zumeist von der Mystik bezieht: Bezeichnend dafür ist der Einfluß Böhmes auf Schelling. Über den Gott des Pantheismus ist in diesen Kapiteln bereits an anderer Stelle gehandelt worden. Es ist der Gott Spinozas und der Gott Goethes. –
Die zweite Entwicklungsdimension bezeichnet die Frage: Worin liegt die höchste Wirklichkeit, im vollendeten, abgeschlossenen, absoluten Sein – oder im ewig neuen, unvollendbaren, unbeschränkbaren Werden? Was bedeutet da die Frage nach der „Wirklichkeit“? Was bedeutet diese merkwürdige Komparation „wirklicher“ und gar der Superlativ: höchste Wirklichkeit? –
Wirklichkeit und Sein sind grundverschiedene Begriffe. Die Kategorie der Wirklichkeit stammt aus unserer unmittelbarsten urteils- und begriffslosen Erfahrung. Die Kategorie des Seins von unserem Urteil.
Wirklichkeit ist erlebtes Leben. Wir leben in der Wirklichkeit und die Wirklichkeit lebt in uns. Nichts ist bekannter als die Wirklichkeit und nichts ist der Umschreibung und Mitteilung mehr entzogen als die Wirklichkeit; weil sie mit nichts vergleichbar und durch nichts zerlegbar ist. Wirklichkeit entsteht nicht erst, wenn wir unser Leben beurteilen, wenn wir uns darüber stellen, wenn wir es verändern, sondern Wirklichkeit ist das Erste, ist der Ursprung, ist das Tor unserer Erfahrung. Das Sein ist das Resultat der Beurteilung, die Wirklichkeit ist der Ausgangspunkt der Beurteilung.
Wirklichkeit ist das Erlebnis des Lebens, im Sinne Nietzsches und Bergsons. Wirklichkeit ist „in der Zeit sein“ – aber nicht in der leblosen, schematischen Zeit Kants, sondern in der temps durée Bergsons.
Absolutes Sein – als die höchste Steigerung des Seins – ist außerhalb der Zeit. Der Begriff des absoluten Seins, wie ihn die Philosophie gebildet hat, empfindet die Zeit als Beschränkung der Absolutheit und ist daher auch von der Zeit losgelöst – d. i. absolut.
Trotzdem hat man diesem zeitlosen absoluten Sein die Kategorie der Wirklichkeit – die man, wenn auch uneingestanden, aus dem Erlebnis nahm – zugeschrieben. Es ist eine der verhängnisvollsten Taten der Philosophie, daß man diese beiden Kategorien, die aus ganz verschiedenen Quellen geschöpft sind – aus der rationalen des Urteils die eine, die andere aus der irrationalen der innern Anschauung –, harmlos verkoppelte. Und es ist eines der wichtigsten Ereignisse der Religionsentwicklung, daß dieses tote philosophische absolute Sein des Aristoteles in den lebendigen Gottesbegriff der Religion hineingenommen wurde und so den Gottesbegriff der Religionsphilosophie und der philosophisch orientierten Religionsentfaltungen gezeugt hat.
Dieser höchst lebendige, tätige, persönlich fühlende Gott der Religion wird durch diese unnatürliche Vermischung zum kalten absoluten Sein, das nichts ist, als die gedankliche Fortspinnung aller Gegebenheiten ins Unendliche – durch einen paradoxen Sprung des Glaubens gegen alle Erfahrung als vollendete Wirklichkeit gedacht.
Trotzdem bleibt das Absolute frei von Zeit. Denn man empfindet das „In-der-Zeit-Sein“ als eine Negation des Absoluten; obzwar uns jede Möglichkeit fehlt, dieses „Außerhalb-der-Zeit-Sein“ zu denken – gab man doch diese Eigenschaft dem Absoluten und indem man dieses philosophisch Absolute mit dem Gott der Religion identifizierte, gelangte auch der Gott der philosophisch entwickelten Religion aus der Zeit hinaus.
Die Verwechslung von absolutem Sein und Wirklichkeit geschah so, daß man die Wirklichkeit – logistisch, d. h. den Machtbereich der Logik überspannend – als ein Sein auffaßte. So konnte es geschehen, daß wirkliches Sein unter dem Namen Existenz, als aus dem absoluten Sein hervorgehend, als in ihm notwendig enthalten angesehen wurde. Man sieht leicht, daß diese Verwechslung auch die Ursache für den berühmtesten aller Fehlbeweise ist, für das ontologische Argument.
Indem man also auf der einen Seite die Wirklichkeit für ein Sein hielt, legte man andererseits der logischen Kategorie des absoluten Seins Wirklichkeit bei, ja sogar – wieder durch einfache gedanklich-logische Steigerung – eine höhere oder die eigentliche Wirklichkeit, der gegenüber die „wirkliche“ Wirklichkeit des Lebens unwirklich schien.
In Wahrheit ist die Wirklichkeit die erste, vorlogische Materie unserer Erfahrung. Der Strom, aus dem alles, was wir erfassen und erkennen, lieben und gestalten, hervorgeholt wird, das vollkommen unverfärbte, reine Material unseres Lebens.
Zum Absoluten aber führt die Intention des erkennenden Urteils. Sein Ideal ist „Einsichtig sein“. Das ist die innere Einheit des Geistes, welche im Gegebenen zu finden Sinn des Erkennens ist.
So wird vom Erkennenden das Gegebene erlebt, so sucht der erkennende Geist im Gegebenen sich selbst zu finden, daß er es so lange bearbeitet, bis es Einsicht, innere Einsicht, Geist wird. Dieses Einsichtigsein stellt sich als ein Notwendigsein dar. Diese geistige Einheit äußert sich darin, daß jeder Teil des Gegebenen im Ganzen des Gegebenen fest und sicher ruht, daß jeder Teil durch die übrigen Teile bestimmt ist. Das ideale Ziel wäre: das Gegebene ist notwendig durch sich selbst, d. i. causa sui. Und ein jeder Teil ist notwendig durch die andern Teile – wird also vollkommen getragen durch die Einheit des Ganzen, geht in seiner Relativität zum Absoluten ganz auf; Gegenstandsein ist dann: Zu-Ende-Bestimmtsein durch das Ganze.
So ist das Einzelne durch das Ganze bestimmt und das Ganze in sich selbst unveränderlich und ewig. Das ist das absolute Sein als ideales Ziel der Erkenntnis, auf welches hin das Material der Wirklichkeit bearbeitet wird.
Wirklichkeit und absolutes Sein sind die beiden Ecksäulen unseres geistigen Lebens, zwischen denen der unklare und doch so brauchbare Hilfsbegriff des bloßen „Seins“ seine vermittelnde Rolle spielt; und zwar entweder als bloßes anerkennendes Bewußtsein des Werdens-Stromes oder auch schon als Anerkennen gewisser Partien unseres Werdens, welche unsere Aufmerksamkeit aus dem Werden heraushebt und so erstarren läßt. – Das ist das bloße Sein, das thetische Anerkennen ohne jede Bestimmung, ein stummer Begleiter des Werdens. Demgegenüber steht das synthetische Anerkennen, das „Etwas-Sein“, das herrschend ist in unserem kategorischen Urteil. Hier wird nicht nur ein unbekannter Teil herausgehoben, sondern bereits irgendwie bestimmt. Ein Stück Werdens-Fluß sucht „Gegenstand“ zu werden. Diese Tendenz zu bestimmen, als Gegenstand zu beurteilen, ist bereits ein Schritt zur Erkenntnis, zum „Als-einsichtig-Beurteilen“ hin; ist aber noch unendlich weit vom Endziel dieser Intention, vom Einsichtig-Sein, Gelten, Geistig-Notwendigsein entfernt. Trotzdem vermag diese provisorische Bestimmung den Zwecken des täglichen Lebens zu genügen, indem sie so geschickt vorgeht, daß der noch unbestimmte, noch reines Erstarrungsprodukt des Werdens gebliebene Teil eingekapselt und unschädlich gemacht wird; dies genügt deshalb für den täglichen Gebrauch, weil sich diese Bestimmung immer mehr vervollständigen, die Verwandlung der erstarrten Werdens-Stücke in Teile des absoluten Seins immer gründlicher vollführen läßt.
So steht am Anfange unseres Erlebens das Werden – als höchstes Endziel unseres Erkennens das absolute Sein – und in der breiten Mitte, welche unsere tatsächliche Erkenntnistätigkeit bedeutet, das „Etwas-Sein“, das „Gegenstand-Sein“.
Bei einem solchen Begriff des Wirklichen, wie er hier versucht worden ist, kann man mit Recht von Steigerung und von Intensität sprechen.
Das Sein hat keine Intensität; es „gilt“ oder „gilt“ nicht. Beim Werden gibt es Intensität, so wie das Leben Intensität hat, so wie Gefühle und Willen Intensität haben.
Den wesentlichsten Einschnitt in der Rangordnung der Werdensintensitäten bildet der Unterschied zwischen dem geistigen und dem vitalen Werden. Das vitale Werden vollzieht sich nach eingepflanzten Tendenzen mit einem größeren oder geringeren Spielraum. Das geistige Werden dagegen hat folgende Bewegung: der Geist setzt sich – frei – ein Wertideal als zu verwirklichendes und sucht dann diesen Wert zu verwirklichen. Es ist die Methode der Grundlegung – hier der Wertgrundlegung –, in welcher die Elemente des Geistigen: Bewußtheit, Einheit und Freiheit wieder zu erkennen sind: Bewußtheit – denn nicht ein blinder Instinkt treibt das Werden vorwärts, sondern bewußte Setzung und Methode. Einheit – denn alle Einzelwollungen führen zu dem einen Ziele, die Grundlegung ist universal, sie muß jeden Schritt stützen. Freiheit – denn es wird nicht ohne weiters das Triebmäßig-Eingelegte als Ziel gesetzt, sondern eine geistgeborene Idee.
Aus Freiheit und Einheit erwächst aber dann das höchste Ziel der Verwirklichung – jenes, das die Möglichkeit der Einheit garantiert, welches – logisch – imstande ist, in jeder Lage und in jeder Richtung Ziel zu sein, das gemeinsame Maß für alles Denkbare –, das Absolute, die höchste Einheit des Geistes.
Das absolute Sein ist also letzter Zielpunkt des Werdens – das Ideal, welches das Werden nie erreichen kann, wenn es nicht aufhören soll, zu „werden“, dem es sich aber in aller Realität ewig zu nähern vermag, da das Absolute ja nichts ist, als die gedanklich bis zum höchsten geistigen Sein gesteigerten Gegebenheiten der Wirklichkeit. Das absolute Sein ist also Wert im Sinne des zu verwirklichenden Wertes – ist das „Ideal“, zu dem hin das Werden zu treiben ist. Wertvoll ist das Werden zum Absoluten hin – paradox ausgedrückt: das Werden des ...