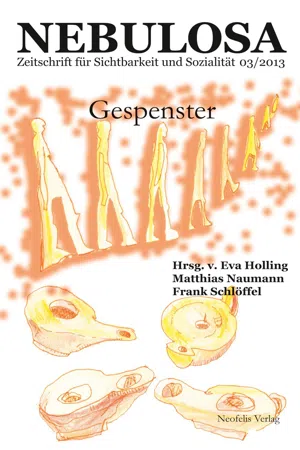Das Gespenst und seine Spektralität
Die hermeneutische Funktion des Gespensts, oder: eine phänomenologische Hantologie
Christian Sternad
Einführung
Das Gespenst ist kein klassischer Topos der Philosophie. Dies mag in mancher Hinsicht verwundern, weil vielerorts von Gespenstern die Rede ist. Dabei kommt in diesen Verwendungen dem Gespenst keinesfalls nur der Status eines „rhetorischen Ornaments“1 zu. Durch die Metapher des Gespensts – ist es nur eine „Metapher“? – wird etwas zum Ausdruck gebracht. Es wird ein komplexes Beziehungsgeflecht anvisiert, welches wichtige Wechselwirkungen zwischen der Ordnung und dem Jenseits der Ordnung, zwischen Präsenz und Absenz, Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit, Geschlossenheit und Offenheit, Diesseits und Jenseits, Gegenwart und Vergangenheit bzw. Zukunft, letztlich sogar zwischen Leben und Tod zum Ausdruck bringt.
Kurz gesagt, und damit sei auch die These dieser Ausführungen angezeigt: Mit Erscheinen des Gespensts erscheint stets mehr als nur das Gespenst selbst. Die schillernde Präsenz des Gespensts – eine Präsenz, die im vollen Sinne weder Präsenz noch Absenz ist – durchquert die als sicher geglaubten etablierten Ordnungen und nötigt diese zur Re-Definition ihrer selbst.2 Insofern es diese Ordnungen durch sein Erscheinen in Unsicherheit bringt, erscheinen mit dem Gespenst auch stets die Ordnungen, welche es durchschleicht. Dem Gespenst kommt in dieser Hinsicht eine hermeneutische Funktion zu, da stets mit seinem Erscheinen auch Aufschluss über die Ordnungen gewonnen werden kann, welche es durch sein Erscheinen irritiert. Anstatt dem Gespenst also nur eine negative Konnotation zukommen zu lassen, die Gespenster also ver- oder austreiben zu wollen, sie im hellen Tageslicht zum Verschwinden zu bringen, sollte auch die produktive Dimension des Gespensts, die durch sein Erscheinen statt hat, sichtbar gemacht werden.
Dabei beschränkt sich diese produktive Dimension, welche es Colin Davis zufolge zu einem „respectable subject of enquiry“3 macht, nicht nur auf alte Schlösser, abgelegene Friedhöfe, dunkle Ecken, dichte Wälder und allerlei andere Märchenorte. Das erschreckende Kettengerassel trifft Orte, die auf den ersten Blick nicht unmittelbar deutlich sind: Die wohl bekannteste Formulierung, die spontan mit dem Gespenst assoziiert wird, nämlich jene von Karl Marx und Friedrich Engels, bezieht sich auf nichts weniger als den Kommunismus – nebenbei bemerkt also auf eine politische Strömung, die sich die restlose Entzauberung der Weltverhältnisse zum Ziel gemacht hat – und die Staatengemeinschaft des 19. Jahrhunderts. Das Manifest der kommunistischen Partei von 1848 eröffnet mit den mittlerweile historisch gewordenen Worten: „Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des Kommunismus.“4 Die Rede vom Gespenst bezieht sich hier also auf eine politische Strömung und auf eine politische Ordnung, welche es durch sein Erscheinen provoziert und in welcher es nicht zur vollständig greifbaren Erscheinung kommt.
Heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, hat sich die Rede vom „Gespenst des Kommunismus“ in interessanter Weise verändert. Es wird darunter mehrheitlich keine reale Bedrohung mehr verstanden, sondern mit der Rede vom „Gespenst des Kommunismus“ wird vielmehr der Anspruch eines komplexen historisch-politischen Erbes mitsamt seiner Schrecken und flüchtigen zeitgenössischen Präsenzen benannt. Diese Struktur könnte auch genereller als „Gespenst der Vergangenheit“ gefasst werden, eine Denkfigur, die vor allem in der Psychoanalyse aufgegriffen wurde. Insbesondere die Arbeiten von Nicolas Abraham und Maria Torok beschäftigten sich mit der Frage, wie gewisse Traumata nicht nur in der Psyche eines einzelnen Menschen wiederkehren können, sondern auch, wie Traumata sogar generationenübergreifend ihr Unwesen treiben und bisher Vergessenes und Totgeglaubtes den Menschen gegenwärtig machen.5 Das Gespenst erlangt hierin also die Form einer erschreckenden Wiederkehr, die aus einer unbestimmten Vergangenheit die sichere Ordnung der Gegenwart in Unruhe versetzt.
Hiermit hängt eine weitere Gespenster-Rede zusammen, welche sich vorwiegend im Ausgang von Jacques Derridas Arbeiten zum Subjekt entsponnen hat. Dessen Rede vom Ich, welches nicht mit sich selbst ident ist und sich insofern gewissermaßen immer selbst „hinterherjagt“, prägte die Rede von der Hantologie. Hantologie meint dabei in phonetischer Nähe zur Ontologie und zum „Haunting“ (der Spuk) den Umstand, dass die Selbstbegründung der Ontologie immer einer Rücklaufschleife bedarf, welche nicht selbst in der Ontologie schon enthalten ist. Klarer gesagt, das Subjekt steht nicht in sich, sondern es ist gerade deswegen Subjekt, weil es auf sich zurückkommen und sich selbst zum Gegenstand der Rede machen kann. Dies bedeutet aber auch, dass es sich niemals mit sich selbst zur Deckung bringen kann. Kurz, und in den Worten Derridas gesprochen: „Das phänomenologische Ego (Ich, Du usw.) ist ein Gespenst“6, das, um sich auf sich selbst stützen zu können, sich selbst hinterherjagen muss.
Vertieft man diese Gedanken, so führt die Frage nach dem Gespenst zu weitreichenden Gedanken bezüglich der Zeit bzw. Zeitlichkeit. Mit der Heimsuchung und der Wiederkehr sind zwei unmittelbar zeitliche Momente bezeichnet, die die Gegenwart in ein komplexes Geflecht von zeitlichen Vor- und Rückläufen einspannt, in welchem mitnichten ein Bild der Gegenwart als reinem nunc stans aufrecht erhalten werden kann. Insofern erweist sich schon eine komplexere Theorie der Zeit bzw. Zeitlichkeit, wie sie in der Phänomenologie vor allem durch Edmund Husserl7 und Martin Heidegger8 in den Blick gebracht worden ist, als eine von gespenstischen Wieder- oder gar Doppelgängern affizierte Theoriebildung.
Bringt man diese Reihe von Gedanken auf eine generelle strukturelle Ebene, eine generelle „Logik des Gespensts“9 also, so wird deutlich, dass nahezu jede Ordnung bzw. Struktur von dieser Logik affiziert ist, welche im Versuch, auf sich selbst zurückzugreifen bzw. mit sich selbst zur Deckung zu kommen, dazu gezwungen ist, über sich selbst hinauszugreifen. Diese Logik entspricht der Grundannahme der poststrukturalistischen Theoriebildung, nämlich dass sich eine Ordnung bzw. Struktur niemals auf sich selbst berufen kann, ohne dabei nicht schon über sich selbst hinauszugreifen. Die Struktur muss somit eine irreduzible Öffnung zulassen, welche jedoch per definitionem innerhalb der strukturalistischen Theoriebildung nicht zugelassen werden kann.10 In seltsamer Art und Weise wird das Gespenst, begriffen als diese irreduzible Öffnung der Struktur, zur emblematischen Figur des Poststrukturalismus – selbst ein gewissermaßen philosophisches Gespenst, das noch heute, nahezu 50 Jahre nach seiner Geburtsstunde, die philosophischen Debatten immer wieder heimsucht.11
1. Das Gespenst als philosophischer Topos: Jacques Derridas Marx-Interpretation
Die Figur des Gespensts zieht mit Jacques Derridas Marx-Interpretation in die philosophische Landschaft ein und stößt dabei eine ganze Reihe von Diskussionen an.12 Derridas Interpretation provozierte vor allem unter den marxistischen und linken TheoretikerInnen Reaktionen und Kritiken, die sich, wie Michael Sprinker schreibt, „in registers ranging from skepticism, to ire, to outright contempt“13 bewegten. Die Heftigkeit der Reaktionen ist vor allem auf Derridas Ansicht zurückzuführen, dass der Marxismus in seiner historischen Formation verändert werden müsste und diese Veränderung im Sinne des Marxismus sei. Die Richtung, in welche Derrida den Marxismus bringen wollte – mitunter sogar letztlich das Projekt der Dekonstruktion strukturell mit jenem des Marxismus gleichsetzend –, stieß jedoch auf erbitterten Widerstand. So sprach nicht zuletzt Terry Eagleton von der Derrida’schen Vorstellung des Marxismus als einem „Marxism without Marxism“14.
Derrida versucht in seiner Lektüre, die Marx’sche Anrufung des G...