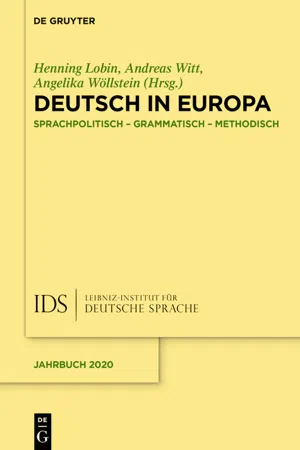
eBook - ePub
Deutsch in Europa
Sprachpolitisch, grammatisch, methodisch
- 350 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Deutsch in Europa
Sprachpolitisch, grammatisch, methodisch
Über dieses Buch
Die deutsche Sprache hat sich innerhalb Europas als Teil einer europäischen Sprachengemeinschaft entwickelt. Von besonderem wissenschaftlichen Interesse ist die Frage, wie sich Sprachen untereinander beeinflussen, verändern und mit welchen methodischen Zugängen und Sprachressourcen das zu untersuchen ist. Der ständige Austausch zwischen diesen Sprachen und die politischen Rahmenbedingungen in der Europäischen Union werfen darüber hinaus konkrete sprach- und bildungspolitische Fragen auf.
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Derzeit stehen all unsere auf mobile Endgeräte reagierenden ePub-Bücher zum Download über die App zur Verfügung. Die meisten unserer PDFs stehen ebenfalls zum Download bereit; wir arbeiten daran, auch die übrigen PDFs zum Download anzubieten, bei denen dies aktuell noch nicht möglich ist. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Pläne an: Elementar and Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Interessierte, die gerne eine Vielzahl von Themen erkunden. Greife auf die Elementar-Bibliothek mit über 800.000 professionellen Titeln und Bestsellern aus den Bereichen Wirtschaft, Persönlichkeitsentwicklung und Geisteswissenschaften zu. Mit unbegrenzter Lesezeit und Standard-Vorlesefunktion.
- Erweitert: Perfekt für Fortgeschrittene Studenten und Akademiker, die uneingeschränkten Zugriff benötigen. Schalte über 1,4 Mio. Bücher in Hunderten von Fachgebieten frei. Der Erweitert-Plan enthält außerdem fortgeschrittene Funktionen wie Premium Read Aloud und Research Assistant.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen in deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten verwenden, um jederzeit und überall zu lesen – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Bitte beachte, dass wir keine Geräte unterstützen können, die mit iOS 13 oder Android 7 oder früheren Versionen laufen. Lerne mehr über die Nutzung der App.
Ja, du hast Zugang zu Deutsch in Europa von Henning Lobin, Andreas Witt, Angelika Wöllstein, Henning Lobin,Andreas Witt,Angelika Wöllstein im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus Filología & Lingüística. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information

Erwerb, Konvergenzen, Divergenzen und Wandel des Deutschen im Europäischen Kontext
Natalia Gagarina/Sophia Czapka/Nathalie Topaj/Manfred Krifka (Berlin)
Erwerbsprofile des Deutschen im mehrsprachigen Kontext
Abstract: Der Beitrag weist auf verschiedene Typen des Erwerbs des Deutschen jenseits des Standardszenarios hin, dem muttersprachlichen Erwerb in einem deutschsprachigen Land. Es werden dann im Detail die Ergebnisse einer Langzeitstudie beschrieben, die Kinder mit russischer und türkischer Familiensprache und dem Deutschen als Zweitsprache vom Kindergartenalter bis in die Grundschule begleitete. Es zeigt sich, dass die typischen Verläufe des früheren mehrsprachigen Spracherwerbs von monolingualen Erwerbsverläufen abweichen können, und dass ein früher L2-Erwerbsbeginn sowie ein reicher und nachhaltiger Input wie explizite Sprachfördermaßnahmen den Erwerb des Deutschen fördern. Im Einzelnen weist die Studie auf die Prädiktoren der früheren Literalität hin.
1Erwerbsprofile des Deutschen
Wie jede andere Sprache kann das Deutsche auf unterschiedlichen Wegen erworben werden. Neben dem monolingualen Erwerb in einem dominant deutschsprachigen Kontext (A) kann man mindestens die folgenden Fälle unterscheiden:
(B) L1 (Erstsprach-)Erwerb des Deutschen in einem Kontext, der nicht dominant deutschsprachig ist. Man spricht hier von einer „heritage language“ – die deutsche Bezeichnung „Erbsprache“ beginnt sich gerade zu etablieren. Sie bezieht sich auf eine Sprache, die als Erstsprache in der Familie erworben wird, die in einer vorwiegend anderssprachigen Gesellschaft lebt (vgl. Lohndal et al. 2019; Polinsky/Kagan 2007). Ein gut bekanntes Szenario (B1) ist das Deutsche als Minderheitensprache in einem der mehr oder weniger geschlossenen Sprachgebiete, wie sie aufgrund von historischen Auswanderungen in manchen Ländern in Europa, Nordasien, Nord- und Südamerika und in Australien zu finden sind. Nach Ammon (2015) ist das Deutsche dann weitgehend auf den familiären oder lokalen Bereich beschränkt und wird vorwiegend mündlich tradiert. Aufgrund der rezenten deutschen Geschichte haben viele Gemeinschaften die Erfahrung sprachlicher Diskriminierung gemacht, was ein Faktor in der Neigung zu Sprachumstellung auf die dominante Sprache ist. Es gibt allerdings auch Hinweise auf die Stärkung des Deutschen in der Gegenwart; ein Beispiel hierfür ist das Netzwerk rusdeutsch.de in Russland. Die Geschichte und die grammatischen Eigenheiten von vielen minderheitssprachlichen Varietäten des Deutschen sind relativ gut erforscht. Zum Beispiel wird die Auswirkung von Kontaktsprachen in einem bestimmten Bereich der Grammatik, der Satzkomplementation in Bidese/Putman (2014) beschrieben. Gezielte Erwerbsstudien gibt es allerdings kaum.
Ein wenig erforschtes Szenario ist hingegen das Deutsche als Familiensprache von rezent Ausgewanderten (B2), die typischerweise nicht in einem historischen Sprachgebiet leben und für die das Deutsche noch stärker eine reine Familiensprache ist. Die regen Aus- und Einwanderungsbewegungen sind zwar bekannt,64 die Publikationen des German Emigration and Remigration Panel Study (GERPS)65 gehen jedoch nicht auf sprachbezogene Umstände ein. Linguistische Studien zum Erwerb des Deutschen gibt es nur wenige. Als Beispiel sei hier Lindgren (2018) genannt, wo gezeigt wird, dass das sprachliche Umfeld einen großen Einfluss auf den Erwerb des Deutschen ausüben kann. Der Einfluss des spezifischen Registers in Erbsprachen auf die Dynamik der Grammatik wird derzeit von der DFG-geförderten Forschergruppe RUEG untersucht.66
(C) Das Erlernen des Deutschen als Fremdsprache, nach dem Erwerb einer anderen Sprache als L1. Hierbei gilt es wiederum verschiedene Unterfälle zu unterscheiden: (C1) Der ungesteuerte Erwerb des Deutschen als Fremdsprache in deutschsprachiger Umgebung, der intensiv seit ca. 1980 untersucht wurde (vgl. Klein/Perdue 1997). (C2) Der gesteuerte Fremdspracherwerb in fremd- oder auch deutschsprachiger Umgebung, also im Kontext des DaF-Unterrichts. Hierbei gibt es verschiedene Mischformen, und auch das Lernalter ist zu berücksichtigen.
(D) Der bilinguale Erwerb des Deutschen, typischerweise in deutschsprachiger Umgebung. Hierbei kann man unterscheiden zwischen (D1) dem bi- oder multilingualen Erwerb des Deutschen als einer zweiten Erstsprache und (D2) dem frühen Erwerb des Deutschen als Zweitsprache.
Dieser Artikel berichtet vor allem über unsere Untersuchungen im Bereich (D) und die spezifischen Erwerbsprofile, die sprachlernende Kinder hier aufweisen. Diese Art des Deutscherwerbs ruft ein großes Interesse hervor (z. B. Ahrenholz/Grommes 2014; Czinglar 2014), durch die hohe Zuwanderung in Gebiete mit Deutsch als Mehrheitssprache.
2Der Verlauf des Spracherwerbs
2.1Der monolinguale Erwerb
Um die Besonderheiten des bilingualen Spracherwerbs hervorzuheben, wollen wir kurz an den Verlauf des monolingualen Erwerbs (also Fall A) erinnern. Man kann hier unterschiedliche sprachliche Domänen betrachten, wie den Erwerb der Phonologie und Prosodie, der sehr früh und sogar schon vor der Geburt beginnt (vgl. Werker/Hensch 2015), und dann den Erwerb des Lexikons, der Kombinationsregeln der Syntax und Morphologie und der Fähigkeit, längere Ausdrücke und ganze Texte zu produzieren. Die ersten „echten“ Wörter werden mit etwa 12 Monaten produziert, mit einem häufig auftretenden Spurt nach einer 50-Wort-Grenze – allerdings auch mit großer individueller Varianz (Szagun 2006; Kauschke 2008). In dieser Zeit können Kinder rezeptiv bis zu 20 neue Wörter (Rothweiler/Kauschke 2007) und produktiv bis zu fünf Wörter (von Koss Torkildsen et al. 2008) pro Tag erwerben. Im Alter von etwa 2 Jahren können Wörter zu Phrasen kombiniert und bereits flektiert werden – in Sprachen mit reicher Morphologie kommt dies auch schon in der Phase der Einwort-Äußerungen vor (Xantos et al. 2011). Ein Entwicklungsspurt setzt mit etwa 2,5 Jahren ein; im Alter von ca. 3–3,5 Jahren hat ein Kind die Grundlagen der Grammatik schon erworben. Die ersten längeren sprachlichen Produktionen, etwa Erzählungen, entstehen im Alter von etwa 4 Jahren, mit einem Entwicklungsspurt bis zum 6. Lebensjahr (Gagarina et al. 2015) und dann einer kontinuierlichen Weiterentwicklung vor allem in der schriftlichen Modalität.
Mehrere Studien zeigen, dass der sozio-ökonomische Status (SÖS) der Familie die sprachliche und allgemeine Entwicklung eines Kindes beeinflusst (Hart/Risley 1995; Pace et al. 2017). Ein intensiver Umgang mit digitalen Medien in den frühen sensitiven Phasen des Spracherwerbs könnte ihn beeinträchtigen (BLIKK-Medien Studie).
2.2Der bilinguale Erwerb
Der bi- oder multilinguale Spracherwerb stellt sich als inhärent komplexer dar. Der Erwerb des Lexikons und der Grammatik in zwei bzw. mehreren Sprachen erfolgt inputbedingt nicht notwendigerweise zeitgleich, und die Entwicklung von grammatischen Strukturen in der einen Sprache kann die Entwicklung in der anderen fördern oder hemmen. Es kommt dabei auf die näheren Umstände an: Wie groß und von welcher Art ist der Input in den jeweiligen Sprachen, mit wem werden die Sprachen gesprochen und wie ist der zeitliche Verlauf, in dem die Kinder diesen Sprachen ausgesetzt sind?
Meisel (2008, 2009, 2011) unterscheidet drei Gruppen: (a) Simultan bilinguale Kinder mit einem Erwerbsbeginn bis 3 Jahre, (b) sequenziell bilinguale Kinder, die ab dem Alter 3–4 bis 7 Jahre ihre L2 erwerben, und (c) Kinder, die ab dem 8. Lebensjahr eine L2 erwerben. Ruberg (2013) argumentiert, dass Kinder zutreffender in folgende Kategorien unterteilt werden können: (a) Simultaner Erwerbsbeginn bis zum Alter von 2 Jahren, (b) früh-sequenzieller Erwerb bis 4 Jahre und danach (c) später sequenzieller Spracherwerb. Es gibt noch weitere Klassifikationen (siehe Paradis 2007). Die vorliegende Studie bezieht sich auf den simultanen und frühen sequenziellen Erwerb nach Rubergs Klassifikation.
Die Unterscheidungen beziehen sich auf Erwerbsprozesse, für die es eine kritische Phase gibt, in der sie erworben werden müssen, um muttersprachliches Niveau zu erreichen (vgl. Hartshorne/Tenenbaum/Pinker 2018; Werker/Tees 2005). Der Lexikonerwerb unterliegt keiner kritischen Phase (Mayberry/Kluender 2018; Ruberg 2013) und der Erwerbsverlauf simultan bilingualer ähnelt einsprachigen Kindern mit einem Wortschatzspurt im gleichen Alter (Pearson/Fernández 1994). Sukzessiv bilinguale Kinder entwickeln sich kontinuierlicher und ohne Schübe (Jeuk 2003). Der Grammatikerwerb unterliegt hingegen einer kritischen Phase, deren Umfang allerdings intensiv diskutiert wird (Hartshorne et al. 2018; Schulz/Grimm 2019). Er verläuft je nach Erwerbsbeginn unterschiedlich: Nach Grimm/Schulz (2016) unterscheiden sich 4 bis 5 Jahre alte simultan bilinguale Kinder von monolingualen Kindern nur in jenen grammatikalischen Phänomenen, die eher spät erworben werden. Sukzessiv bilinguale Kinder mit Erwerbsbeginn nach 24 Monaten hingegen unterscheiden sich auch in früher erworbenen Phänomenen. Grimm/Schulz argumentieren, dass der Grammatikerwerb anhand des chronologischen Alters des Kindes, des Erwerbsalters bei monolingualen Kindern und des Erwerbsbeginns der L2 Deutsch beurteilt werden sollte. Der L2-Erwerb verläuft oft auch schneller, zusätzlich beeinflussen sich L1 und L2 stärker mit späterem Erwerbsbeginn. Zum Beispiel lassen Kinder mit einer L1 ohne Artikel, wie Türkisch, häufiger Artikel im Deutschen aus (Rothweiler 2016).
Der L2-Erwerb hängt außerdem mit dem Erwerbsbeginn bzw. der Kontaktzeit, der Inputqualität und -quantität, dem Sprachgebrauch, der Bildung in den jeweiligen Sprachen und der Ähnlichkeit zwischen diesen Sprachen zusammen (Gagarina et al. 2...
Inhaltsverzeichnis
- Cover
- Titelseite
- Impressum
- Vorwort
- Inhalt
- Deutsch in Europa – sprachpolitisch, grammatisch, methodisch
- Sprach(en)politik in Europa
- Erwerb, Konvergenzen, Divergenzen und Wandel des Deutschen im Europäischen Kontext
- Methoden – Sprachressourcen und Infrastrukturen
- Methodenmesse