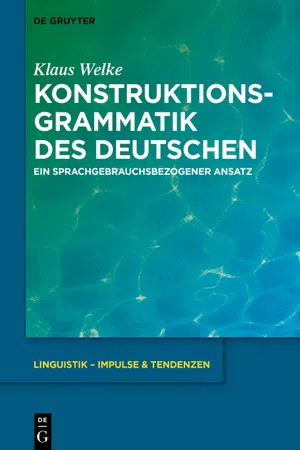1 Einleitung
Anliegen des Buches ist es, die prototypentheoretische und signifikativ-semantische Orientierung der Konstruktionsgrammatik (KxG) durch George Lakoff und Adele Goldberg (Berkeley Cognitive Construction Grammar) am Beispiel des Deutschen in Richtung auf eine sprachgebrauchsbezogene (tätigkeitsbezogene) Grammatiktheorie auszubauen, jenseits des Competence-Performance-Dualismus bisheriger Syntaxtheorien.
Moderne Grammatiken sind Competence-Grammatiken. Sie trennen zwischen langue und parole (Saussure 1967, 11916), competence und performance (Chomsky 1965). Competence-Grammatiken beschreiben nicht die sprachliche Tätigkeit des Bildens und Verstehens von Sätzen, auch nicht in (selbstverständlich) idealisierter Form. Wenn daher moderne Grammatiktheorien wie die Generative Grammatik Sprache prozessual als Erzeugen von Satzstrukturbeschreibungen darstellen, folgt daraus nicht, dass sie ein (idealisiertes) Modell der sprachlichen Tätigkeit der Sprecher/Hörer, Sprecherinnen/Hörerinnen 1 sind. Ein Blick in ein Grundlagenwerk der kognitiven Psychologie (Anderson 2007) zeigt, wie allgemein akzeptiert die Trennung von langue und parole ist. Das Kapitel 11, das der Sprache unter linguistischem Aspekt gewidmet ist (ebd. 409–452), trägt die Überschrift „Die Struktur der Sprache“, das Kapitel 12, das die Einordnung in die Psychologie vornimmt (ebd. 453–492), heißt „Sprachverstehen“. 2
Neben Competence-Grammatiken hat es im 20. Jahrhundert auch Entwürfe funktionaler Grammatiktheorien gegeben, die auf Sprache im Gebrauch, d. h. auf Aspekte der sprachlichen Tätigkeit der Sprecherinnen/Hörerinnen, gerichtet waren, meist unter vorrangig kommunikativem Aspekt (z. B. Givón 1979; Kuno 1987), aber auch unter vorrangig kognitivem Aspekt (z. B. Langacker 1987). Die Konstruktionsgrammatik (KxG) bringt nunmehr Gesichtspunkte ins Spiel, die einem möglichen Ziel der Beschreibung von Grammatik/Syntax als Aspekt der sprachlichen Tätigkeit der Sprecher/Hörer näher kommen als frühere funktionale Theorien. Indizien sind die vielfältigen Bezüge, die auf die KxG in sprachgebrauchsorientierten Disziplinen der Linguistik wie Psycholinguistik, Spracherwerbsforschung, Interaktionslinguistik, Soziolinguistik, Varietätenlinguistik, diachroner Linguistik und Grammatikalisierungsforschung hergestellt werden (Hoffmann/Trousdale 2013; Dąbrowska/Divjak 2015).
Die Beziehung zu diesen sprachgebrauchsbezogenen linguistischen Theorien beruht auf der Gebrauchsbasiertheit der KxG (Stichwort: usage-based, Goldberg 1995). Mit dieser Charakterisierung ist zunächst der Umstand gemeint, dass Konstruktionsgrammatiken ausdrücklich real vorkommende Konstruktionen als Ausgangspunkt wählen – unabhängig von der Berechenbarkeit als Phrasen in Competence-Grammatiken. Das kommt empiristischen Ansätzen wie bspw. der Forschung zur gesprochenen Sprache entgegen, die sich damit konfrontiert sieht, dass sich weite Bereiche des empirisch Vorgefundenen nicht aus Regeln ableiten lassen, die sich in Grammatiken finden (vgl. z. B. Günthner/Imo 2006: 3).
Die Anfänge der KxG werden im Allgemeinen in die zweite Hälfte der 1980er Jahre datiert, vgl. Goldberg (1995: ix), Sag/Boas/Kay (2012: 2) Lasch/Ziem (2013: 1). Einen ersten entscheidenden Anstoß gab jedoch bereits Fillmore (1966, 1968). Denn hier treten Konstruktionen als Grundeinheiten der Grammatik an die Stelle von Wörtern. Seine Sprengkraft hat diese Wendung zunächst bei der Etablierung kognitiver Handlungstheorien in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts (Minsky 1975; Schank 1975; Schank/Abelson 1977; Norman/Rumlhart 1975) bewiesen. Das hatte u. a. den Effekt, dass Fillmore „nicht nur zu einer der Vatergestalten der Handlungstheorie, sondern der kognitiven Psychologie überhaupt“ wurde (Aebli 1980: 61). Einen kongenialen zweiten Anstoß hat Lakoff (1977) mit der Einführung einer prototypentheoretischen Betrachtungsweise gegeben. Auf Fillmore (1968) und Lakoff (1977) gehen dann auch die beiden Hauptströmungen der KxG zurück, die Berkeley Construction Grammar (BCxG) und die Berkeley Cognitive Construction Grammar (BCCxG) (zu den Bezeichnungen vgl. Sag/Boas/Kay 2012: 2; Boas 2013: 1).
In der Lakoff-Goldberg-Richtung (BCCxG) kommen weitere Gesichtspunkte hinzu, die einen Bezug auf den tatsächlichen Sprachgebrauch begünstigen. Das ist vor allem der auf Lakoff (1977, 1987) zurückgehende prototypentheoretische Ansatz. Goldberg (1995) fügt das Prinzip der No Synonymy (ebd.: 3) und die Scene Encoding Hypothesis hinzu (ebd.: 39), nach der die allgemeinsten (schematischen) Argumentkonstruktionen Grundsituationen des menschlichen Lebens abbilden.
Nicht zuletzt aber erweist sich das seinerzeit so überraschende Ausgehen Fillmores (1968) von der Konstruktion und nicht vom Wort aus rückblickend als eine entscheidende Wende.
Die soeben genannten Gesichtspunkte, zusammen mit Details ihrer Ausführung, sind Grundlagen einer sprachgebrauchsbezogenen Konstruktionsgrammatik, die im Folgenden in Grundzügen am Beispiel des Deutschen entwickelt werden soll.
Es geht um eine Grammatik, die alle Konstruktionen einer Sprache gleichermaßen abzubilden in der Lage ist, also nicht nur (im Umkehrschluss zur Generativen Grammatik) Konstruktionen, die durch das Regelwerk einer Projektonsgrammatik nicht erfasst werden. Insbesondere aber geht es im Gegensatz zum Mainstream der modernen Competence-Grammatiktheorie (u. a. Generative Grammatik, HPSG, LFG) um ein Grammatikkonzept, in dem Hypothesen über grammatisch-syntaktische Prozesse und Operationen beschrieben werden, die die Sprecher/Hörer beim Bilden und Verstehen von Sätzen vollziehen. Es geht also unmittelbar um deren sprachliche Tätigkeit.
Das Buch schließt in drei wesentlichen Punkten an Goldberg (1995) an: Goldberg legt (1) im Bereich verbaler Argumentstrukturen, dem zentralen Bereich der Satzstruktur, einen ersten relativ ausgebauten Entwurf einer sprachgebrauchsbezogen interpretierbaren KxG des Englischen vor. Dieses Konzept werde ich auf das Deutsche anwenden, seine Konsequenzen ausloten, es präzisieren und revidieren. Goldberg folgt (2) dem Prototypenkonzept Lakoffs (1977, 1987) und ersetzt damit die tradierte Methode der Klassifikation mittels invarianter Merkmale 3 durch eine prototypentheoretische Methode. Lakoffs prozessuale (dynamische) und merkmalbasierte Version der Prototypik unterscheidet sich grundsätzlich von der vergleichsweise statischen Version Roschs (1973, 1978), in der die Prototypentheorie in der Linguistik hauptsächlich rezipiert wird. Bei Rosch erhält der Prototyp eine holistische perzeptive Repräsentation, bei Lakoff eine semantische Repräsentation in semantischen Merkmalen. Die prozessuale Version der Prototypentheorie entspricht Auffassungen, die vor Rosch bereits Wittgenstein (1984b) im philosophischen Kontext und Wygotski (1977) in Bezug auf den Spracherwerb vertreten haben (vgl. Welke 2005). Goldberg entwickelt (3) auf dieser Basis eine Theorie der Argumentkonstruktionen und ihrer Instantiierung, die sprachgebrauchsbezogen interpretierbar ist.
Bereits aus diesen Ankündigungen folgt, dass ich mich auf Grammatik im Engeren beziehe, auf Konstruktionsgrammatik als eine Theorie des Satzes und seiner syntaktisch-semantischen Struktur. Das geschieht mit allen Gebrechen und Mängeln traditionellen grammatischen Herangehens – nicht korpusbasiert, nicht psychologisch experimentell, sondern auf Grund von meist schriftlichen Belegen und selbst gebildeten Beispielen, also introspektiv, wie m. E. allgemein in traditionellen und modernen Competence-Grammatiken, und auf der Grundlage traditioneller Methoden der Grammatikforschung, aber Prinzipien der Plausibilität, Folgerichtigkeit und Einfachheit verpflichtet – und sprachgebrauchsbezogen. 4
Ich spreche damit die rasante Ausweitung an, die das Konzept der Konstruktionsgrammatik insbesondere durch die Anwendung korpusbasierter Methoden und durch sprachgebrauchsbezogene linguistische Theorien wie Psycholinguistik, Spracherwerbsforschung, Interaktionslinguistik, Soziolinguisitik, Varietätenlinguistik, Phraseologieforschung, diachrone Linguistik und Grammatikalisierungsforschung erfahren hat, alles Theorien, in denen die competence-performance-Dichotomie keine Rolle spielt (vgl. z. B. die Beiträge in den Bänden Konstruktionsgrammatik I–V (Fischer/Stefanowitsch 2006; Stefanowitsch/Fischer 2008; Lasch/Ziem 2011; Ziem/Lasch 2015; Bücker/Günthner/Imo 2015). Dennoch suchen diese Theorien einen Anschluss an den traditionellen und daher relativ ausgearbeiteten Kernbereich der Grammatiktheorie, also an die Grammatik- und Syntaxtheorie in ihrem bisherigen Verständnis. Die Wahl fällt auf Grund ihrer Gebrauchsbasiertheit auf die KxG, wie sie u. a. von Fillmore, Lakoff und Goldberg konzipiert wurde.
Breit ausgebaut wurde bspw. in der jüngsten Zeit die Interaktionslinguistik im Zusammenhang mit Gesprächsforschung und Mündlichkeit (Günthner/Imo 2006; Deppermann 2007; Imo 2007; Günthner/Bücker 2009; Auer/Pfänder 2011). Günthner (2008: 157) begründet die Suche nach einem traditionell grammatiktheoretischen Bezug folgendermaßen:
In den letzten Jahren wird in Arbeiten zur Grammatik der gesprochenen Sprache zunehmend das Bedürfnis nach einer sprachtheoretischen Fundierung artikuliert. Empirische Studien...