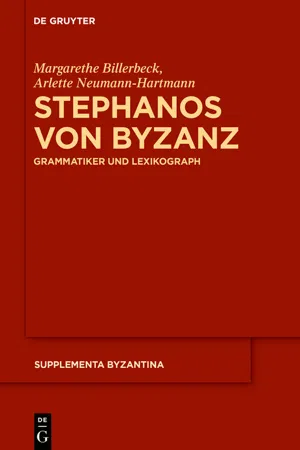1 Einführung
Als γραμματικός und Inhaber eines der zehn Lehrstühle für Griechische Grammatik an der Kaiserlichen Hochschule von Konstantinopel bekleidete Stephanos ein angesehenes Amt im höheren Bildungswesen. Wie attraktiv die wissenschaftliche Institution der Hauptstadt geworden sein muss, zeigt die Liste der Gelehrten, welche aus anderen Landesteilen des Reiches dorthin berufen wurden, wobei der Zuwachs aus Alexandreia, der Wiege der ‚Klassischen Philologie‘, am grössten war: Helladios (α 28, β 88), Horapollon (φ 49), Eudaimon (s. unten S. 22 f.), Eugenios (α 305), Oros (s. unten S. 46 ff.), usw. Im Gegensatz zum Lehrer des Elementarunterrichts (γραμματιστής), der seinen Schülern Lesen und Schreiben beibrachte, vermittelte der ‚Grammatikos‘ den Studierenden eine allgemeine Bildung, um sie für den Eintritt in die rhetorische Schulung und gegebenenfalls für eine spätere Laufbahn im Staatsdienst vorzubereiten, wie sich dies seit der Zweiten Sophistik eingebürgert hatte.1 Unerlässlich für einen höheren Status in der byzantinischen Gesellschaft waren die Kenntnis der antiken Literatur und die Sprachbeherrschung, welche man an den klassischen Vorbildern erlernte (‚Hellenismos‘). Eine einschlägige Lehrbefugnis setzte beim Dozenten Kompetenz sowohl in der Literaturwissenschaft als auch in der Sprachwissenschaft voraus, in Disziplinen also, welche sich in der Kaiserzeit und der Spätantike auseinanderzuleben begannen und auch an unseren Universitäten in der Regel getrennte Fächer sind. Flüchtige Benutzer der Ethnika gewinnen nicht selten den Eindruck, das Lexikon sei in erster Linie ein Produkt der τέχνη γραμματική, weil der Verfasser sein hauptsächliches Interesse auf die korrekte Schreibweise der Ortsnamen und die Ableitung der Ethnika richte. Diese Sichtweise ergibt sich aus der überlieferten Fassung des Lexikons, ist doch der Verkürzung viel vom ursprünglichen literarischen und kulturhistorischen Informationsgut zum Opfer gefallen. Die Verengung eines enzyklopädischen Werkes auf den rein grammatischen Gehalt, wie sie die überlieferte Epitome oft suggeriert, widerspiegelt eine Entwicklung innerhalb der kaiserzeitlichen Philologie: Die umfassende Erklärung antiker Texte weicht zunehmend dem Interesse für Sprachtheorie sowie der Abfassung rein sprachlicher (insb. attizistischer) Lexika und grammatischer Lehrbücher. So ist etwa die grammatische Ausrichtung im Werk von Eugenios, dem Vorgänger des Stephanos an der Hochschule, nicht zu verkennen; sein Interesse für Metrik, Mirabilien, Mythologie und Sprichwörter belegen aber, wie breit gefächert das Erbe der Klassischen Philologie in Konstantinopel weiterhin gepflegt wurde.2 Die Interpretation der antiken Texte, die Hauptaufgabe des ‚Grammatikos‘, vollzieht sich durch das Kommentieren von Inhalt und Form, setzt also die Konsultation von Kommentaren/Scholien und Spezialwerken voraus, wobei das Auffinden von Etymologien, das Aufzeigen von Analogien und die Zuordnung zur richtigen Deklination feste Bestandteile bilden. Die ganzheitliche Philologie alexandrinischer Tradition behauptete in Konstantinopel, so scheint es, auch noch zu Zeiten des Stephanos ihren angestammten Platz.
Anschluss an die grossen Vorgänger bot einerseits die Homerexegese, auf welche noch zurückzukommen sein wird (s. unten S. 26 ff.), andererseits die Interpretation der hellenistischen Dichter wie Philetas, Kallimachos, Apollonios Rhodios, Lykophron, Rhianos, Euphorion, Parthenios und Demosthenes von Bithynien, von dessen Existenz wir lediglich durch die Ethnika des Stephanos Kenntnis haben. Was sie für Stephanos, der sie mehrfach zitiert, interessant machte, sind die Gründungslegenden, die Vorliebe für seltene Namen und Namensvarianten sowie die dunklen Etymologien und gelehrten Anspielungen. Entsprechend sind die Ethnika für die Überlieferung von Fragmenten hellenistischer Poesie von grossem Wert.3 Als Quelle ersten Ranges für lexikographisches Gut dienten dem Verfasser die Aitia des Kallimachos sowie die Alexandra des Lykophron, die selbst in der Epitome mit über fünfzig Versen im Vollzitat vertreten ist. Wollte man das schwierige Gedicht verstehen, war man auf professionelle Erklärung angewiesen, und dazu scheint in augusteischer Zeit vor allem Theon von Alexandreia beigetragen zu haben: „Theon took the lead in the interpretation of Hellenistic poetry within Alexandrian scholarship. By integrating contemporary literature into the spectrum of philological interpretation he broke new ground in the Alexandrian scholarly tradition. Theon’s works on the Hellenistic poets provided a rich basis and shaped the subsequent commenting activity in this field during the following centuries“.4 Von ihm sind Kommentare (ὑπομνήματα) zu Kallimachos, Apollonios von Rhodos, Lykophron, Nikander und möglicherweise auch zu Theokrit bezeugt.5 In den Ethnika, die sechs Fragmente überliefern, steht er für seine Erklärungsschrift zu Nikanders Theriaka neben Plutarch und Demetrios Chloros.6 Auf seinen Kommentar zur Alexandra verweist die Epitome zweimal namentlich, so ein erstes Mal im Artikel ‚Aineia‘ (α 132): „Theon hingegen nennt diese Stadt Aineiadai, wenn er in seinem Kommentar zu Lykophron (ὑπομνηματίζων τὸν Λυκόφρονα, zu V. 1261) schreibt: ‚Aineias aber gelangte nach der Zerstörung von Ilion nach Thrakien und gründete dort eine Stadt namens Aineiadai, wo er seinen Vater begrub‘.“ Und ähnlich klingt es im Eintrag ‚Kytina‘ (κ 300): „Kytina, Stadt in Thessalien, wie Theon in seinem Kommentar zu Lykophron (ἐν Ὑπομνήματι Λυκόφρονος, V. 1389) angibt“. Aus demselben Werk dürfte zudem der Hinweis im Artikel ‚Argyriner‘ (α 404) stammen: „Argyriner, epeirotisches Volk, wie Timaios und Theon angeben. Auch Lykophron (1017) sagt: ‚Zu den Argyrinern und in die bewaldeten Täler der Keraunier hinein‘.“ Weiterem Erklärungsgut aus Theons Exegese bei Stephanos spürten Eduard Scheer in seiner Untersuchung der Lykophronscholien nach und ihm folgend Carl Wendel, so etwa in den Artikeln ‚Aigys‘ (α 113); ,Atrax‘ (α 523); ‚Gonnoi‘ (γ 94) mit ,Phalanna‘ (φ 12); ,Magarsos‘ (μ 1) und ,Phaleron‘ (φ 18).7
Auf einen Kommentar zur Ilias, insbesondere den ‚Schiffskatalog‘, schloss Wendel aus den Nennungen von Theon in zwei Einträgen der Ethnika. In den Artikel ‚Alos‘ (α 226) eingeflossen ist das homerische Zetema zur Polis Alos (Il. 2,682), deren Lokalisierung und Namensetymologie umstritten war. Bei Stephanos heisst es: „Alos, Stadt in Achaia und in der Phthiotis, unterhalb des auslaufenden Othrysgebirges gelegen (ὑπὸ τῷ πέρατι τῆς Ὄθρυος). Sie ist ungefähr sechzig Stadien von Iton entfernt (ἀπέχει δὲ Ἴτωνος ὡς ξ′ σταδίους). Athamas soll sie gegründet haben (κτίσαι δ’ αὐτὴν Ἀθάμαντα). Benannt ist sie nach dem langen Umherirren (ἄλη), das ihm widerfahren war. Theon hingegen sagt, Alos sei eine Dienerin des Athamas gewesen, die verraten habe, dass Ino die Saatkörner rösten lasse [um Misswuchs zu verursachen]; zu Ehren dieser Dienerin habe er die Stadt Alos genannt. Parmeniskos jedoch berichtet von zwei Orten namens Alos, einerseits von demjenigen am Malischen Golf [in Achaia] unter der Herrschaft des Achill, andererseits von jenem [in der Phthiotis] unter der Herrschaft von Protesilaos.8 Ihr Name wird sowohl im Maskulinum als auch im Femininum gebraucht (λέγεται δὲ καὶ ἀρσενικῶς καὶ θηλυκῶς)“. Das Referat ist in mehrfacher Weise aufschlussreich. Direkte Vorlage des Stephanos war Strabon, der die unter den Homerinterpreten geführte Diskussion über Alos und Phthia (Il. 2,682 – 683) ausführlich referiert (9,5,5 – 8); so zeigen es die wörtlichen Übereinstimmungen.9 Ob Stephanos ursprünglich aus dem Geographen noch mehr geschöpft hat als die Epitome überliefert, lässt sich nicht ausmachen; die Verweise auf Theon und Parmeniskos gehen jedoch auf das Konto des Lexikographen.10 Es drängt sich demnach der Schluss auf, dass Stephanos neben Strabon, auf den der Quellenverweis hier allerdings fehlt, zusätzliche Auskunft bei den namentlich aufgeführten Homerinterpreten holte. Das gleiche homerische Zetema (Il. 2,683) liegt nämlich auch dem Artikel ‚Phthia‘ (φ 58) zugrunde: Hat Homer mit Phthia eine Landschaft (χώρα) oder eine Stadt (πόλις) gemeint? Wiederum referiert Stephanos – diesmal mit namentlichem Quellenverweis – aus Strabon (9,5,6) und bestimmt unter dessen Einfluss den Ort als „Phthia, Stadt (πόλις) und Teilgebiet (μοῖρα, Strabon μέρος) Thessaliens“. Die Meinung des beigezogenen Homerinterpreten lehnt der Lexikograph dezidiert ab: „Parmeniskos hingegen bezeichnet Phthia als Landschaft (χώρα) und nicht als Stadt; das ist falsch (οὐκ ὀρθῶς)“. Dass Parmeniskos als Homerphilologe mit besonderem Interesse für die topographische Bestimmung von homerischen Örtlichkeiten für den byzantinischen Lexikographen ergiebig gewesen sein muss, ergibt sich auch aus dem Eintrag ‚Ephyra‘ (ε 180), wo er den Alexandriner zu Il. 2,658 f. (Astyocheia/Astyoche aus Ephyre) zitiert: „Die Stadt lag zwischen Pylos und Elis, wie Parmeniskos behauptet“. Mit den insgesamt drei überlieferten Fragmenten nimmt sich die Ausbeute in der Epitome freilich mager aus. Kommen wir abschliessend nochmals auf Theon zurück, dem Stephanos ebenfalls nicht kritiklos zustimmt. In Il. 2,573 nennt Homer den Ort Ὑπερησίη, der im Lexikon unter der normalisierten Form ‚Hyperesia‘ (υ 39) aufgenommen ist. Die dortige Kontroverse über die Orthographie, „zu Unrecht (κακῶς) nennt Theon die Stadt Hypereia, denn Ὑπέρεια heisst eine Quelle in der Messeïs“, ist offensichtlich Bestandteil der Homerexegese und betrifft die Quellnamen Messeïs und Hypereia in Il. 6,457.11
Werfen wir zur Abrundung noch einen Blick auf Didymos (1. Jh. v. Chr.), den letzten grossen Alexandriner, dem Stephanos verpflichtet ist. Seine enorme Produktivität auf den verschiedensten Gebieten der Philologie hatte ihm den Spitznamen Χαλκέντερος (,der mit den eisernen Eingeweiden‘) eingetragen und ihn als Mann charakterisiert, der sich nicht mehr an alle Bücher erinnern konnte, welche er geschrieben hatte (βιβλιολάθας).12 Die Epitome führt ihn siebzehnmal an, darunter auch mit Werktiteln: Die in α 24 erwähnte Schrift über Kabassos bezog sich offensichtlich auf die homerische Stadt Καβησός (Il. 13,363), welche Stephanos unter ‚Kabassos‘ (Καβασσός, κ 2) aufgenommen hat.13 Die philologische Streitfrage nach der Anzahl von Quellen namens Arethusa behandelte er in seinem Kommentar zur Odyssee (α 410 Δίδυμος ὑπομνηματίζων τὴν ν′ τῆς Ὀδυσσείας). Die in η 27, θ 45 und μ 184 genannten Tischgespräche (Συμποσιακά) waren wohl vermischten Inhalts und zählen zur Gattung ‚Buntschriftstellerei‘. Die Verweise auf Didymos in den Artikeln, welche die Demen Trikorynthon (τ 189), Trinemeis (τ 191) und Cholargos (χ 49) betreffen, dürften der Liste von Demen (Ἀναγραφὴ δήμων) entnommen sein. Doch bleibt in der Forschung umstritten, ob nicht eher der bei Stephanos mitgenannte Perieget Diodoros der Verfasser war und Didymos lediglich als Vermittler zu gelten habe.14 Wo sein Name sonst in den Ethnika erscheint, geschieht dies entweder im Zusammenhang mit einer Homerinterpretation (α 8, α 361), mit einer geographischen Bestimmung (μ 229, ο 28) oder mit der Frage nach der richtigen Form von Toponym und Ethnikon (α 200, π 188).
Die wenigen Beispiele haben gezeigt, wie sehr Stephanos als Philologe der alexandrinischen Tradition verpflichtet ist und diese in die Ethnika einbrachte, auch wenn für uns wegen der Verkürzung des überlieferten Lexikons viel von seiner Belesenheit und seiner Auseinandersetzung mit den Kommentatoren der antiken Texte nicht mehr fassbar ist. Unter dem Eindruck von Richard Reitzensteins einflussreicher Geschichte der griechischen Etymologika (1897) neigte die ältere Quellenforschung dazu, Stephanos die direkte Benutzung alexandrinischer Erklärungsliteratur, insbesondere von Theons Kommentaren, abzusprechen; geschöpft habe er nur mittelbar, nämlich aus den Ἐθνικά seines thematischen Vorgängers Oros.15 So hält noch Ernst Honigmann in seinem RE-Artikel zu Stephanos von Byzanz fest: „Als gesichert darf vorläufig nach Reitzensteins scharfsinnigen Untersuchungen gelten, dass bei S[tephanos], der die Ethnika des Oros unverkürzt benutzte (Reitzenstein 325), auf diese alles Material zurückzuführen ist, das S. gemeinsam hat mit […] den Scholien zu Apollonios, […], den Scholien zu Lykophron, […] den Scholien zu Kallimachos“.16 Was von diesem verengten Blickwinkel zu halten ist, wird des Weiteren zu besprechen sein.
Was den Anschluss an das spezifisch grammatische Erbe in den Ethnika betrifft, sind wir abgesehen von wenigen Autoren wie Epaphroditos, Herodian und Oros auf kümmerliche Zeugnisse in der Epitome angewiesen. Namen fallen bloss sporadisch, und wir bleiben im Ungewissen, ob Stephanos ihre Werke selbst eingesehen hatte oder aus Belegketten seiner jeweiligen Vorlage schöpfte. Noch dürftiger in ihrer Aussagekraft sind die Überbleibsel aus referierten Grammatikerkontroversen, deren Autoren oft anonym bleiben. Dennoch soll hier der Versuch gemacht werden, einen gewissen Eindruck vom versunkenen Schatz der τέχνη γραμματική zu geben. Offenbar war die Akzentuierung von Bezeichnungen für Tempel und Heiligtümer (‚Temenika‘) unter Grammatikern ein beliebtes Diskussionsthema, zumal ehemalige Fachvertreter der Kaiserlichen Hochschule darüber publiziert hatten, so Horapollon (Suid. ω 159)‚17 ferner Eudaimon aus dem ägyptischen Pelusion mit Gastprofessur (?) am Bosporos sowie Ste...