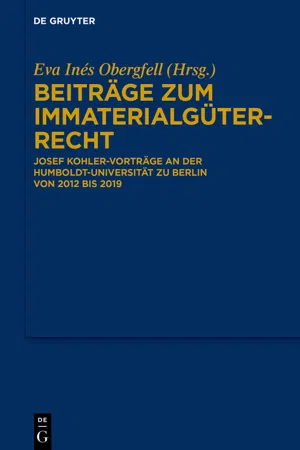A. Einleitung
Plagiate gibt es seit der Antike.1 Ein effektiver Rechtsschutz gegen Plagiate entstand erst später. Aus diesem Befund ergeben sich für die Untersuchung des Themas mehrere methodische und inhaltliche Konsequenzen.
Vor allem bedarf es der sachlichen und zeitlichen Eingrenzung und Präzisierung, da in einem kurzen Beitrag unmöglich alle rechtshistorischen Aspekte behandelt werden können. Plagiate betrafen und betreffen u. a. Werke der Musik, der Kunst, der Literatur und der Wissenschaft. Im Folgenden geht es lediglich um Werke der Literatur einschließlich der Wissenschaftsliteratur. Neben den allgemeinen Plagiatsbegriff trat erst mit dem Entstehen der neuzeitlichen Gelehrsamkeit ein auf diese bezogener Plagiatsbegriff,2 der sich dann weiter zum Begriff des Wissenschaftsplagiats entwickelte.
Dass es Plagiate seit der Antike gibt, darf nicht zu dem Schluss verleiten, dass seitdem auch Rechtsschutz dagegen bestand. Die Geschichte der rechtlichen Erfassung von Plagiaten ist vielmehr ein Musterbeispiel für Kontinuität und Diskontinuität in der Rechtsgeschichte: Während der Begriff des Plagiats und der Vorgang des Plagiierens der Sache nach seit der Antike feststellbar sind, ändern sich die ethischen, technischen und ökonomischen Bedingungen und die rechtliche Erfassung des Plagiierens. Die folgende Untersuchung setzt in der Zeit nach Erfindung des Buchdrucks in Europa ein. Sie hebt bestimmte Stationen der Entwicklung hervor. Als maßgeblich für die Rechtsgeschichte des Schutzes gegen Plagiate werden die Begriffe der Verrechtlichung und des Geistigen Eigentums angesehen.
Beide Begriffe bedürfen wiederum der Präzisierung. Der Begriff „Verrechtlichung“ wird in der Geschichtswissenschaft zwar recht häufig verwendet, bleibt aber meist undefiniert.3 Im Folgenden bezeichnet er sowohl die rechtliche Erfassung eines vorher nicht oder kaum rechtlich geregelten Sachverhalts, nämlich des Plagiats, als auch die darauf bezogene Verdichtung und Detaillierung des Rechts, nicht zuletzt im Sinne einer Ausbreitung des Gesetzesrechts.4 Der Begriff des Geistigen Eigentums wird in der Wissenschaft des geltenden Rechts in Deutschland sowohl für das Rechtsgebiet „Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht“ oder „Immaterialgüterrecht“ als auch für entsprechende subjektive Rechte verwandt, und er ist nach wie vor umstritten.5 Im Folgenden bezieht er sich ausschließlich auf das Gebiet des Urheberrechts und kennzeichnet als Quellenbegriff eine seit Ende des 18. Jahrhunderts zunächst in Naturrecht und Rechtsphilosophie vertretene Lehre, die eine Vorstufe der rechtlichen Erfassung des heutigen Urheberrechts bildet.6
Die Geschichte des Rechtsschutzes gegen Plagiate geht zunächst Hand in Hand mit der Entstehung des modernen Urheberrechts: Ein Autor ist jedenfalls dann vor Plagiaten geschützt, wenn ihm ein entsprechendes subjektives Urheberrecht zusteht. Der Entstehung eines solchen Rechts geht die Frage des Schutzes gegen unautorisierten Nachdruck von Büchern voraus. Daher wird zunächst, als erste Stufe der Verrechtlichung, der Einsatz des Privilegs gegen die auch nach der Erfindung des Buchdrucks zunächst herrschende Vervielfältigungs- und Nachdruckfreiheit behandelt (B.). Es folgen Ausführungen zu den Bestrebungen im 18. Jahrhundert, den Rechtsschutz gegen Büchernachdruck, wenn keine Privilegien bestanden, im (gemeinen) Strafrecht und im römischen Recht zu suchen (C.) und spezielle Gesetze zu fordern (D.). Da sich diese Wege zur Lösung des Nachdruckproblems als nicht oder nur schwer gangbar erwiesen, blieb ein weiteres Rechtsgebiet, auf dem die Diskussion stattfinden konnte: das Naturrecht (E.). Angesichts der Delegitimierung des Begriffs und der Erteilung von Privilegien (F.) wurde gerade im Naturrecht am Ende des 18. und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Theorie des Geistigen Eigentums entwickelt (G.). Diese bildete den Ausgangspunkt für die Gesetzgebung zum Schutz des Urhebers im Deutschen Bund (H.). Am Ende des 19. Jahrhunderts entstand das moderne deutsche Urheberrecht (I.). Als letztes Stadium der Verrechtlichung ist der Schutz gegen Wissenschaftsplagiate außerhalb des Urheberrechts durch das Wissenschaftsrecht festzustellen (J.).
B. Buchdruck und Privileg
Die Erfindung des Buchdrucks mit beweglichen Lettern im 15. Jahrhundert führte zur Entstehung eines neuen Geschäftsmodells: Buchdrucker, die gleichzeitig als Verleger handelten, konnten von einem Werk zahlreiche Bücher herstellen und vertreiben. Die Rentabilität der für ihren Gewerbebetrieb getätigten Investitionen war gefährdet, wenn weiterhin Vervielfältigungs- und Nachdruckfreiheit bestand und ein anderer Buchdrucker und Verleger als Konkurrent das Werk ebenfalls druckte und womöglich billiger vertrieb. Daher lag es nahe, dass ein Buchdrucker und Verleger nach der Möglichkeit suchte, für das gedruckte Werk oder alle gedruckten Werke ein Monopol zu erhalten. Die Erwerbung eines Privilegs für seinen Gewerbebetrieb, für die darin gedruckten und verlegten Bücher oder für ein einzelnes Buch verschaffte eine solche Monopolstellung. Mit anderen Worten: Ein Privileg bot Rechtsschutz gegen den Nachdruck von Büchern, sorgte also dafür, dass der Buchdrucker und Verleger gegen das Plagiieren der von ihm gedruckten und vertriebenen Bücher rechtlich geschützt war. Nachdruckprivilegien konnten auch Autoren erteilt werden.7
Vor der Einführung von allgemein geltenden Urheberrechtsgesetzen der deutschen Staaten im 19. Jahrhundert konnten literarische Werke also durch Privilegien gegen Nachdruck geschützt werden. Sie wurden von der jeweiligen Obrigkeit verliehen. Privilegien, so definierte Friedrich Georg August Lobethan 1796 in seinem maßgeblichen Werk zum Recht der Privilegien, „sind solche erworbene Rechte (jura quaesita), welche durch besondere Gestattung oder Erlaubniß des Regenten erworben worden sind. [...] Die allgemeine Rechtswirkung aller Privilegien besteht darin, daß dadurch der Privilegirte ein ihm eigenes Recht erhält, so wie hingegen dadurch den übrigen Unterthanen die Verbindlichkeit zuwächst, den Gebrauch dieses Rechts nicht zu hindern, und dem Privilegio nicht entgegen zu handeln.“8 Mit anderen Worten: Der Herrscher erteilte Privilegien als – in heutiger Terminologie – absolute subjektive Rechte, und zwar für eine gewisse Zeit, meist zehn Jahre. Dies erfolgte kraft seiner Privilegienhoheit, die als Bestandteil der Gesetzgebungskompetenz und diese wiederum als Bestandteil der Landeshoheit der deutschen Territorien des Alten Reichs angesehen wurde.9 Die Verletzung eines Privilegs war mit Strafmaßnahmen sanktioniert.
Dass literarische Werke durch Privilegien geschützt werden konnten, hat zu der kontrovers beantworteten Frage geführt, ob hier die rechtlichen Wurzeln des modernen Urheberrechts zu finden sind. Einzuräumen ist, dass es sich, wie gesagt, um gegen alle wirksame subjektive Rechte handelte, die einen Schutz gegen Nachdruck und Plagiate boten. Dennoch ist die Frage aus mehreren Gründen zu verneinen, also die Diskontinuität zu betonen. Pointiert gesagt: Das moderne Urheberrecht entwickelte sich gerade aus der Konfrontation mit dem Privilegienwesen.
Es wäre nämlich ein Missverständnis, Privilegien als subjektive Rechte wie andere auch anzusehen. Vielmehr sind sie, ungeachtet ihres Weiterlebens im 19. Jahrhundert, Bestandteil des juristischen und politischen Herrschaftsarsenals des absolutistisch-merkantilistischen Staates des Ancien Régime. Eine Aufzählung möglicher Privilegien macht die enge Verbindung mit dem frühneuzeitlichen Staat deutlich. Als Privilegien wurden u. a. angesehen: Zoll- und Steuerfreiheit, Militär- und Quartierbefreiungen, privilegierte Gerichtsstände, die Patrimonialgerichtsbarkeit, Jagd-, Brauerei- und Mühlengerechtigkeiten, Handels- und Gewerbeprivilegien – darunter Erfindungs- und Nachdruckprivilegien –, die Legitimation unehelicher Kinder, sog. Rechtswohltaten, etwa zugunsten von Frauen. Die denkbar unvollständige Liste gibt einen Eindruck davon, dass Privilegien einerseits Rechtspositionen umfassten, die hoheitlicher Art sind und politische Ungleichheit im Ständestaat herstellten und rechtlich absicherten, andererseits Rechtspositionen, die wir auch heute als subjektive Privatrechte oder subjektive öffentliche Rechte ansehen würden. Ihre Gemeinsamkeit besteht darin, dass sie durch einen Rechtsakt des Herrschers erteilt wurden, nicht aufgrund der Erfüllung eines Tatbestands eines für alle Bürger geltenden Gesetzes.
Ebenso wie andere Handels- und Gewerbeprivilegien sind Nachdruckprivilegien wirtschaftspolitische Steuerungsmittel d...