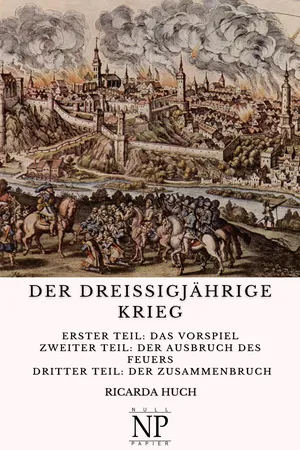
- 1,508 Seiten
- German
- ePUB (handyfreundlich)
- Über iOS und Android verfügbar
eBook - ePub
Über dieses Buch
Ricarda Huch widmete sich seit den 1910er Jahren der italienischen, deutschen und russischen Geschichte. Ihr Hauptwerk zur deutschen Geschichte entstand zwischen 1934 und 1947 und umfasst sowohl das Mittelalter als auch die Frühe Neuzeit.
Diese Sammlung über den Dreißigjährigen Krieg fasst in neuer deutscher Rechtschreibung erstmalig alle 3 Teile zusammen:
Erster Teil: Das Vorspiel
Zweiter Teil: Der Ausbruch des Feuers
Dritter Teil: Der Zusammenbruch
Null Papier Verlag
Häufig gestellte Fragen
Ja, du kannst dein Abo jederzeit über den Tab Abo in deinen Kontoeinstellungen auf der Perlego-Website kündigen. Dein Abo bleibt bis zum Ende deines aktuellen Abrechnungszeitraums aktiv. Erfahre, wie du dein Abo kündigen kannst.
Nein, Bücher können nicht als externe Dateien, z. B. PDFs, zur Verwendung außerhalb von Perlego heruntergeladen werden. Du kannst jedoch Bücher in der Perlego-App herunterladen, um sie offline auf deinem Smartphone oder Tablet zu lesen. Weitere Informationen hier.
Perlego bietet zwei Abopläne an: Elementar und Erweitert
- Elementar ist ideal für Lernende und Profis, die sich mit einer Vielzahl von Themen beschäftigen möchten. Erhalte Zugang zur Basic-Bibliothek mit über 800.000 vertrauenswürdigen Titeln und Bestsellern in den Bereichen Wirtschaft, persönliche Weiterentwicklung und Geisteswissenschaften. Enthält unbegrenzte Lesezeit und die Standardstimme für die Funktion „Vorlesen“.
- Pro: Perfekt für fortgeschrittene Lernende und Forscher, die einen vollständigen, uneingeschränkten Zugang benötigen. Schalte über 1,4 Millionen Bücher zu Hunderten von Themen frei, darunter akademische und hochspezialisierte Titel. Das Pro-Abo umfasst auch erweiterte Funktionen wie Premium-Vorlesen und den Recherche-Assistenten.
Wir sind ein Online-Abodienst für Lehrbücher, bei dem du für weniger als den Preis eines einzelnen Buches pro Monat Zugang zu einer ganzen Online-Bibliothek erhältst. Mit über 1 Million Büchern zu über 1.000 verschiedenen Themen haben wir bestimmt alles, was du brauchst! Weitere Informationen hier.
Achte auf das Symbol zum Vorlesen bei deinem nächsten Buch, um zu sehen, ob du es dir auch anhören kannst. Bei diesem Tool wird dir Text laut vorgelesen, wobei der Text beim Vorlesen auch grafisch hervorgehoben wird. Du kannst das Vorlesen jederzeit anhalten, beschleunigen und verlangsamen. Weitere Informationen hier.
Ja! Du kannst die Perlego-App sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten nutzen, damit du jederzeit und überall lesen kannst – sogar offline. Perfekt für den Weg zur Arbeit oder wenn du unterwegs bist.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Bitte beachte, dass wir Geräte, auf denen die Betriebssysteme iOS 13 und Android 7 oder noch ältere Versionen ausgeführt werden, nicht unterstützen können. Mehr über die Verwendung der App erfahren.
Ja, du hast Zugang zu Der Dreißigjährige Krieg von Ricarda Huch im PDF- und/oder ePub-Format sowie zu anderen beliebten Büchern aus History & World History. Aus unserem Katalog stehen dir über 1 Million Bücher zur Verfügung.
Information
Dritter Teil: Der Zusammenbruch
1633 bis 1650
1.
Der Kurfürst von Sachsen wurde durch die Nachricht von der bevorstehenden Ankunft Oxenstiernas in Dresden in üble Laune versetzt; er habe gedacht, sagte er, die schwedische Wirtschaft sei mit dem Tode des Königs zu Ende, nun gehe es wieder los; er wolle einmal nichts damit zu tun haben. Herr von Taube und die anderen Räte suchten ihn zu beschwichtigen und schlugen vor, den Kanzler wie den König selbst zu empfangen, damit womöglich alles glimpflich geordnet würde; er betone ja seine Friedensliebe, vielleicht könne man einen guten Frieden erlangen. Solange Oxenstierna sich bescheiden aufführe, entschied der Kurfürst, solle er nach Gebühr traktiert werden; ließe er sich aber einfallen, den Herrn zu spielen, so wolle er als ein vornehmer deutscher Kur- und Reichsfürst ihn Mores lehren. Besonders der Oberhofprediger Hoë redete dem Kurfürsten zu, das schwedische Bündnis zu halten; Gott habe die schwedischen Waffen gesegnet und werde es ferner tun, Abfall und Untreue ständen einem christlichen Fürsten nicht an. Man könne auch nicht wissen, wie Gott das getreue Ausharren des Kurfürsten noch lohnen werde. Als ihn die Böhmen im Jahre 1618 zum Könige hätten wählen wollen, habe er die große Zukunft dem Kaiser aufgeopfert; vielleicht kröne ihn dafür jetzt der Himmel freiwillig mit dieser uralten und reichen Krone. Es gehe ja alles kopfüber, kopfunter in Böhmen, die liebe Religion liege in den letzten Zügen, Mensch und Vieh kämpften miteinander um den letzten Grashalm, und das wisse ja jeder, wie die frommen böhmischen Exulanten auf den Kurfürsten als auf ihren Messias blickten. Der Kurfürst brummte, er wolle nichts, als was ihm mit Fug zustehe, und der hartköpfige böhmische Adel müsse sich noch viel tiefer bücken, bevor er sich mit ihm einließe; aber das Projekt rumorte doch in seinem Kopfe.
Ernstlicher gingen die Kurfürstin und ihre Söhne mit dem Gedanken an Böhmen um; die jungen Prinzen wären glücklich gewesen, wenn sie der väterlichen Tyrannei hätten entrinnen und außer Landes einen ansehnlichen fürstlichen Hof hätten einrichten können.
Ach, sagte der schwedische Resident Nikolai, Tränen im Auge, zu Oxenstierna, als er ihn in Dresden begrüßte, er sei ja so froh, den Kanzler zu sehen; es sei ihm fast, als hafte noch ein Stückchen von des Königs Seele an ihm.
Das möge wohl so sein, nickte Oxenstierna; denn er fühle sich zuweilen zu Handlungen und Plänen getrieben, die er früher missbilligt hätte und die er jetzt gleichsam zu des Königs Gedächtnis und wider seinen Willen tun müsse. Früher sei er mit des Königs Herumstürmen im Reich nicht jederzeit einverstanden gewesen, habe gemeint, es führe ihn zu weit ab von Schweden, und er habe ihm oft geraten, sich mit einem guten Beutel voll Geld aus dem Knäuel zu ziehen, solange es noch mit Ehren möglich sei. Jetzt steckten sie vollends wie die heiligen Märtyrer in einem Löwenzwinger, umringt von heimlichen und offenen Feinden, losgetrennt von der Heimat, ein verschlagenes Häuflein, nur der eigenen Fäuste und des eigenen Kopfes mächtig.
Des Kanzlers Kopf zähle aber auch für viele, sagte Nikolai, und er sei insoweit der alten neunköpfigen Hydra zu vergleichen.
Oxenstierna lachte und sagte, er sei mit diesem Instrument zufrieden, brauche es aber auch. Die gesamten evangelischen Stände des Reichs, eigenmächtige und verschlagene Leute, samt Frankreich unter einen Hut zu bringen, dazu müsse man ein nüchternes Gehirn und einen festen Schlaf haben. Bis jetzt habe sich der Herkules noch nicht gezeigt, der ihm das kostbare Hauptbüschel vom Halse schlüge, sicher sei es der Kurfürst von Sachsen nicht.
Nikolai schüttelte bedenklich den Kopf. Es würden mehr Stämme durch wucherndes Unkraut umgebracht als durch den Blitz gefällt, sagte er. Oxenstierna möge ihm gestatten, dass er, Nikolai, ihm mit seiner Erfahrung diene, und möge sich seine Warnungen, mehr als der hochselige König getan hätte, zu Gemüte ziehen. Er sei jetzt in Dresden zu Hause, kenne sich aus mit sächsischer Falschheit und Hinterlist. Der Kurfürst sei niemals aufrichtig schwedisch gewesen und werde es nie sein, ebensowenig sei dem Arnim und dem Lauenburger zu trauen, wie sie sich auch anstellen möchten. Ein redlich schwedisches Gemüt habe nur der alte Graf Mathes Thurn, freilich sei er nicht tief, werde leicht betrogen und könne schlecht dissimulieren. Überhaupt meine es niemand so treu mit den Schweden wie die böhmischen Emigranten, weil das mit ihrem Partikularinteresse zusammenhänge.
Freilich, ohne Köder fange man keine Fische, lachte Oxenstierna; der sächsische zappele ja schon an der böhmischen Krone, und dem brandenburgischen habe er auch einen ausgeworfen, nämlich die schwedische Heirat des Kurprinzen Friedrich Wilhelm. Das Würmlein komme ihnen zu Berlin fett genug vor, und mittels Brandenburg hätte er Sachsen ohnehin, da sich Sachsen kaum von Brandenburg trennen würde.
Bevor Nikolai sich verabschiedete, schlug er Oxenstierna vor, ihn mit dem Grafen Kinsky bekannt zu machen. Der sei kein Heißsporn wie der alte Thurn, sondern vorsichtig und gelinde. Arnim habe ihn im Jahre 1631 kriegsgefangen aus Prag gebracht, seitdem lebe er in Dresden und genieße das Wohlwollen des Kurfürsten, weil er Anno 1618 nicht dem Pfälzer, sondern ihm, dem Kurfürsten, seine Stimme gegeben habe.
So, so, sagte Oxenstierna, er denke das wohl jetzt noch zu effektuieren?
Nikolai zuckte die Schultern. Dass Kinsky, als ein eifriger Protestant, sein Vaterland wieder in den vorigen Freiheits- und Blütenstand setzen möchte, sei gewiss; aber er kenne den Sachsen zu wohl, um von ihm allein viel zu erwarten. Er wisse, dass Böhmen das Heil nur von den Schweden kommen könne. Vor allen Dingen könne er dadurch nützlich werden, dass er vermittelst seiner Frau, die eine Terzka sei, in genauer Verbindung mit Wallenstein stehe; er unterhalte auch mehrere Kundschafter bei dem General und sei von allem, was dort vorgehe, aufs beste unterrichtet.
Die Verhandlungen Oxenstiernas mit den kurfürstlichen Räten wollten indessen zu keinem Ziele führen, wie scharf er sie auch anhielt, bei der Sache zu bleiben. Ihre Versicherungen, dass der Kurfürst des geopferten königlichen Blutes eingedenk sei und von den Glaubensgenossen nicht weichen wolle, unterbrach er bald mit der Forderung, diese löblichen Absichten in Tat umgesetzt zu sehen; namentlich sollten sie sich erklären, in welcher Weise die Kräfte der Evangelischen künftig zusammengefasst und vertragsmäßig konstituiert werden könnten.
Der Kurfürst sei gesonnen, sagten die Räte, seine Liebe zu der verstorbenen schwedischen Majestät auf den Kanzler zu übertragen und sich nicht von ihm zu separieren; das Weitere würden Zeit und Gelegenheit geben. Sachsen sei ja vom Feinde gesäubert, der Kurfürst wolle sich aber damit nicht begnügen, sondern seine Waffen mit schwedischer Hilfe in Böhmen hineintragen und dem flüchtigen Feinde gänzlich den Garaus machen.
Oxenstierna lehnte sich in den Sessel zurück und spielte mit seiner Feder. So weit wären sie noch nicht, sagte er ablehnend, es sei nicht ratsam, das Kriegstheater weiter auszudehnen, bevor noch eine Basis für den Krieg geschaffen sei. Man müsse zuerst wissen, wie die Mittel für den Krieg aufzubringen wären und wer künftig das Wesen zu dirigieren hätte, damit der Brei nicht versalzen würde, wie es bei allzu vielen Häuptern zu geschehen pflege.
Dass dem Kurfürsten, als der vornehmsten evangelischen Säule des Reichs, der gebührende Respekt zuteil werde, antworteten die Räte, verstehe sich wohl von selbst. Ob Oxenstierna Ursache habe, dem Kurfürsten zu misstrauen?
Dies höflich verneinend, machte Oxenstierna die Herren darauf aufmerksam, dass er viele Geschäfte zu erledigen hätte und deshalb den Sachen gerade auf den Leib ziehen müsse. Er habe sich ausgerechnet, dass das evangelische Kriegswesen auf dreierlei Weise könnte geordnet werden: Erstens könnten wie bisher alle Glieder zu einem Corpus formiert werden, das unter schwedischer Direktion stehe; oder aber es könnten zwei getrennte Corpora gemacht werden, von denen eins Schweden, das andere den Kurfürsten von Sachsen zum Haupte hätte; drittens könnte, falls die Deutschen der schwedischen Hilfe nicht mehr zu benötigen meinten, diese Krone durch eine billige Entschädigung befriedigt werden, worauf sie sich gänzlich aus dem Kriege zurückziehen würde. Die Räte möchten diese drei Punkte dem Kurfürsten vorlegen und einen schleunigen Entschluss zuwege bringen.
Johann Georg hörte den Bericht der bestürzten Herren entrüstet an. Das fehle noch, sagte er, dass er sich von einem schwedischen Adligen an die Wand drücken ließe! Man müsse doch Zeit zum Besinnen und Überlegen haben, auf ein Entweder-Oder ließe er sich überhaupt nicht stellen.
Es sei nicht zu leugnen, meinten jene, dass der Kanzler sehr gereizt und empfindlich zu sein scheine; man müsse sich wohl oder übel entschließen, über die vorgeschlagenen drei Punkte zu beraten.
Dazu brauche er keinen Rat, schalt der Kurfürst, um zu wissen, dass er sich nicht unter einen schwedischen Edelmann stellen wolle; einen solchen Schimpf könne er sich nicht selbst antun.
Das erwarte Oxenstierna wohl auch nicht, sagten die Räte; und der erste Punkt sei also von selbst hinfällig. Der zweite Punkt sei aber auch heikel, weil Sachsen dadurch ganz isoliert werden würde.
Den erbosten Einwurf ihres Herrn, warum denn nicht davon die Rede sei, dass er, der Kurfürst, das ganze Wesen dirigiere, was doch dem Leipziger Schlusse gemäß sei, schoben die Räte mit der Bemerkung zurück, bei der exorbitanten Meinung, die Oxenstierna von seiner Krone habe, könnten sie sich nicht wohl getrauen, einen solchen Vorschlag einzubringen. Der verstorbene König habe ja mit dem König von Frankreich stets Anstände darüber gehabt, dass er mit diesem auf gleichem Fuße habe traktiert sein wollen. Da nun die Entschädigung vollends gar schwer falle, wüssten sie nichts anderes, als einen Modus zu ersinnen, wie man sich jeder bestimmten Antwort überhaupt entschlüge.
Bald jedoch meldeten die Räte, der schwedische Kanzler habe einen solchen Humor, dass verständige Leute nicht mit ihm auskommen könnten. Er habe ihre wohlgemeinten Insinuationen rotunde von sich gewiesen und in einem fast imperiosischen Tone gesagt, er wolle auf seine deutliche Frage eine kategorische Resolution haben.
Nun habe er es satt, rief der Kurfürst aus. Die fantastische Einbildung dieses Menschen sei durch den königlichen Empfang, den er ihm wider Willen und bessere Einsicht bereitet hätte, völlig ins Närrische ausgeschlagen. Er solle sich die Resolution aus seinen Fingern saugen und damit abfahren; ihm dürfe von nun an keiner mehr mit dem schwedischen Bündnis kommen.
Während diese Verhandlungen sich hinschleppten, trafen an einem der letzten Dezembertage Oxenstierna und Graf Kinsky bei Nikolai zusammen. Es war nach Kinskys Wunsch eine späte Abendstunde gewählt worden, damit der Besuch womöglich geheim bliebe, und beim Eintreten hafteten seine Blicke scheu in den düsteren Winkeln des niedrigen holzvertäfelten Zimmers. Während Nikolai ihm half, sich seines Pelzmantels zu entledigen, sagte er erklärend, die Herren kennten ja die wunderliche Gemütsbeschaffenheit des Kurfürsten, wie er bald mit diesem, bald mit jenem unzufrieden sei und dass er ihm, Kinsky, Späher nachzuschicken pflege, die ihm alle seine Schritte hinterbrächten. Er würde sogleich etwas Verräterisches dahinter wittern, wenn er mit Oxenstierna zusammenträfe, obgleich er doch der Herren Schweden Bundesfreund wäre.
Ihm, einem alten Diplomaten, sagte Oxenstierna beruhigend, könne Kinsky Vorsichtigkeit und Verschwiegenheit zutrauen. Übrigens habe er nicht im Sinne, diesen Abend Staatssachen zu traktieren, wolle sich im Gegenteil davon erholen. Er freue sich, die Bekanntschaft eines so hochgelehrten, weitberühmten Mannes zu machen, wie Kinsky sei; es ständen viel böhmische Exulanten als Offiziere im schwedischen Heer, der verstorbene König habe sie wohl zu schätzen gewusst, und es sei sein Wunsch gewesen, den armen Märtyrern zu helfen und sie in ihr Vaterland zurückzuführen. Ihm, Oxenstierna, wären des Königs Wünsche heilig, und wenn er es vermöchte, würde er die böhmischen Herren in den Frieden einschließen, sofern es einmal dazu käme.
Sofern es einmal dazu käme, wiederholte Kinsky, indem er seine traurigen schwarzen, ein wenig starren Augen auf den Kanzler heftete. Es eröffne sich ja nirgend eine Aussicht. Und so wie es in Böhmen jetzt stehe, verlange es ihn auch gar nicht heim; es sei nichts als Untreue und Unfrieden da zu finden.
Ihm komme es seltsam vor, sagte Nikolai, dass die böhmischen Herren sich so still unter dem österreichischen Joch verhielten. So kluge, mächtige und stolze Herren! Man sollte meinen, es hänge nur von ihrem Willen ab, ob sie wieder frei würden.
»Sie sind stark zur Ader gelassen«, sagte Kinsky, »das Blut von 1621 ist noch nicht ersetzt.«
»Und noch nicht gerächt«, fügte Nikolai hinzu.
Er wolle die Gerichteten von 1621, denen Gott gnädig sei, nicht verteidigen, sagte Kinsky; sie hätten keine ganz reine Sache gehabt, und er hätte sich deshalb in ihre Rebellion nicht eingelassen. Man müsse nicht unsinnig auf die eigene Kraft pochen, sondern auch den Gegner recht einschätzen, und nie einen Fuß heben, bevor man wisse, wo man ihn wieder aufsetzen könne.
Der Graf fuhr zusammen, als in diesem Augenblick dröhnend an die Haustür geschlagen wurde, und er wandte sein gelbes Gesicht ängstlich horchend nach dem Fenster, an dem große Schneeflocken, lautlos aus dem Dunkel ins Dunkel tauchend, vorüberglitten. Das sei nichts Besorgliches, sagte Nikolai gutmütig, vielleicht sei es ein Bote mit Briefschaften für ihn. Es könnten aber auch Kinder sein, die das alte Jahr austreiben wollten.
Kinsky erklärte, er sei schreckhaft, weil er krank sei, laboriere schon seit Jahren an Magenschwäche. Es lägen ihm auch zu Hause zwei Kinder krank, so sei er immer auf eine Hiobspost gefasst.
»Ja, ja«, sagte Nikolai, »die Pest ist es, die jetzt gefährlich herumgeht, vom Kriege ist dermalen weniger zu befürchten.«
Kinsky war aufgestanden und blickte auf die Straße hinunter, wo ein paar Knaben standen und mit dünner Stimme ein Lied absangen, zog ein Geldstück aus der Tasche und warf es hinaus, das Fenster behutsam ein wenig öffnend. Dann sagte er, an Nikolais Worte anknüpfend, die kaiserliche Armee unter Wallenstein sei allerdings zurzeit nicht formidabel. Dazu stecke sie so voll Protestanten, dass gar kein Mut zum Kriege gegen die Glaubensgenossen darin herrschen könne. Auch sei Wallenstein selbst krank und liege meistenteils zu Bette. Einer seiner Leibärzte habe gesagt, wenn er das Jahr überlebe, so sei es nur eine Gnadenfrist, die Gott ihm bewillige.
Er habe auch dergleichen gehört, sagte Oxenstierna, es aber für Geschwätz gehalten. Das Podagra hätten andere auch, das bringe einen Fünfzigjährigen nicht ins Grab.
Das sei je nachdem, sagte Kinsky, von den Ärzten werde er für einen Mann des Todes ausgegeben.
»So hätten wir freilich einen mächtigen Bundesgenossen«, sagte Oxenstierna.
Kinsky wiegte den Kopf und sagte zögernd, es sei die Frage, ob die Schweden nicht mehr Ursache hätten, Wallensteins Leben als seinen Tod zu wünschen. Viele wollten wissen, dass der General keine Lust mehr zum Kriege habe und den Evangelischen eher wohl als übel wolle.
»Ja, wer hätte denn noch Lust zum Kriege!« rief Oxenstierna aufseufzend. Übrigens wisse er von seinem seligen Könige, dass Wallenstein ein Wasser ohne Grund sei, in dem sich kein Schiff verankern könnte. Es seien da allerlei Knoten geschürzt gewesen, aber niemals zugezogen worden. Auf Traktate mit Wallenstein könne man keinen Wert legen, ja nicht einmal auf seine Taten. Er mache es wie gewisse Leute beim Brettspiel, die jeder Zug gereute, den sie eben getan hätten. Nach seiner Ansicht sei ein offener Feind besser als ein zweideutiger Freund, deren er leider ohnehin genug hätte.
Oxenstiernas Ablehnung schien Kinsky ein wenig zu reizen; so viel er wisse, sagte er, habe es das eine Mal an Gustav Adolf gelegen, dass das Projekt nicht zustande gekommen sei. Wallenstein sei dazumal sehr empfindlich und der alte Thurn ganz desperat gewesen. Freilich, setzte er hinzu, wären das subtile Sachen, von denen schwer zu reden wäre.
Als die Herren sich trennten, hatte Kinsky den Eindruck, dass Oxenstiernas Misstrauen gegen Wallenstein schwer zu überwinden sei und dass er sicherlich dem kaiserlichen General nicht entgegenkommen werde. Da aber Wallenstein, wie er nun einmal war, den ersten Schritt nicht tun würde, müsse man, so dachte er, mehr Samen ausstreuen; vielleicht, dass auf einem anderen Acker etwas aufginge.
2.
Nach der Schlacht bei ...
Inhaltsverzeichnis
- Titel
- Impressum
- Inhaltsverzeichnis
- Danke
- Sachbücher bei Null Papier
- Newsletter abonnieren
- Anmerkungen zur Bearbeitung
- Erster Teil: Das Vorspiel
- Zweiter Teil: Der Ausbruch des Feuers
- Dritter Teil: Der Zusammenbruch
- Das weitere Verlagsprogramm