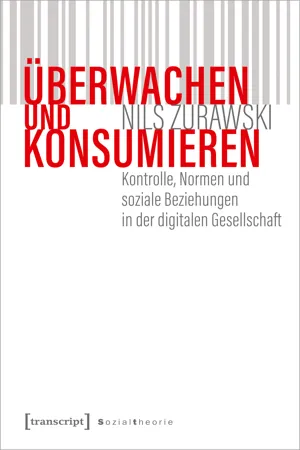![]()
Erklärungen: Distinktion, Domestiken, Konsum und Überwachung
Zurück also zur Frage, die bereits zu Beginn im Kern des Interesses stand: Warum machen da nur so viele Leute mit? Warum haben so viele Menschen ein Smartphone und lassen sich freiwillig überwachen? Zwei von vielen typischen Fragen, die in vielen populären Debatten im Zusammenhang mit dem als Problem erkannten Überwachungsmöglichkeiten der Technologien verhandelt werden. Solche Fragen klingen oft verzweifelt und häufig schwingt auch ein aufklärerischer Ton mit; Verweise auf den Datenschutz, technische Lösungen, die Gier der Unternehmen und die Unwissenheit der Nutzer:innen werden angesprochen. Ein Unverständnis offenbart sich, Empörung ob der Geschäftspraktiken oder ein Kulturpessimismus angesichts neuer Mediennutzung macht sich breit. Das alles ist mitunter gerechtfertigt, hilft aber nur wenig bei der Beantwortung der obigen Fragen, die Anlass genug sind, diese einmal anders anzugehen. Sehr unterschiedliche Phänomene zeigen zum einen die große Variationsbreite der Digitalisierung, bei denen sich aber gerade in Bezug zur eingangs gestellten Frage eine Reihe von überraschenden Gemeinsamkeiten finden lassen. Dazu hier ein paar Beispiele.
So berichtet das Wall Street Journal am 22. Februar 2019 davon, wie Facebook die Daten von anderen Apps aus dem Smartphone auslesen kann und dies auch tut. Das allein ist nicht sehr neu und in einer Reihe von Facebookberichten nur eine weitere Geschichte des laxen Umgangs mit den Daten anderer Menschen. Mit dabei war allerdings auch eine App (der Firma Flo Health), die von Frauen zur Kontrolle ihres Menstruationszyklus genutzt wird und von sich sagt, dass 25 Millionen Frauen aktive Nutzerinnen der App sind. Damit sammelt Facebook hochsensible Daten von 25 Millionen Frauen und ihren Angaben zu einer sehr privaten, intimen Angelegenheit. Das mag skandalös sein oder auch nur Teil eines digitalen Alltages. Die viel interessantere Frage ist aber, warum 25 Millionen Frauen einen solchen Dienst in Anspruch nehmen und warum sie eine App für etwas benutzen, das zum einen eine sehr intime Angelegenheit ist, zum anderen auch (so nehme ich an) ohne eine App bisher weitestgehend gut funktioniert hat. Dabei sind diese spezielle Anwendung und die damit verbundenen Services nur ein Beispiel von vielen anderen Gesundheitsapps, mit denen man den eigenen Blutdruck, den Puls, die Fitness, die Kalorien oder was auch immer messen kann. In den Stores von Google und Apple sollen 100.000 dieser kleinen Programme zur Verfügung stehen, die uns helfen können, den eigenen Körper besser zu verstehen und somit – so das Versprechen – uns selbst besser optimieren zu können, mithin bessere Menschen zu werden. Es geht bei den verschiedenen Programmen und Plänen der digitalen Zukunft um so unterschiedliche Dinge wie eben Gesundheit, Mobilität, das Wohnen der Zukunft, oder auch um die Ausforschung des Menschen, um ihnen die Angebote machen zu können, die das Leben an sich vereinfachen. Angetrieben wird vieles davon selbstverständlich von kommerziellen Interessen. So sind die Unternehmen sehr interessiert daran, ihre Kund:innen besser zu kennen, ja zu erkennen, z.B. beim Betreten eines Geschäftes ihre Gefühle zu analysieren, um entsprechende Angebote machen zu können. Werbepsychologie könnte man hier sagen. Anna Gauto beschreibt im Artikel »Sie blicken in dein Herz« (2017) sehr ausführlich die Produkte und Strategien und fragt zu Recht, ob wir eine Welt akzeptieren müssen, in der alles, auch gegen unseren Willen, protokolliert wird? Auch wenn diese Frage wichtig und wahrscheinlich entscheidend ist, wenn es darum geht die zukünftige digitale Ausgestaltung der Gesellschaft mitzubestimmen, so ist es nur die eine Hälfte der Entwicklung. Die andere Hälfte muss sich mit der Frage der »Lebenserleichterung und -verbesserung« beschäftigen. Ein Versprechen, das von den digitalen Anbietern, den großen Plattformen wie Google und Co gemacht wird. Ein Versprechen, dessen Annahme aber nicht allein mit Zwang oder Unwissenheit erklärt werden kann, nicht hierzulande, nicht in China, wo mit dem social Score ein umfassendes System der Alltagskontrolle geschaffen wurde. Hier wird kontrolliert, überwacht, aber eben auch belohnt und wahrscheinlich trifft, wenn man den Berichten Glauben schenkt, die Maßnahme auf individuelle sowie gesellschaftliche Bedürfnisse.
Überhaupt lassen sich viele Entwicklungen digitaler Technolo-gien auf den Aspekt der Lebenserleichterung zurückführen, zumindest wenn es um die Argumente ihrer Nutzung angeht. Das bekannteste Beispiel dürfte hierbei Amazons Alexa oder ähnliche Produkte von Google oder Microsoft sein. Haushaltsassistenzsysteme, die auf sprachliche Befehle bzw. durch eine Mensch-Maschine-Kommunikation, die wie eine »ganz normale Interaktion« anmutet und hilft im Haushalt Dinge zu erledigen oder andere Services für die Besitzer:innen auf den Befehl hin zu organisieren. Dazu gehört die Bedienung von so genannten Smart Homes als auch eine Bestellung beim örtlichen Pizzalieferdienst, die Musikauswahl in der digitalen Plattensammlung oder etwa bei einem Streamingdienst. Die Möglichkeiten erscheinen unerschöpflich. Dass es im Zusammenhang mit Alexa auch schon zu einer eher bedenklichen Entwicklung gekommen ist, verwundert dabei nicht. Da dieses Assistenzsystem – man könnte auch technische Mitbewohner:in sagen – alles aufzeichnet, was sich in der Wohnung so abspielt, wurde es in den USA in einem Fall zum Komplizen der Strafverfolgungsbehörden (vgl. Lobe 2017; Heller 2017). Was als Spielerei erscheint, könnte tatsächlich Konsequenzen für den Bereich der Strafermittlung, der Strafprozessordnung oder auch der Rechtssprechung in diesem Bereich haben. Was die Kriminalistik angeht, so sind die Einflüsse unübersehbar, da es auch bereits jetzt so ist, dass Datenspuren Teil der Ermittlungen sein können. Die Implikationen einer freiwilligen und umfänglichen Raumüberwachung sind nicht ganz absehbar. Rechtlich dürfte dann u.a. die Frage bestehen, was oder wer überhaupt ein Zeuge ist oder sein kann; wenn diese Systeme in der Zukunft gar eigene Zusammenfassungen liefern könnten, von Einschätzungen oder Interpretationen bis hin zu Vorschlägen zu Urteilen liefern sollten. Das geht jetzt möglicherweise etwas weit, aber durch die Anwendung, ganz gleich ob sie sinnvoll ist oder nicht, stellt sich möglicherweise auch die Frage nach einer Gleichstellung von Technik und Mensch. Aus der Perspektive des Rechts, aber vor allem aus einer gesellschaftsanalytischen, besteht die Frage, inwiefern Amazon und Co Hilfskräfte der Polizei oder gar die Polizei selbst, bzw. Agenten der sozialen Kontrolle im Auftrag eines Staates oder mit eigenem Auftrag werden können. Was an der Oberfläche wie ein Mehr an Nutzerfreundlichkeit oder Lebenserleichterung aussieht, basiert auf algorithmischen Verfahren und wird zunehmend unter der Überschrift der Künstlichen Intelligenz verhandelt – oder angepriesen, je nachdem ob man sich davon den nächsten wirtschaftlichen Boom verspricht. Dass die Ehrfurcht, die im Allgemeinen diesem Bereich digitaler Technologie entgegengebracht wird, nicht unbedingt der richtige Umgang damit ist, zeigen kritische Betrachtungen des Themas (vgl. Pasquale 2015; Feustel 2018; Pinker 2019; zu Überwachung und Religiosität auch Taureck 2014).
Es wird ersichtlich, dass die Einführung und enorm schnelle Verbreitung von algorithmischen Verfahren in Kombination mit digitalen Technologien, ihrer Vernetzung sowie der Bereich der Künstlichen Intelligenz jede Menge Herausforderungen für Gesellschaften stellen und sich grundlegende Fragen aufdrängen, die sich zum Beispiel auf die Wechselwirkungen von Technik und Gesellschaft beziehen. Dass dabei kaum Bereiche des täglichen Lebens ausgenommen sind, zeigen so banale Beispiele wie der tägliche Einkauf. Der Kauf mit Bargeld wird durch die Benutzung einer Bezahlapp auf dem Smartphone ersetzt, sowie auch andere Karten, die Zugänge oder Rabatte ermöglichen. Selbst für die Erstellung des Einkaufszettels, bisher vor allem im Alltag eine Sache von Stift und Notizblock, kann über eine App erledigt werden. Sebastian Balzter erkennt daran nicht ganz zu Unrecht einen »Irrsinn« (2019), wobei auch in seiner Beschreibung die Frage nach dem Warum der Benutzung von Seiten der Anwender:innen nicht explizit gestellt wird. Es ist klar, dass die Händler:innen den Vorgang digitalisieren wollen, denn dann können sie damit ihr eigenes Angebot verknüpfen – im Artikel ist es der Test zur REWE-App, es könnten aber auch andere sein. Initiativen im größeren Maßstab, wie das indische Programm einer cashless society (vgl. Ross 2017) verfolgen andere Ziele – hier u.a. Korruptionsbekämpfung –, die Effekte der Vernetzung dürften aber auch hier ökonomisch begründet sein und den Händler:innen eher zum Vorteil gereichen als letztlich den Kund:innen. In Indien kommt dazu das Problem einer sehr ungleichen Entwicklung und einer enormen Armut bei einem substantiellen Teil der Bevölkerung, die an den Segnungen des digitalen Zeitaltern nicht unbedingt oder nur uneingeschränkt teilnehmen kann. Daher ist ein wichtiger Grund in Indien, wie auch in den vermeintlich hoch entwickelten Staaten des Westens, die Modernität an sich. Eine Analyse der Verbreitung digitaler Technologien im Alltag kann sich nicht nur auf die Effekte der Technik oder der soziotechnischen Wechselwirkungen im Hinblick auf Kontrolle, Überwachung oder Datenschutz allein konzentrieren, sondern muss auch den Bedürfnissen nachgehen, die möglicherweise die Akzeptanz der Technologien erleichtern, ihre Verbreitung beschleunigt und die Hemmschwellen der Nutzung auch in Bereichen, wo es möglicherweise wie »Irrsinn« oder schlicht abwegig erscheint, erklären. Dass Vieles geht, ist ersichtlich und technische Neuerungen werden weiterhin scheinbar alltägliche Bereiche mit neuen Möglichkeiten erfreuen.
Dass es dabei um eine Kontrolle, um das Abgreifen von Daten oder schlicht um Profit durch neue Geschäftsmodelle geht, kann in vielen Fällen als gegeben vorausgesetzt werden. Das erklärt aber nicht die Verbreitung selbst, die Annahme und tatsächliche Anwendung der Apps, Programme, Services und der vernetzten Lebenserleichterer insgesamt. Denn der Diskurs wird weithin kritisch geführt und auch eigene empirische Forschungen haben gezeigt, dass das Wissen über mögliche Gefahrenpotenziale durchaus vorhanden ist (vgl. Zurawski 2011; ebd. 2014), dieses aber nicht unbedingt ein Hindernis darstellen muss. Warum also? Aus soziologischer Perspektive möchte ich hier folgende Aspekte für eine Erklärung der Verbreitung vorschlagen, die mögliche Bedürfnissen auf Seiten der Nutzer:innen ansprechen, jedoch nicht allein durch individuelle Vorlieben zu begründen sind.
Zum einen handelt es sich dabei um den Wunsch nach Modernität. Was dabei Modernität ist, muss hier zunächst unkonkret bleiben, auf keinen Fall aber bezieht es sich auf die historische Epoche der Moderne – etwa in Abgrenzung zur Postmoderne –, sondern eher auf eigene Wahrnehmungen von Zeitverläufen in individuellen Biografien oder einfach gegenwärtigen Zeithorizonten. Man braucht einfach den letzten Stand der Technik, das neueste Design und muss sich im Sinne des Konsums auf der »Höhe der Zeit« befinden, sonst ist man »von gestern«, was immer das heißen mag und worin auch immer diese Wünsche begründet liegen. Des Weiteren spielt der Aspekt der Distinktion eine wichtige Rolle bei der Akzeptanz vieler Angebote. Diese ist nicht zuletzt auch mit einer Idee von Modernität verbunden, nämlich dann, wenn der Gebrauch solcher Technik eben auch ein Ausweis der eigenen Modernität ist und man sich damit möglicherweise von anderen bewusst absetzen kann. Die soziologische Rahmung dieser Begriffe und ihrer Wirkmächtigkeit wäre die Konsumgesellschaft oder ein Konsumismus (vgl. Bauman 2009), dessen innere Logik ein wichtiger Baustein für die Erklärung ist. Den dritten Aspekt in dieser Reihe möchte ich als eine digitale Refeudalisierung bezeichnen, der auf einem Wunsch nach Domestiken und Dienstboten entspringt, vor allem in den Mittelschichten, hier auch als Mittel der Distinktion, aber auch getrieben von dem Menschheitstraum der Weltbeherrschung durch technische Überlegenheit, Automatisierung und allmächtiger Kontrolle der eigenen Umwelt.
Was steht hinter den Begriffen von Modernität, Distinktion und Domestiken, wie sind diese verknüpft und warum lässt sich damit eine andere Perspektive auf Überwachung und Kontrolle einnehmen – und mit welchen Gewinn für die Erklärung gegenwärtiger gesellschaftlicher Dynamiken? Vor allem beschreiben die Begriffe soziale Praktiken, in denen Menschen aufeinander bezogen in ihrem Alltag handeln; oft in Routinen, aber vor allem mit sozialem Sinn. Überwachung ist Teil dieser Routinen und Beziehungen, auch und insbesondere über Technologie vermittelt sowie wenn es um den Wunsch geht, »modern« zu sein. Das muss allerdings nicht heißen, dass Überwachung auch immer klar als solche benannt werden kann, da diese auch selbst zu einem Gut geworden ist, das verhandelt oder konsumiert wird. Immer, so scheint es mir, ist Überwachung dabei ein Vermittler von Beziehungen, bzw. in der Art und Weise der Beziehungen und Praktiken selbst eingeschrieben.
Konsum und Distinktion
Indem Konsum auch sekundäre Bedürfnisse befriedigt, also solche die über die primär physischen des Wohlbefindens und Überlebens hinausgehen, kommt der Distinktion dabei eine entscheidende Rolle zu (vgl. Hellmann 2005, 11ff u.a. anknüpfend an Bourdieu und Veblen; auch Lamla 2013, 168ff; Reith 2019). Konsum hat nicht nur ein Ziel, sondern ist das Ziel, der Sinn und Zweck der Handlung selbst. Ähnlich nimmt Bauman (2009) verschiedene Abstufungen von Konsum vor. Vor allem unterscheidet er Konsum von Konsumismus, einem gesellschaftlichen Attribut, mit der eine spezifische Form des menschlichen Zusammenlebens beschrieben wird. Bauman (2009: 65; 108f) beschreibt diese spezifische Form als Ökonomie des Überschusses und der Täuschung, in der es sichtbare Zeichen der Zugehörigkeit bedarf, um im Prozess der Selbstidentifikation eine Identität auszubilden. Das Merkmal der Konsumgesellschaft ist die Inszenierung, nicht nur der Produkte, sondern auch der Menschen als Produkte in der Ausgestaltung sozialer Beziehungen. Diese Logik wurde vielfach beschrieben, wobei nicht allein eine so genannte »konsumkritische« Haltung den Diskurs bestimmt (und hier bestimmen soll), sondern zunächst die schlichte Tatsache, dass eine solche Logik existiert und diese strukturierend wirkt. Der britische Anthropologe Daniel Miller hat durch zahlreiche ethnografische Studien zum Konsumalltag von Menschen (2012), ihren Beziehungen zu Dingen (2010) oder dem Sinn von Shopping (2008) gezeigt, wie eine Kultur des Konsums sich im Alltag materialisiert. Einkaufen als Erlebnis – im Deutschen eher mit dem englischen Begriff Shopping beschrieben – ist dabei noch kein sehr altes Phänomen, dessen Ursprünge sich auf den Beginn der Industrialisierung verorten lassen. Adam (2012) zeigt sehr schön am Bespiel der Entstehung von Warenhäusern, wie hier eine Kultur der Inszenierung von Massenartikeln entstanden ist, deren größter Erfolg wohl die symbolische Individualisierung von Massenprodukten ist. Dass es dabei auch um Täuschung, Simulation, das Kopieren von adligen Lebensstilen und Symbolen ging, sollte man einfach hinnehmen; die Konsequenzen für die sozialen Beziehungen sind dadurch aber nicht weniger real. Wolfgang Ullrich (2013) bezeichnet eine Kritik an dem Konsumismus als widersprüchlich, da dabei übersehen würde, dass auch eine Ablehnung innerhalb der Konsumlogik stattfindet. Diese spezielle Kritik an Konsum sähe diesen als Gegenüber einer reinen Kultur, die es so allerdings nicht gegeben haben könne. Insbesondere arbeite sich eine Kulturkritik von links an den Verblendungszusammenhängen der Warenwelt ab, wobei man mittlerweile durchaus argumentieren könnte, dass auch diese Art der Kritik zu einem Lebensstil geworden ist und damit zu einem Teil von Konsum. Konsum ist mehr als das Kaufen: Konsum beschreibt die Art und Weise wie soziale Beziehungen gestaltet sind; nämlich über die Auswahl, die Selbstinszenierung, die symbolische Kraft von Waren, wobei eben auch die eigene Darstellung (und soziale Identität) als Form einer Ware angesehen werden kann. Meine eigene Untersuchung zu Einkaufserfahrungen und Kundenkarten (vgl. Zurawski 2011; 2014) hat auch hier gezeigt, wie soziale Beziehungen in den Alltagspraktiken des Shopping thematisiert und verhandelt werden. Konsum ist nicht ein Extra zum ansonsten vollkommen anders verlaufenden Alltag, sondern ist der Alltag selbst. Interessanterweise waren bei der Benutzung von Kundenkarten die problematischen Aspekte der Datensammlung und der möglichen Überwachung von Gewohnheiten sowie Aktivitäten durchaus ein Thema und sogar bekannt – das aber wurde durch andere Aspekte des Konsums überlagert. Dabei auch solche Aspekte, die mit und durch eine Kundenkarte geschaffen bzw. verdeutlicht worden sind, z.B. die Treue zu einem Produkt oder den Anbieter:innen. Kundenkarten sind, bei aller Kritik an den Datensammelpraktiken ihrer Anbieter:innen, eben auf den Prozess des Konsums, sprich des Shoppens ausgerichtet, und werden nicht als ein Element der Überwachung wahrgenommen – anders als Kameras zur Kontrolle öffentlicher Plätze, die in Verbindung mit einer Kriminalprävention aufgestellt werden. Kundenkarten zu besitzen oder eben nicht, ist auch Teil von Distinktionspraktiken im Kontext des Shopping (vgl. Zurawski 2011). Dabei sind auch heute Simulationen und Nachahmungen bestimmter Konsumformen und Lebenstile von besonderen Milieus Teil von Konsumpraktiken, ähnlich wie vor 200 Jahren die Nachahmung eines adligen Stils in bürgerlichen Lebensformen, wie am Beispiel der Warenhäuser ersichtlich wird. Kernaspekt einer Konsumgesellschaft ist damit ein Widerspruch: nämlich die Individualisierung von Stilen und der eigenen Identität mithilfe von Massenprodukten. Andreas Reckwitz (2017) sieht daher auch die von ihm so genannten Singularitäten als sozial fabriziert an. Diese Singularitäten sind ein Produkt des Wunsche...