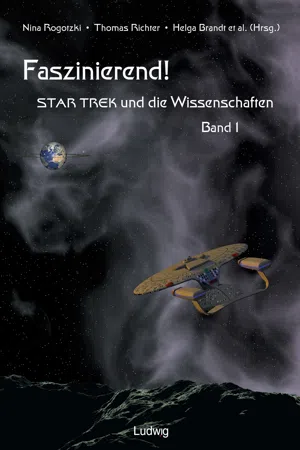Die STAR TREK-Serien: Instrumente populärkultureller Annäherung an den aktuellen wissenschaftlichen Diskurs? Eine linguistische Betrachtung
Maria Barbara Lange
1. Star Trek und Science Fiction
Eine Zuordnung der amerikanischen Erfolgsserie Star Trek zum Genre der Science Fiction scheint nahe liegend – handelt doch Star Trek von nichts Geringerem als der Zukunft der Menschheit und der Erforschung des Weltraumes im 23. bzw. 24. Jahrhundert. Und nicht nur von ›Science Fiction‹ ist im Zusammenhang mit der Serie, die mit ihrer Darstellung des friedlichen Zusammenlebens aller Menschen und auch vieler außerirdischer Spezies einen positiven Gesellschaftsentwurf vorzustellen scheint, die Rede, sondern auch immer wieder von ›Utopie‹ (vgl. bspw. Saage 1997, 55; Hellmann 1997, 100ff.).
Eine verbindliche Definition dessen, was als Science Fiction betrachtet wird, existiert nun allerdings nicht: Wenn nicht überhaupt von Erläuterungen der jeweiligen Verwendung des Begriffes abgesehen wird, kranken die Ansätze an Ungenauigkeit, Unvollständigkeit oder Unverständlichkeit. Die Abgrenzungen zu den Genres ›Utopie‹ und ›Mythos‹ erscheinen oft künstlich und willkürlich, eine Erklärung der problematischen Begriffe erfolgt zum Teil durch einander (vgl. z.B. Nicholls 1979, 210; 416; 521; 622), so dass eine klare Trennung zwischen ihnen völlig unmöglich wird. Des Weiteren werden die Begriffe ›Science Fiction‹ und ›Fantasy‹ teilweise synonym verwendet (vgl. ebd.).
Auf die Problematik der Definition des Genres macht etwa Peter Hulme aufmerksam – wenngleich auch er dabei einen indirekten Bezug zur Utopie/Dystopie herstellt:
›Science fiction‹: the term has often been seen as an oxymoron, trying to yoke together the hard facts of science with the soft realm of the imagination, the world as it really is with the world as we might want it to be, or fear it might become (1988, 118; Herv.d.Verf.).
In einem vergleichbaren Ansatz versucht Michael Shortland (1988) das besonders in den 50er Jahren des vergangenen Jahrhunderts (also unmittelbar vor der Entstehung von Star Trek) stark wachsende Interesse der amerikanischen Öffentlichkeit an UFOs und Außerirdischen zu erklären. Er kommt zu dem Schluss, dass Science Fiction die Aufgabe habe, den von der Wissenschaft unterstützten Glauben an die Einzigartigkeit des Menschen und dessen Anspruch darauf, das Universum zu unterwerfen, um es seinen Bedürfnissen, Bedingungen und Ansichten anzupassen, in Frage zu stellen. Seiner Meinung nach fungiert amerikanische Science Fiction seit der Zeit des Kalten Krieges als Orientierungshilfe angesichts rascher technologischer und sozialer Veränderungen sowie als Sprachrohr ansonsten unterdrückter – da für eine Elitekultur subversive – Kritik (vgl. auch – aus Sicht der feministischen Gesellschaftskritik – Shaw 1992).186
Doch: Ob man nun Science Fiction als ein Instrument (links-)intellektueller Kritik an einer Mainstream-Kultur sieht (vgl. etwa auch Marsalek 1992) oder als ein Forum für Wissenschaftler, die sich eine größere Popularität ihrer Disziplin durch eine weite Verbreitung von Fachwissen (wenn auch im unterhaltsamen Gewand) erhoffen – die Zugehörigkeit der Star Trek-Serien zu einem derartig verstandenen Genre, die aufgrund des Settings und der Ausstattung zunächst so offenkundig erscheint, ist für einige Kritiker, allen voran Karin Blair (1977; 1979) und William Blake Tyrrell (1977; 1979), von Anfang an fraglich gewesen. Für sie stehen vielmehr die mythischen Komponenten der Serie im Vordergrund (s. Kap. 4.2.)187 – z.B. auch bei der Suche nach Erklärungen für ihren Erfolg. Auch dass Star Trek einen utopischen Entwurf für die Zukunft der Menschheit liefere (vgl. bspw. die Selbstdarstellung der Serie in Nicholson 1996), wird immer wieder angezweifelt (vgl....